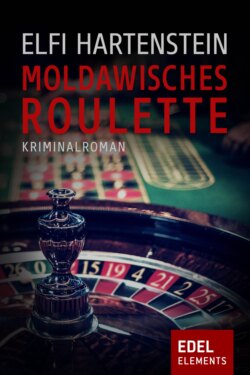Читать книгу Moldawisches Roulette - Elfi Hartenstein - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеWir melden uns an der Pforte des Verwaltungsgebäudes. Ich zeige Doncilas Schreiben. Der Pförtner telefoniert kurz und bedeutet uns dann zu warten. Man wird uns zum Weinkeller bringen. Ich kenne die Prozedur.
Rudi Pacher schlägt den Mantelkragen hoch.
»Dass es hier Anfang November schon so kalt ist, habe ich nicht erwartet.«
»Im Keller liegt die Temperatur das ganze Jahr über konstant bei zwölf Grad.«
»Dann können wir uns ja aufwärmen.«
Es dauert nur wenige Minuten, bis sich die Tür des Hauptgebäudes öffnet und Rusnac mit wehendem Mantel über den Hof auf die Pforte zusteuert. Er trägt eine schwarze Pelzmütze, die ihm das Aussehen eines gutmütigen Familienvaters verleiht. Er stutzt, als er meiner ansichtig wird. Sein kleiner Oberlippenbart zuckt, dann zieht er sich in die Breite. Rusnac hat sein schönstes Lächeln aufgesetzt.
»Miss Ritter – das ist aber eine Überraschung. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Und Sie bringen einen ausländischen Gast mit?«
Ich mache die beiden miteinander bekannt.
»Sehr angenehm«, sagt Rusnac und reicht Pacher die Hand. »Sie wissen ja sicher, dass wir seit langem mit einer österreichischen Firma kooperieren. Aber jedes Mehr an Publicity ist uns willkommen. Wir müssen in den westeuropäischen Ländern zu einem Begriff werden.«
Sein Englisch ist perfekt.
Wir gehen zum Wagen zurück. Rusnac steigt neben mir ein, Pacher klettert auf den Rücksitz.
»Unter diesen Bedingungen«, sagt Rusnac, während wir um das Dorf herumfahren und uns der gut bewachten Einfahrt zu den Kelleranlagen nähern, »werde ich Sie natürlich nicht nur einfach bei der Gruppe abliefern, sondern mich persönlich darum kümmern, dass Sie alles Wissenswerte erfahren. Und was die Weinprobe angeht, sind Sie selbstverständlich meine Gäste.«
Im Rückspiegel sehe ich, wie Pacher mir zublinzelt. Unwillkürlich frage ich mich, ob sich Rusnac mit seinem freundlichen Angebot nicht Schwierigkeiten mit der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Dame einhandelt. Aber er wird seine Gründe haben, dieses Risiko einzugehen. Und ich werde sie früher oder später erfahren.
Wir haben den Wachposten passiert, den Wagen in eine der Parkboxen gestellt und uns im unterirdischen Foyer, das mit seinen schweren Ledermöbeln einer Hotellobby ähnelt, zu dem Grüppchen bereits wartender Amerikaner gesellt. Vier Herren, zwei Damen. Ihrem gepflegten Äußeren nach zu urteilen haben sie sich nicht als Touristen hierher verirrt. Jetzt erinnere ich mich wieder, beim letzten Besuch gehört zu haben, dass Cricova auch mit einem Unternehmen in Michigan kooperiert. Als hätte er meine Gedanken erraten, flüstert Rusnac mir zu: »Eine Delegation unserer amerikanischen Handelspartner.« Man hört ihm an, dass er stolz darauf ist. Im selben Moment öffnet sich eine Tür und Maria Sokowa, die elegante, redegewandte Vorzeigedame des Unternehmens, trippelt auf hohen Absätzen auf uns zu. Sie trägt ein schmales weinrotes Kostüm. Lippenstift und Nagellack sind genau darauf abgestimmt. Nur ihr wasserstoffblond gefärbtes Haar verrät die Russin. Mit einer kleinen Verneigung begrüßt sie die Runde. Als sie Rusnac bemerkt, nickt sie ihm freundlich zu. Dann deutet sie mit der Hand auf die Längswand, wo uns ein bronzener Bacchus und ein großformatiges Porträt des sowjetischen Starkosmonauten Gagarin entgegenlächeln. Gagarin hat Cricova in den siebziger Jahren einen Besuch abgestattet. Jede Führung beginnt seither mit dem Hinweis, er habe sich damals so wohl gefühlt, dass er aus einer eineinhalbstündigen Besichtigungstour eine zwei Tage dauernde Weinprobe habe werden lassen. Und dass er zum Abschied versprochen habe, er würde persönlich noch einmal einen Flug zu anderen Planeten starten, um nach geeigneten Materialien Ausschau zu halten, sollte es je dazu kommen, dass nicht mehr genügend Metall zur Verfügung stünde für die Medaillen, die die Cricova-Weine verdienten. Maria Sokowa präsentiert diese Anekdote wie immer mit einem vergnügten Augenzwinkern und in akzentfreiem Englisch. Bevor sie die Gäste zur Rundfahrt durch die kilometerlangen unterirdischen Straßen wieder zu den Autos hinausbittet, lässt sie uns einen Blick in den großen Prunksaal und die kleineren, für die Weinproben vorgesehenen Räumlichkeiten werfen. In dem runden Neptunszimmer mit seinen Bronzereliefs von Fischen und Wasserpflanzen an den Wänden werden gerade die in offenem Halbrund stehenden Tische gedeckt. Für uns, wie Maria Sokowa versichert. Nachdem wir alles gesehen haben.
Cabernet, Sauvignon, Aligote, Pinot steht auf den Straßenschildern, die die unterirdischen Wege bezeichnen. Wir fahren an den zu beiden Seiten aneinander gereihten Fässern entlang, bis der Jeep vor uns an einer lang gestreckten, metallisch glänzenden Filteranlage anhält. In an der Decke verlaufenden Röhren gluckert roter und weißer Wein in durchsichtigen Schläuchen zu einem über einem Tisch angebrachten Zapfhahn mit Drehventil, unter dem ein Tablett mit kleinen Gläsern für eine schnelle Kostprobe bereitsteht.
Neuer Wein, belehrt man uns. Aligote.
Rudi Pacher kritzelt in sein Notizbuch. Produktionszahlen, Lagerkapazität, Exportprozentanteile.
Rusnac nimmt mir mein Glas ab und hält es noch einmal unter den Zapfhahn. Ich muss mit ihm anstoßen.
»Unsere deutschen Kunden an der Mosel sind von diesem Jahrgang begeistert«, klärt er mich auf. »Aber Sie wissen ja, das hier ist nur gewöhnlicher Tischwein. Die wirklich wertvollen Tropfen entwickeln sich erst nach entsprechender Lagerung.«
Ich nicke zustimmend. Man muss kein Experte sein, um mit dieser Erklärung einverstanden zu sein.
Wir fahren noch einige Gänge auf und ab und landen schließlich wieder an den Parkboxen.
Maria Sokowa bleibt am Eingangsportal stehen, bis alle sich im ersten Vorraum versammelt haben. Sorgfältig drückt sie die Tür hinter sich zu. Mit energischen Trippelschritten durchquert sie dann den Raum und nimmt Aufstellung unter einem offenen Türbogen, der in einen Seitengang führt. »Ich hoffe, Sie haben jetzt eine Vorstellung von dem bekommen, was sich unter den Weingärten von Cricova tut. Falls Sie Fragen dazu haben, können wir das hinterher klären.« Sie legt eine kurze Pause ein und blickt in die Runde, bevor sie fortfährt: »Jetzt möchte ich Ihnen erst noch unser Heiligtum zeigen.« Sie lächelt geheimnisvoll, macht eine halbe Drehung, deutet mit der Hand in den Gang hinter dem Türbogen und sagt feierlich: »Unsere Schatzkammer.«
Damit gibt sie Blick und Weg frei. Ehrfurchtsvoll schweigend schiebt sich das Grüppchen an gemauerten, weiß getünchten Regalwänden entlang, die bis zur Decke reichen und übereinander jeweils vier Kassetten bilden. Auf Höhe der dritten Kassette befinden sich an den senkrechten Begrenzungen elektrische Lampen, deren Schein sich in Lichtinseln bündelt, die das Halbdunkel punktuell durchbrechen und dem ganzen Raum musealen Schaukastencharakter verleihen. Der Bogen der Wände, an denen die Gruppe entlang geführt wird, beschreibt die Umrisse eines riesigen Weinglases. Man tritt am Stiel des Glases ein und folgt der gewundenen Form gegen den Uhrzeigersinn, bis man wieder am Ausgangspunkt anlangt. In den Regalkassetten – in denen, wie wir im Vorbeigehen erfahren, die Spezialjahrgangsweine lagern – sind bis zu zwölf Flaschen aufeinander und, je nach Breite des Faches, zwischen zehn und zwanzig Flaschen nebeneinander geschichtet, aber längst nicht alle Fächer sind bis oben hin voll.
Nach ein paar Schritten hält Maria Sokowa an und wartet, dass ihre Schar sich um sie sammelt. »In den vollen Fächern«, erklärt sie, »befinden sich Kollektionsweine, die auf den Markt gebracht werden, wenn sie die nötige Reife haben. Was Sie in den anderen Fächern sehen, ist jedoch unverkäuflich. Diese staubigen Flaschen hier sind sozusagen unsere Museumsschätze.« Sie lächelt aufmunternd in die Runde. »Treten Sie näher, dann können Sie die Schilder besser lesen. Hier«, sie deutet nach links auf ein paar spinnwebüberzogene Flaschen, »liegt spanischer Jerez aus den dreißiger Jahren. Über seine genaue Herkunft, das heißt über seinen ursprünglichen Besitzer, ist leider nichts bekannt. Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, eigentlich habe General Franco diese Flaschen für sich reservieren lassen – aber warum sollte ich?« Sie lacht. »Hier, im Fach daneben, sehen Sie unetikettierte Flaschen, die aus dem Vatikan stammen, aus dem Privatbesitz von Papst Pius XII.« Nachdem die ungläubig-bewundernden Ahs und Ohs der Amerikaner verstummt sind, fährt sie fort: »Ihre Echtheit ist selbstverständlich wissenschaftlich überprüft und wurde durch mehrere Gutachten bezeugt.« Besichtigungspause. »Hier liegen Rothschildweine.« Keine weitere Erklärung. Die Jahrgänge sind deutlich auf den Etiketten zu lesen. »Schmeckt der wohl noch?«, will einer der Amerikaner wissen.
Maria Sokowa hebt die Schultern. »Das ist in einem Museum wohl eher zweitrangig.« Sie lässt ihre Worte wirken, sieht wohlgefällig lächelnd zu, wie ihre Besucher sich von Kassette zu Kassette vorwärts tasten, gibt ihnen Zeit, Staub und Spinnweben zu betrachten und ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass man in Cricova derartige Werte so ungeschützt und ohne die sonst in Museen üblichen Sicherheitsvorkehrungen präsentiert. »Wir vertrauen unseren Gästen«, sagt sie nur. Der indirekte Hinweis darauf, dass nicht jeder beliebige Interessent Cricova besuchen darf, kann niemandem entgehen. »Sehen Sie«, fährt Maria Sokowa fort, »wir sind sehr stolz auf das, was wir hier haben. Für diese Flaschen hier zum Beispiel« – wieder unterbricht sie sich, tritt einen Schritt zurück und weist auf ein Fach auf der gegenüberliegenden Seite des Wegs – »wurden uns weltweit bereits Summen geboten, die in die Hunderttausende gehen. US-Dollar natürlich. Sotheby’s wartet nur darauf, sie endlich unter den Hammer nehmen zu können. Aber sie sind selbstverständlich unverkäuflich. Diese Weine stammen nämlich aus dem Weinkeller von Hermann Göring, und nicht nur öffentliche Museen, sondern auch alle möglichen Privatsammler würden sie gern haben.«
»Die spinnen«, stellt Rudi Pacher neben mir trocken fest. »Kannst du dir so was vorstellen?« Seit wir vorgestern Abend seine beiden Flaschen zusammen geleert haben, duzen wir uns.
Als Wolf und ich hier waren, habe ich ähnlich reagiert. Aber da ich heute Rusnac an meiner Seite weiß, enthalte ich mich einer Äußerung und zwinkere Pacher nur zu. Stattdessen sage ich zu Rusnac: »Für die Regierung ist es sicher gut zu wissen, dass man gegebenenfalls auf das Angebot von Sotheby’s zurückgreifen kann.«
Rusnac schüttelt den Kopf. Er scheint fast beleidigt. »Niemand würde auf die Idee kommen, die staatliche Ausgabenpolitik auf diese Weise finanzieren zu wollen.«
Unwillkürlich muss ich an die mickrigen Gehälter meiner Kolleginnen denken und spinne den Faden noch etwas weiter:
»Aber sehen Sie doch, selbst wenn man nicht alles auf einmal verkaufen würde … Ich meine, der Erlös aus ein paar wenigen Flaschen könnte doch schon helfen, die größten Lücken zu stopfen. Es blieben noch genug übrig. Hier liegen immerhin drei, fünf, sieben, neun …«
Sichtlich irritiert beobachtet Rusnac, wie ich mit dem Finger auf die Überreste des Göring’schen Weinkellers deute und vor mich hin zähle. Hastig greift er nach meinem Arm. »Kommen Sie, wir verlieren den Anschluss.«
Die Gruppe ist weitergegangen; wir sind die Letzten. Als wir uns wieder in Bewegung gesetzt haben, sagt er leise: »Ich möchte Sie etwas fragen.«
»Bitte.«
»Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit an der Universität?«
»Ja. Schon. Warum fragen Sie?«
»Ich meine, Sie verdienen dabei sicher nicht besonders gut, oder?«
»Das war mir von Anfang an klar.« Ob er mich abwerben will?
»Dann sind Sie entweder eine unverbesserliche Idealistin oder Sie haben selbst genug Geld.«
Darauf weiß ich nichts zu sagen. Mir ist nicht klar, worauf er hinauswill.
Er fasst wieder nach meinem Ellbogen. Sein Oberlippenbart nähert sich meinem Ohr. Dabei steigt mir ein dezenter Rasierwasserduft in die Nase. Ein Duft, den ich unter Hunderten sofort identifizieren könnte, da ich das Eau de Toilette dieser Serie selbst verwende. Obsession for Men. Es verwirrt mich. Nicht weil ich den Duft erkenne, sondern weil ich sofort daran denke, dass Rusnac, falls es sich nicht um eine gut gelungene Imitation handelt, für hiesige Verhältnisse eine Menge Geld dafür hinlegen muss. Auch dann noch, wenn er die Möglichkeit hat, das Eau de Toilette anlässlich eines Auslandsflugs im Duty Free Shop zu kaufen.
»Nächste Woche läuft die Antragsfrist für die Auslandsstipendien ab.«
Ich nicke erstaunt.
»Und dann müssen alle Bewerber eine Sprachprüfung ablegen, nicht wahr?«
»So ist es.«
Er ist stehen geblieben. Seine Hand liegt immer noch auf meinem Ellbogen. »Und Sie leiten diese Prüfungen?«
»Vermutlich ja.«
»Mein Sohn hat sich auch beworben.«
»Ach – ich wusste gar nicht, dass Sie einen Sohn haben, der an der Universität studiert.«
»Doch. Tudor. Er hat keinen Ihrer Kurse belegt. Ich habe ihm immer gesagt, dass das sehr unklug von ihm ist. Er hätte die Möglichkeit nutzen sollen, bei einem native speaker zu lernen. Aber trotzdem will er natürlich unbedingt für ein oder zwei Semester nach Deutschland. Alle wollen nach Deutschland.«
Er steht jetzt dicht vor mir. Ein hagerer, nach meinem Dafürhalten schöner Mann mit einem ein wenig ins Zittern geratenen Bärtchen.
»Frau Ritter, Sie können sich denken, dass ich sehr daran interessiert bin, dass Tudor diese Prüfung möglichst gut absolviert.«
Ich trete einen Schritt zurück. »Die Entscheidung über die Vergabe der Stipendien wird nicht von mir getroffen. Ich gebe nur die Anträge und Prüfungsergebnisse weiter.«
»Sie sprechen sicher Empfehlungen aus.«
Seine Augen, die, wie mir erst jetzt auffällt, die Farbe von dunklem Bernstein haben, sind plötzlich von Lachfältchen eingerahmt. Es sind gemütvolle Augen. Harte Augen. Die so tun, als sei alles ein Spiel, und gleichzeitig leise drohen. Mir wird mulmig, während ich versuche, diesem Blick standzuhalten.
»Herr Rusnac, ich … Ich habe im Moment noch gar keine Ahnung, wie viele Anträge eingehen werden. Ich nehme an, dass ich die meisten Studenten nicht persönlich kenne, Sie wissen ja …«
Mit einer Handbewegung schneidet er mir das Wort ab. Kopfschüttelnd zieht er die Augenbrauen in die Höhe, sieht mich einen Moment zweifelnd an und sagt dann so sanft, als spräche er zu einem Kind: »Wir sollten in Ruhe darüber reden. An einem anderen Ort. Es liegt mir wirklich am Herzen.«
Einen Atemzug lang hängt Obsession for Men wie ein Schleier zwischen uns, dann setzen wir uns wieder in Bewegung. Die anderen sind längst hinter der nächsten Biegung verschwunden und nähern sich dem Ausgang. Kurz bevor wir sie erreichen, flüstert er mir ins Ohr: »Es soll nicht zu Ihrem Schaden sein. Fünftausend Dollar wäre mir die Sache auf jeden Fall wert.«
Ich muss nicht mehr antworten, weil Rudi Pacher im selben Moment auf uns zusteuert.
Rusnac wendet sich sofort ihm zu. Mit einer väterlichen Bewegung legt er ihm die Hand auf die Schulter. »Ich hoffe, Sie sind beeindruckt von unseren Schätzen. Haben Sie alles notiert? Sind alle Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet worden? Ja? Gut. Dann sollten wir jetzt endlich zur Praxis schreiten. Kommen Sie – die Weinprobe wartet auf uns.«
Jetzt breitet er beide Arme aus wie ein Schutzengel, hält Pacher links, mich rechts von sich fest und steuert mit uns auf das Neptunszimmer zu, wo die Amerikaner gerade ihre Plätze einnehmen.
»Immerhin weiß ich jetzt, warum Rusnac sich nicht seinen amerikanischen Geschäftsfreunden gewidmet hat, sondern uns«, sage ich zu Rudi Pacher. Wir sitzen in der Lobby des Hotel Cosmos, gehen noch einmal seine Notizen durch und lassen den vergangenen Nachmittag Revue passieren.
»Dir, meinst du.«
»Aber es ist mir trotzdem schleierhaft, was er eigentlich im Schilde führt. Für fünftausend Dollar kann er seinen Sohn doch auch ohne Stipendium ein Semester in Deutschland studieren lassen.«
»Könnte es eine Prestigeangelegenheit sein?«
»Kann ich mir nicht vorstellen. Was hat er davon, wenn er erzählen kann, dass sein Sohn ein Stipendium erhält? Noch dazu, da jeder weiß, dass er genug Geld hat, um ihn selbst ins Ausland zu schicken.«
Pacher schaut angestrengt auf seinen Notizblock, den er auf dem Schoß hält.
»Das ist wahrscheinlich der Punkt«, sagt er schließlich.
»Was?«
»Cricova ist ein staatlicher Betrieb, nicht wahr?«
»Ja.«
»Du hast selbst gesagt, dass staatliche Betriebe in diesem Land keine hohen Gehälter bezahlen.«
»Aber …«
»Ich versuche mir nur gerade vorzustellen, wie ich mich an seiner Stelle verhalten würde.«
»Rusnac hat doch Geld.«
»Eben.«
Jetzt erst dämmert mir, worauf er hinauswill.
»Du meinst, solange er sich im Rahmen dessen bewegt, was hier üblich ist, braucht er keine unangenehmen Fragen zu fürchten? Und dass Schmiergelder zur Tagesordnung gehören? Weil das praktisch jeder macht?«
»So ungefähr. Vermutlich ist er selbst auf diese Art und Weise reich geworden und will es nicht an die große Glocke hängen.«
»Logisch wäre es. Aber es kommt mir trotzdem absurd vor.«
Pacher grinst mich an.
»Was hast du?«, frage ich.
»Ich habe nur gerade gedacht, dass du mich jetzt eigentlich ins beste Hotel zum Abendessen einladen könntest. Wo du doch fünftausend Dollar in Aussicht hast.«
»Idiot.«
Er steht auf. »Ich bin sowieso zu satt im Moment. Diese ganze Esserei und der Wein – mir reicht’s für heute. Es ist wohl besser, wenn ich mich an meinen Artikel setze. Sehen wir uns morgen?«
»Wenn ich mich vormittags an meinem Schreibtisch austoben darf, ja. Ich rufe dich an.«
»Besser, ich melde mich bei dir. Kann ja sein, dass ich mir die Zeit davor irgendwo in der Stadt vertreibe.«
Er schickt mir sein hübsches, unternehmungslustiges Pfadfinderlächeln hinterher, als ich mich am Pförtner vorbei durch die beiden schräg versetzten Glastüren winde.