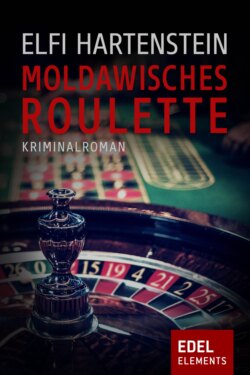Читать книгу Moldawisches Roulette - Elfi Hartenstein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEndgültig vorbei war der Abenteuerurlaub, als Wolf eine Woche später nach Hause aufbrach.
Fünf Tage lang hatten wir im Hotel National zähneknirschend Ausländerpreise berappt, was uns zwar nicht den Luxus eines Kühlschranks oder eines Fernsehers mit Kabelanschluss einbrachte, aber zumindest die Sicherheit, dass das Auto mit meinen Habseligkeiten auf einem umzäunten bewachten Parkplatz stehen konnte. An der Universität, zu der wir uns am ersten Tag durchfragten, stellten wir fest, dass außer der Pförtnerin und ein paar Putzfrauen noch keine Menschenseele auf dem Posten war. Auch unter meiner Kontakttelefonnummer war niemand zu erreichen. Als wir zwei Tage später endlich Tamara, die gerade von ihrer Datscha in die Stadt zurückgekommen war und noch gar nicht damit gerechnet hatte, dass ich schon hier sein könnte, an die Strippe bekamen, hatten wir die Erkundung der Stadt weitgehend beendet und begriffen, warum die Vertreter der Tourismusbranche hier keine Goldgruben wittern.
»Möchte wirklich gern wissen, wer auf die Idee gekommen ist, ein verschlafenes Fünfzigtausend-Einwohner-Städtchen innerhalb von vierzig Jahren auf Metropolenmaß zu bringen«, hatte Wolf kopfschüttelnd gesagt. »Achthunderttausend Menschen in hässliche riesige Wohnblocks zusammenzupferchen – wer sich so etwas ausdenkt, sollte zur Strafe selbst lebenslänglich da wohnen müssen.«
Wir waren uns einig, dass ich mich unter keinen Umständen in eine Wohnung irgendwo an der Peripherie verfrachten lassen würde. Diese Tristesse zu ertragen, traute ich mir nicht einmal für die geplanten zwei Jahre zu. Obwohl anzunehmen war, dass die Wohnungen selbst nicht so verlottert waren, wie der äußere Eindruck es vermuten ließ.
Zum Glück hatte auch Tamara sich darüber Gedanken gemacht.
Über die Wohnung, die sie für mich auftrieb, kann ich mich nicht beklagen, auch wenn angesichts der hiesigen Einkommensverhältnisse eine Miete von 150 Dollar für zwei Zimmer krass überhöht ist. Doch dass man von Ausländern gern ein bisschen mehr nimmt, hatten wir ja bereits im Hotel erfahren. Immerhin aber haben die Häuser in dieser schmalen, von hohen Akazien gesäumten Einbahnstraße nur acht Stockwerke. Es gibt ein paar kleine Läden, eine Bushaltestelle, einen Taxistand und abends meistens auch Licht aus Straßenlampen. Und zur Uni kann ich, wenn mir danach ist, sogar zu Fuß gehen.
Einziehen konnten wir zwei Tage später. Und weil Wolf, vorausschauend, wie er ist, nicht nur Werkzeug, sondern auch Unmengen von Telefonkabeln eingepackt hatte, konnte er, während ich Möbel hin- und herrückte und meine Siebensachen verstaute, Telefon, Fax und Internetanschluss in Gang bringen. Dann machten wir uns auf den Weg zu Tamara, die zwei Straßen höher am Berg wohnt und es sich nicht hatte nehmen lassen, ein Abschiedsabendessen für Wolf vorzubereiten. Am nächsten Vormittag musste er los.
»Pass bloß auf«, sagt er, als wir uns im Flughafen zum letzten Mal im Arm hielten. »Ich meine, Tamara und Igor haben es ja sicher gut gemeint, aber dieser selbst gekelterte Wein … Ich behaupte gar nicht, dass ich Kopfschmerzen habe, aber so richtig wohl ist mir nicht unbedingt.«
Ich nickte gehorsam. Obwohl es wahrscheinlich nicht am Wein lag, warum auch ich mich im Moment nicht besonders wohl in meiner Haut fühlte.
»Aber bis ich in sechs Wochen wiederkomme«, sagte Wolf, »hast du bitteschön die nettesten Kneipen ausfindig gemacht.«
»Selbstverständlich«, sagte ich und hoffte, dass ich nicht allzu kläglich klang. Mitte Oktober schien Lichtjahre entfernt. Und dass es hier irgendwo nette Kneipen geben könnte, bezweifelte Wolf sicher genauso wie ich selbst.
Dann war er hinter der braunen Holzwand verschwunden und ich musste kräftig gegen den Kloß, der mir plötzlich im Hals saß, anschlucken. Mit gesenktem Kopf drängte ich mich an den hoffnungsvoll wartenden Taxifahrern vorbei und stakste zu meinem Auto zurück. Ich hätte einiges darum gegeben, mich jetzt in die Arbeit stürzen zu können. Doch die Uni war immer noch geschlossen, das erste Dozentenmeeting erst für übermorgen angesetzt. Ich hatte endlos viel Zeit und war plötzlich verdammt allein.
Daran hat sich auch in den vergangenen zwei Monaten nicht viel geändert. Nachmittags um zwei ist die Uni wie leer gefegt; dann haben sich die Kolleginnen zu ihren diversen Privatjobs oder nach Hause zu ihren Kindern aufgemacht und beneiden mich, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Was meistens darauf hinausläuft, dass ich mich über meine Bücher oder an den PC hocke. Da nicht abzusehen ist, wann die von mir angeforderten Unterrichtsmaterialien aus Deutschland geliefert werden, müssen meine Studenten vorläufig mit selbst gebastelten Arbeitsbögen vorlieb nehmen. Das ist aufwändig, aber keineswegs tage- und abendfüllend. Und weil mir auch nicht ständig der Sinn danach steht, Vokabeln zu pauken oder Redewendungen auswendig zu lernen, bleibt immer noch reichlich Zeit, mich mit anderem zu beschäftigen. Mit einer Art Spurensuche zum Beispiel, wie sie mir, als ich mich zu Hause mit der Geschichte des alten Bessarabien zu beschäftigen begann, als ferne Vision in den Kopf kam: Denn, so denke ich, da es zu Zeiten des Habsburger Reichs und auch später, solange der nationalsozialistische Vernichtungsfeldzug noch nicht über sie hinweggegangen war, in der angrenzenden Bukowina eine große Zahl deutschsprachiger Schriftsteller gegeben hat, ist wohl auch jenseits des Prut unter den deutschstämmigen Bewohnern Schrifttum entstanden. Es mag in den Wirren der Politik untergegangen sein, aber das heißt nicht, dass es nicht vielleicht doch noch irgendwo in Archiven schlummert. Wenn ich lange genug herumlese, werde ich Hinweise erhalten, Namen ausfindig machen.
Solange das Wetter es erlaubte, verzog ich mich nachmittags zum Lesen in Parks oder in eines der wenigen Straßencafés. Mit Einbruch der Dunkelheit macht die Stadt die Schotten dicht. Der Fernsehapparat in meinem Wohnzimmer liefert drei russische Programme und ein moldawisches. Ausländische Zeitungen gibt es nirgends. Das kleine Radio, das ich mitgebracht habe, ist die einzige Quelle, aus der ich erfahren kann, was sich in der übrigen Welt tut. Leider ist der Empfang weder besonders zuverlässig noch besonders gut.
Nach zwei Wochen hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, und das dringende Bedürfnis, etwas dagegen zu tun. Kurz entschlossen kramte ich Wilhelms Telefonnummer in Odessa heraus, besorgte mir bei der ukrainischen Botschaft ein Visum, bat eine meiner Studentinnen, mir zu helfen, am Bahnhof eine Fahrkarte zu erstehen, und setzte mich für drei Tage ab. Als ich wiederkam, ging es mir besser. Das Kulturprogramm, das Wilhelm für mich vorbereitet hatte, war nur der eine Grund dafür. Das eigentlich Wichtige war, dass wir unbefangen miteinander reden konnten, ohne ein Blatt vor den Mund nehmen oder darüber nachdenken zu müssen, ob die vertrauten und gewohnten Konnotationen beim anderen auch so ankamen, wie sie gemeint waren. Wenn Wilhelm und ich nicht ohnehin bereits seit Urzeiten Freunde gewesen wären, in diesen Tagen wären wir es hundertprozentig geworden. Es ist ungeheuer beruhigend zu wissen, dass er jederzeit erreichbar ist.
Wir beschlossen, dass ich bald wiederkommen würde. Das nächste Mal im Oktober, zusammen mit Wolf. Und zwar, das stand fest für mich, mit dem Auto, denn diese unendlich langen acht Stunden Bahnfahrt für eine Strecke von gerade mal 180 Kilometern empfand ich – Lokalkolorit hin oder her – als unnötige Verschwendung kostbarer Zeit. Nicht zuletzt auch weil die Züge überfüllt und unbequem und die Fensterscheiben so schmutzig sind, dass man die Gegend, durch die man fährt, nur erahnen kann.
So schön ich Odessa gefunden hatte, so trist kam mir die moldawische Hauptstadt anschließend vor. Nun war ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen und außerdem noch vom Weltgeschehen und von allen Nachrichten abgeschnitten.
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher standen denn auch ganz oben auf meiner Wunschliste, als Wolf vor seinem Oktoberbesuch anfragte, was er mitbringen sollte. Weil es nach wie vor, auch wenn ich mich inzwischen beim Einkaufen in der Landessprache verständigen kann, wohl noch einige Zeit dauern wird, bis ich wenigstens sinngemäß erfasse, was in den örtlichen Zeitungen steht. Dass ich ohnehin bezweifle, mit ihnen mein Informationsbedürfnis decken zu können, steht auf einem anderen Blatt.
Wolf jedenfalls schleppte daraufhin brav einen ganzen Koffer voll Lesestoff an. Und diesen Schatz plündere ich nun seit drei Tagen, systematisch und so sorgfältig wie daheim kaum je zuvor. Ich muss sparen. Nachschub gibt es erst wieder, falls ich noch einmal nach Odessa fahre. Oder überhaupt erst Weihnachten zu Hause. Bis dahin aber ist jetzt gerade mal Halbzeit.
Tamara sagt: »Da hast du es. Wir Frauen hier sind bescheiden. In unserem Land braucht es nicht viel, um uns glücklich zu machen.«
Ich nicke, aber das sieht sie durchs Telefon natürlich nicht. »Vielleicht ist es ja nur ein Probelauf«, sage ich. Sie lacht. »Schon möglich.«
Als ich den Hörer aufgelegt habe, gehe ich ins Bad und drehe den Wasserhahn ganz auf. Es dauert eine Weile, aber dann ist es tatsächlich wieder da: warmes Wasser. Direkt aus der Leitung. Und das, obwohl nach wie vor nicht geheizt wird. Ich komme mir vor, als hätte ich den Nordpol entdeckt. Tamara hat Recht: Das ist Glück. So einfach also. Wenn ich zu Hause erzähle, dass ich am Abend des 31. Oktober in einer ungeheizten Wohnung sitze und glücklich bin, weil seit Monaten zum ersten Mal warmes Wasser aus der Leitung kommt, werden sie mich für verrückt halten. Aber auch das gehört wohl dazu.