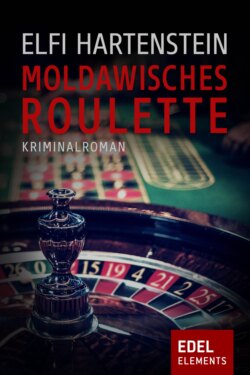Читать книгу Moldawisches Roulette - Elfi Hartenstein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEs ist kurz nach zwei Uhr nachts, als ein weißer Mercedes mit auf Standlicht gedämpften Scheinwerfern im Schatten der hohen Akazien langsam die Straße entlangfährt. Der Lichtschein der spärlich verteilten Straßenlaternen dringt nur an wenigen Stellen durch das Blattwerk bis zur Fahrbahn vor. Links und rechts überragen schwarze Häuserfronten die Baumwipfel. Nur hier und da ist noch ein Fenster beleuchtet.
Als er die Parkanlage vor der Poliklinik passiert, verlässt der weiße Mercedes sekundenlang den schützenden Baumschatten. Noch bevor er den nächsten Wohnblock erreicht, peitschen Schüsse durch die Nacht. Erst zwei, dann einer und dann noch einmal drei. Fast im selben Moment rast der Wagen mit aufheulendem Motor davon.
Die Schüsse und das Motorengeräusch haben mich hochfahren lassen. Mit klopfendem Herzen sitze ich im Dunkeln und weiß nicht, ob ich geträumt habe. Jetzt höre ich von der Straße her Stimmen. Knappe Zurufe, die ich nicht verstehe, dann das Geräusch sich rasch entfernender Schritte.
Die nun folgende Stille treibt mich ans Fenster. Die Akazienkronen wiegen sich sanft im Wind. Ihre Schatten zeichnen wirre Muster auf die Straße. Drüben, hinter der Grünanlage, sehe ich die oberste Etage der Poliklinik wie jede Nacht hell erleuchtet. Schräg links neben dem kleinen Park, im Haus mit den Polizistenwohnungen, gibt es in der vierten Etage zwei helle Fenster. Sekunden, nachdem ich sie in den Blick genommen habe, verlischt das Licht. Jetzt fällt nur noch aus dem obersten Stockwerk des Hauses rechts gegenüber ein Lichtschein.
Ein paar Minuten warte ich noch, dann gehe ich wieder ins Bett. Ein Blick auf den Wecker sagt mir, dass ich das vor genau einer Stunde schon einmal getan habe.
Im weiteren Verlauf der Nacht müssen sich in meinem Hals Reibeisen gebildet haben. Der Nachgeschmack der Lutschtablette treibt mir Tränen in die Augen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Da ich den Patientenstatus ablehne, gehe ich in die Küche, gieße Kognak in ein Wasserglas, nehme auch noch Zigaretten und Aschenbecher vom Küchentisch und packe mich damit wieder ins Bett. Während ich die Decke über mir glatt streiche und mich zurechtkuschele, dringt wie aus weiter Ferne der Knall mehrerer Schüsse wieder in mein Bewusstsein. Erst zwei, dann einer und dann noch einmal drei. Dann heult ein Motor auf, jemand ruft etwas, Schritte hämmern über das Pflaster. Jetzt sehe ich mich wieder am Fenster stehen und im Nachtdunkel über die Akazien hinweg auf die andere Straßenseite starren. Die erleuchteten Fenster schräg gegenüber, die gleich darauf in undurchdringlichem Schwarz versinken, und im Haus rechts von der Grünanlage hoch oben im letzten Stockwerk die Lichter. Ich weiß, dass es kein Traum war, aber wahrscheinlich werde ich nie erfahren, was geschehen ist. Keine Zeitung wird davon berichten. Niemand außer mir wird etwas wahrgenommen haben, und falls doch, wird jedenfalls niemand ein Wort darüber verlauten lassen.
Ein seltsames Gefühl. So, als säße man in einer dunklen Holzkiste, an der die Menschen vorbeilaufen, während man selbst von innen nur durch die Ritzen zwischen den Latten und ab und an durch ein Astloch unzusammenhängende, schnell wechselnde Teilausschnitte wahrnimmt und, da man sich nicht bemerkbar machen kann, auch nicht die geringste Chance hat, einen der Vorbeieilenden anzuhalten und nach der Bedeutung einzelner Bewegungen zu fragen. Ohnmacht.
Ich wühle mich in den Kissen zurecht, nippe an meinem Kognak und zünde mir eine Zigarette an. Ich könnte es mir jetzt gemütlich machen. Es ist Dienstag. Zehn Uhr morgens. Weil die Studenten heute ihren Tag feiern, habe ich frei. Bei dem Gedanken hebt sich meine Laune allmählich. Wie immer, wenn ich mich aus einem geregelten Tagesablauf ausklinken und alles auf den Kopf stellen kann. Bei Gleichförmigkeit gehe ich ein.
Tage, die es mir gestatten, in Ruhe in Gang zu kommen, sind mir die liebsten. Sie dürfen dann gern etwas länger dauern. Ich habe nichts dagegen, auch mitternachts noch über meinen Büchern zu sitzen, nur wenn ich mich morgens schon ins Getümmel stürzen soll, bin ich ungenießbar. Freiwillig kann ich es tun, aber sobald man es mir abfordert, entwickele ich die seltsamsten Verweigerungsstrategien, die mich manchmal selbst ein wenig erstaunen.
Draußen vor dem Fenster hängt ein grauer Oktoberhimmel. Die Bäume an der Straße haben begonnen, ihr Laub abzuwerfen. In Kürze werden sie kahl sein. Seit einer Woche ist es kalt geworden. Als hätte jemand über Nacht die Temperatur um drei Stufen heruntergestellt, hatte die Sonne von einem Tag auf den anderen alle Kraft verloren. Sie lässt sich nur noch stundenweise sehen. Dass sie sich heute ganz versteckt, ist wie ein Omen. Ich werde es ihr gleichtun. Mit dem Bücherstapel neben dem Bett kann ich eine ganze Menge grauer Tage überstehen.
Dass ich unfähig bin, mich auf Dauer einem bestimmten Rhythmus anzuvertrauen, ist einer der Gründe, warum Wolf und ich immer noch nicht zusammenleben. Es würde nicht gut gehen. Ich springe, er ruht. Weil aber auch er zwischendurch ziemlich weit springen kann und ich immer wieder Ruhephasen brauche, treffen wir uns nicht nur zum Abendessen oder um ins Kino zu gehen. Dann dauert es drei oder vier Wochen, bis unweigerlich der Punkt erreicht ist, an dem jeder wieder nach der eigenen Gangart sucht. Und nach etwas Abstand – wenn auch nicht unbedingt in der Größenordnung, wie wir sie im Moment praktizieren. Als Wolf sich vor drei Tagen nach Hause aufmachte und ich ihn zum Flughafen brachte, hatte ich das deutlich vor Augen. Zweitausend Kilometer sind, auch wenn sie sich in zwei Flugstunden bewältigen lassen, ziemlich weit für eine Liebe.
Noch weiter scheint die Entfernung zu werden, sobald sie sich nach Osten erstreckt. Ich schwöre, wenn ich in Madrid oder Lissabon wäre, würde ich mich ihm um einiges näher fühlen. Ferne oder Nähe berechnen sich offensichtlich weniger nach Kilometern oder Luftmeilen als danach, ob man sich auf die gewohnten Zeichensysteme des Alltags verlassen kann.