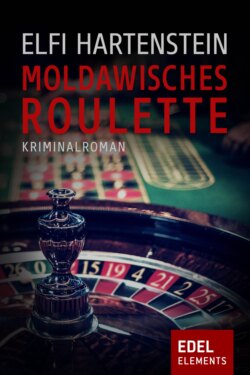Читать книгу Moldawisches Roulette - Elfi Hartenstein - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеNach dem Vormittagsunterricht fahre ich direkt nach Hause. Mir ist kalt. Sechs Stunden in ungeheizten Räumen zehren die körpereigenen Wärmereserven ziemlich auf. Als ich die Tür aufschließe, höre ich, dass das Telefon klingelt. Es hört auf, ehe ich die Wohnung richtig betreten habe. Ich stelle die Büchertasche ab und fummele an meinen Schuhbändern, um schnell in die Hausschuhe zu schlüpfen.
Die Zeiten, da ich mich darüber mokiert habe, dass jeder, der eine Wohnung betritt, sich umgehend seiner Schuhe entledigt, sind lange vorbei. Damals war Sommer, und ich wusste nicht, warum ich meine Sandalen abstreifen und barfuß in einer fremden Wohnung herumsitzen sollte. Schließlich waren wir nicht in Japan. Die freundlichen Angebote, mir Hausschuhe zur Verfügung zu stellen, lehnte ich ab; so sehr zu Hause fühlen wollte ich mich gar nicht. Erst als es im Herbst ab und zu regnete, begann ich zu verstehen, weil ich erlebte, wie sich selbst Teerstraßen innerhalb weniger Minuten in schwer passierbare Morastfelder verwandeln, wenn die Gullis im Handumdrehen voll sind und die unglaublichen, sonst kaum wahrnehmbaren Mengen von Staub umgehend zu Schlamm werden. Mit Straßenschuhen, die durch solchen Schmutz gelaufen sind, kann man einfach nicht auf einen Teppich treten. Also ziehe auch ich mir jetzt, wenn ich heimkomme oder jemanden besuche, als Erstes die Schuhe aus. Überhaupt habe ich noch nie so viel an meinen Schuhen herumgeputzt wie hier. Ich halte sie unter den Wasserhahn und wasche sie. Es geht nicht anders.
Als ich mich aus meinem Mantel geschält habe, klingelt erneut das Telefon.
»Pia?«
Rudi Pacher. Er klingt enttäuscht. Den halben Tag hat er versucht, in Cricova jemanden zu erreichen, der ihm eine Besuchserlaubnis ausstellen kann.
»Es ist unglaublich. Niemand fühlt sich zuständig. Und dass ich von der Presse bin, beeindruckt auch keinen.«
»Haben Sie jemanden erwischt, der Englisch oder Französisch spricht?«
»Schon. Aber die Verständigung war trotzdem eher holprig.«
»Und jetzt?«
»Jetzt müsste ich in Wien anrufen und Bescheid sagen, dass ich wohl nicht übermorgen zurückkomme. Aber hier im Hotel kann man mich offensichtlich nicht vermitteln.«
Eigentlich wollte ich den Rest des Nachmittags in aller Ruhe Zeitung lesen. Und mir später überlegen, mit welchen Referatsthemen ich meinen Literaturkurs erfreuen kann.
»Sie müssten eine Flasche Wein besorgen und sich in ein Taxi setzen«, sage ich. »Mein Telefon funktioniert im Allgemeinen.«
Zwanzig Minuten später steht er vor der Tür. In der Hand hält er artig eine Plastiktüte mit zwei Flaschen Rotwein.
Sein Lächeln ist heute eine Spur weniger strahlend als gestern.
»Kaputt?«
»Eher frustriert.«
Er hängt den Mantel an den Haken und schaut sich um. »Hübsch hier.«
»Kommen Sie«, sage ich, »das Telefon steht da drüben auf dem Tisch.«
»Ehrlich gesagt, würde ich lieber erst den Wein aufmachen.«
Ich hole Gläser und Korkenzieher aus der Küche. Während er sich eine der Flaschen vornimmt, greife ich nach dem Telefon.
»Mal sehen, ob ich mehr Glück habe als Sie.«
Rusnacs Visitenkarte habe ich bereitgelegt.
Es dauert etwas, bis am anderen Ende abgehoben wird. Eine Frauenstimme erklärt mir, der Chef sei diese Woche leider nicht zu erreichen.
Ich lege auf und wähle seine Privatnummer. Niemand meldet sich.
Pacher hat die Gläser vollgeschenkt.
»Wenn ich das richtig sehe, bin ich offenbar nicht der Einzige, der abblitzt.« Wir stoßen an. »Mmm …«, sein Gesicht hellt sich auf. »Was für ein Wein.« Er nimmt noch einen Schluck.
»Gut ist der. Köstlich, wirklich. Schmeckt nach … nach …«
»Isabella.«
»Wie bitte?«
»Die Traube heißt Isabella. Erinnert im Nachgeschmack etwas an Walderdbeeren.«
»Genau. Woher wissen Sie das alles?«
»Ich habe ab und zu mit Einheimischen zu tun.«
Er wirft einen Blick auf Rusnacs Visitenkarte. »Offensichtlich auch mit den etwas größeren Tieren.«
Das bringt mich auf eine Idee.
»Es gibt noch eine andere Möglichkeit«, sage ich.
Doncilas Nummer weiß ich auswendig. Er ist da. Wir vereinbaren, dass er spätestens bis morgen Nachmittag um fünf den Sesam-öffne-dich-Brief an der Pforte für mich hinterlegt hat.
Pacher strahlt mich an. »Wer war das?«
»Stefan Doncila. Staatssekretär im Bildungsministerium. Ein sehr netter Mensch. Hilft, wo er kann.«
»Das heißt …«
»Wir können übermorgen nach Cricova fahren. Zufällig wusste er, dass für drei Uhr eine Gruppe Amerikaner angemeldet ist. Er wird dafür sorgen, dass wir uns denen anschließen dürfen.«
»Wunderbar. Sie sind ein Engel.«
»Sagen wir, Doncila ist ein Engel.«
Er grinst. »Wenn Sie meinen.« Jetzt ist er wieder obenauf. »Ich frage mich bloß, was ein Staatssekretär im Bildungsministerium mit diesem Vorzeige-Weinkeller zu tun hat?«
Vielleicht glaubt er mir nicht, aber ich weiß es auch nicht. Nur, dass irgendwie alles miteinander verflochten ist und dass Stefan Doncila zu den Leuten gehört, die man um Rat fragen kann, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß.
»Dann muss ich jetzt nur noch in Wien anrufen und meine Leute wissen lassen, dass ich erst am Samstag zurückkomme.« Er hält den Hörer schon in der Hand.
»Nein.«
»Wieso nein?«
»Dienstag.«
»Dienstag erst? Warum?«
»Darum.«
Sollte ich mich getäuscht haben, als ich ihn für einen guten Pfadfinder hielt?
Er runzelt die Stirn, sieht mich zweifelnd an. Dann begreift er. »Mein Gott, ja … Hätte ich fast vergessen. Es gibt ja bloß zweimal die Woche eine Maschine nach Wien.« Er schluckt. Dann lächelt er mich tapfer an. »Das nennt man dann wohl höhere Gewalt, oder? Darauf sollten wir trinken.«