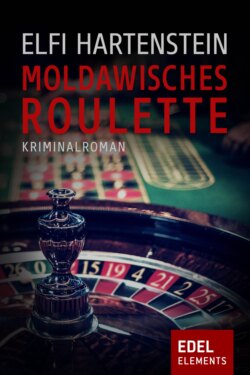Читать книгу Moldawisches Roulette - Elfi Hartenstein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеIch habe Wörter im Lexikon nachgeschlagen und mir mithilfe meines Grammatiklehrbuchs zwei Sätze zurechtgelegt. Um den Deckel der schwarzen Kiste zu lüften, in die ich noch immer eingeschlossen bin. Zwar kann ich mich mit den Kolleginnen am Lehrstuhl auf Deutsch oder Englisch verständigen, aber schon dort komme ich mir, sobald sie untereinander Russisch oder Moldauisch sprechen, ziemlich überflüssig vor. Ausgeschlossen. Oder vielmehr eingeschlossen – in diese schwarze Kiste eben. Um am Leben außerhalb der Universität teilnehmen zu können, muss ich lernen, lernen, lernen.
Dass ich Fehler mache und meine Aussprache längst noch nicht korrekt ist, hält mich nicht ab, wenn ich ins Gespräch kommen will. Da ich genau zuhören kann, kann ich inzwischen schon ab und zu analysieren, wie andere ihre Sätze bauen, deren Einzelbestandteile ich mir, den Klang noch im Ohr, einverleibe, um sie später an anderer Stelle wieder in neuen Zusammenhängen zu reproduzieren. Learning by doing, erkläre ich den Studenten in meinen Kursen, und indem sie mich verbessern und mir Ausspracheregelungen und grammatische Konstruktionen erschließen und meine Fortschritte beobachten, verlieren sie die Scheu vor den eigenen Fehlern, die sie noch machen, wenn sie Deutsch sprechen.
Anfangs hat es sie überrascht, dass ich mich bemühe, ihre Sprache zu erlernen. Was wiederum mich erstaunte, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand versuchen wollte, in einem Land zu leben, ohne zu verstehen, was um ihn herum gesprochen wird. Später habe ich begriffen, dass ihre Überraschung sich darauf bezog, dass ich Rumänisch lerne und nicht Russisch. Die meisten Ausländer, die sich für längere Zeit hierher verirren, versuchen lieber, sich mit Russisch durchzuschlagen. Ich kann mir das nur so erklären: Entweder – aber das glaube ich eigentlich nicht – machen sie sich keine Gedanken darüber, was in diesem Land angesagt ist, oder aber sie wissen nur zu genau, wer hier auch in Zukunft das Sagen hat.
»Komm mit ins Zentrum«, hatte Nadja mich am Tag vor Semesterbeginn in ihrem komischen Englisch aufgefordert, »da ist heute die Hölle los.« Die Hölle stelle ich mir zwar anders vor, aber dieses Volksfest, das sich da auf dem Bulvar Stefan cel Mare und dem Platz zwischen dem Ministeriengebäude und dem kleinen Triumphbogen abspielte, war auch ganz nett. Alles tanzte bunt durcheinander, Musikkapellen spielten, Gruppen fröhlicher Menschen zogen untergehakt und laut singend die Straße entlang; Berge von Blumensträußen zierten das Monument des großen Moldaufürsten, vor dem sich das Volk um einen hoch dekorierten Redner scharte, dessen lautsprecherverstärkte Stimme über das bunte Treiben hinwegdröhnte. »Heute Abend kann man ihn sich im Fernsehen noch einmal anhören«, sagte Nadja mit Blick zu den auf ihn gerichteten Kameras, »lass uns jetzt rübergehen zum Dom.« Wir schlängelten uns am Triumphbogen vorbei in die Rasenanlagen zu den heute dort aufgestellten Verkaufstischen, was in der Menge der tanzenden und singenden Menschen nicht ganz einfach war. Ich wusste nicht recht, wie mir geschah und was ich davon zu halten hatte, war ja noch keine zwei Wochen im Lande und noch nicht so weit akklimatisiert, dass ich mich einfach irgendwo mit einhängen und mithüpfen mochte, und dass der 31. August seit 1989 Nationalfeiertag ist, hatte ich überhaupt gerade eben erst gelernt. »Ja«, sagte Nadja stolz, »das war eine echte Revolution damals. Stell dir mal vor, wir haben schon zwei Jahre vor der Unabhängigkeit unsere eigene Sprache wieder zur Staatssprache deklariert und eine Alphabetisierungskampagne in den Schulen gestartet.«
»Eine Alphabetisierungskampagne? Wozu das denn?«
»Na – für das lateinische Alphabet. Wurde doch vorher alles in Kyrillisch geschrieben.«
»Rumänisch in kyrillischer Schrift?«
»Genau. Unsere offizielle Sprache war eben Russisch. Lateinische Schrift war verboten.«
Mein Staunen quittierte sie nur mit einem Schulterzucken. Rumms – der Knall, mit dem der Deckel der schwarzen Kiste sich wieder einmal über mir schloss, ließ mich zusammenzucken. Unsicher sah ich Nadja an, aber sie schien nichts davon wahrgenommen zu haben. Seelenruhig begutachtete sie handgehäkelte Spitzendeckchen, die vor uns zum Verkauf angeboten wurden. Und jetzt wusste ich endgültig, dass es mich einiges mehr an Anstrengung kosten würde, als bloß Vokabeln und Grammatik zu pauken, um mir dieses neue Umfeld zu erschließen.
Ich klingele bei der Nachbarin aus der Wohnung links neben meiner. Sie ist die Einzige auf der Etage, die ich fragen kann. Die anderen Nachbarn, die in den beiden Wohnungen rechts von mir wohnen, sprechen nur Russisch, und deshalb beschränken wir uns auf Grüße und Lächeln, wenn wir uns im Lift oder im Flur begegnen. Ich höre sie von innen an die Tür kommen und fragen, wer da ist. Erst als sie meine Stimme erkennt, öffnet sie zögernd. Obwohl es heller Nachmittag ist, trägt sie einen bunt gemusterten Schlafrock, den sie über der Brust zusammenhält, und an den Füßen dicke Wollsocken und Filzpantoffeln. Doch ich sehe sofort, dass ihr Haar gekämmt ist und sie Lippen und Augen geschminkt hat, und weiß also, dass ich sie nicht aus dem Schlaf geholt habe. Ich habe keine Ahnung, was sie von Beruf ist und wo sie arbeitet, aber ich habe bemerkt, dass sie häufig nachmittags zu Hause ist, und zu Hause, so viel habe ich schon im Umgang mit meinen Kolleginnen gelernt, trägt hier niemand die Kleidung, mit der man sich in der Öffentlichkeit zeigt.
Sie lächelt mich vorsichtig an.
Ob sie auch diese nächtlichen Schüsse gehört hat, frage ich. »Schüsse? Nein.« Ihr Gesicht zeigt keine Regung. »Nichts gehört. Wirklich Schüsse?«
»Ja«, sage ich, »mehrere Schüsse, und dann Stimmen, und dann ist ein Auto weggefahren.«
Sie hebt bedauernd die Schultern. »Tut mir Leid«, sagt sie, »aber ich schlafe nach hinten raus. Und vielleicht haben Sie sich ja getäuscht.« Sie spricht langsam und sehr deutlich, und ich bin ihr dankbar dafür, denn das ermöglicht mir, auch die Satzkonstruktion nachzuvollziehen.
»Ich glaube nicht«, sage ich und weiß doch, dass es zwecklos ist.
»Ein Traum«, sagt sie, »ein Albtraum vielleicht.« Coşmar. Ein Wort, das ich begreife, obwohl es mir bisher noch nicht untergekommen ist.
»Coşmar?«, frage ich zweifelnd.
»Wahrscheinlich.« Sie verzieht den Mund zu einem kleinen Lächeln. »Aber fragen Sie doch einmal Valera, ob der vielleicht was gehört hat.«
Valera ist der Nachbar rechts von mir.
»Unmöglich«, sage ich. »Ich meine, ich kann mich nicht mit ihm verständigen.«
»Ach so, ja.« Jetzt kommt sie auf den Flur heraus und geht resolut auf Valeras Tür zu. Sie klingelt zweimal, dreimal, doch niemand öffnet.
»Nicht zu Hause«, sagt sie. »Dann ein anderes Mal.« Und, wie um mich zu beruhigen: »Man hört hier öfter mal Schüsse. Es hat nichts zu bedeuten.« Sie nickt mir noch einmal zu, bevor sie wieder in ihrer Wohnung verschwindet. Ich höre, wie sie den Schlüssel zweimal im Schloss herumdreht.