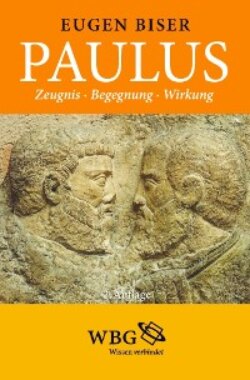Читать книгу Paulus - Eugen Biser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Vorzeit
ОглавлениеDie rätselhafteste Gestalt des Neuen Testaments ist zweifellos der Lieblingsjünger des Johannesevangeliums. Nachdem sich der Versuch seiner Identifizierung mit einer historischen Figur in gewagteste Spekulationen verlor, setzte sich langsam die Einsicht durch, dass es sich bei ihm nur um eine Idealfigur nach Art der Geniusgestalten der klassischen und romantischen Dichtung handeln könne, konkret gesprochen, um eine figurale Leseanweisung11. Einer der entschiedensten Vertreter dieser Ansicht, Rudolf Bultmann, gab freilich zu bedenken, dass doch bei aller Unmöglichkeit dieser Annahme viel für eine Gleichsetzung mit Paulus spreche12. Das kommt einem wichtigen Fingerzeig beim Versuch einer Aufhellung seiner Vorgeschichte gleich. Denn er bringt dabei ein über die bisherigen Erklärungsversuche, die vor allem an Ressentiment dachten (Guardini), hinausgehendes und ungleich aufschlussreicheres Motiv ins Spiel: Liebe. Und er schlägt damit die Brücke zu dem in dieser Hinsicht bisher kaum berücksichtigten Liebeshymnus des ersten Korintherbriefs (1Kor 13, 1–13). Mit Recht rühmte Johannes Weiß die „Schönheit des Stückes“, die in seinen „rhetorischen Figuren, im Aufbau und im Rhythmus des Ganzen“ liege, während Ernst Hoffmann darin „tiefstes religiöses Leben“ nach Worten suchen sah und Paulus deshalb den Vorzug zusprach, „als einzige literarische Persönlichkeit der Mittler zwischen ‘christlicher Religion’ und der ‘Religion Christi’ zu sein“13. Auf die Frage, ob dem Hymnus Hinweise auf die innere Anbahnung der Lebenswende des Paulus zu entnehmen seien, scheint aber noch niemand verfallen zu sein, obwohl Gerd Lüdemann im Blick auf den von ihm vermuteten „jüdischen Hintergrund“ ausdrücklich von seiner Herkunft „aus der vorchristlichen Zeit des Apostels“ sprach14. Doch auf diese Frage antwortet er selbst beredt genug, wenn man den Hymnus nur auf seine vermutliche Urform vor seiner Einpassung in den Briefkontext zurücknimmt:
Wenn ich mit Menschen- und Engelzungen rede, aber die Liebe nicht habe, bin ich ein tönendes Erz oder eine lärmende Klingel. Wenn ich die Prophetengabe und Kenntnis aller Geheimnisse, ja selbst einen Berge versetzenden Glauben besitze, nicht aber die Liebe, bin ich ein Nichts. Und wenn ich meine ganze Habe als Almosen und meinen Leib zum Verbrennen hingebe, aber die Liebe nicht habe, nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, gütig, sie neidet nicht, sie prahlt nicht, ist nicht dünkelhaft, verletzt nicht, ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht erbittern, ist nicht nachtragend, nicht erfreut über das Unrecht, aber voll Freude über die Wahrheit, sie übergeht alles, glaubt alles, hofft alles, erträgt alles. Die Liebe ist end- und grenzenlos. Weissagungen – sie vergehen, Sprachen – sie verstummen, Erkenntnisse – sie verblassen, denn Stückwerk ist unser Wissen und Weissagen. Wenn aber das Vollkommene eintritt, hört das Stückwerk auf. Solange ich ein Kind war, redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind; seitdem ich aber zum Mann geworden bin, habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir verschleiert, wie im Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich bruchstückhaft, dann aber so, wie ich erkannt bin (1Kor 13, 1–12).
Wenn man den Hymnus so auf sich wirken lässt, sprechen tatsächlich eindeutige Symptome für diese „vorgängige“ Herkunft, wenn auch nicht im Sinn einer Übernahme aus vorgegebenen Traditionen, wohl aber einer dichterischen Spitzenleistung des „vorpaulinischen“, also noch in seiner jüdischen Denkwelt befangenen Paulus. „Nicht zufällig“ redet der zweite Abschnitt des Lobpreises (13, 4–7), wie Günther Bornkamm hervorhob, „in schneidenden Antithesen“ und nicht weniger als „acht negativen Satzgliedern“ von der Liebe und zudem von ihr in einer „mehr als nur poetischen Stilform“, in der sie als das „Subjekt des Handelns“, ja geradezu als eine „göttliche Macht“ erscheint15. Dabei lässt die Häufung der Negationen – die Liebe „neidet nicht, überhebt sich nicht, handelt nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, trägt das Böse nicht nach, freut sich nicht über das Unrecht“ – darauf schließen, dass der Hymnus eher aus der Perspektive eines Entbehrenden und sich nach Liebe Sehnenden als aus der eines Liebenden verfasst ist, zumal sie der Verfasser wie eine selbständig agierende Entität, ja wie eine „göttliche Macht“ umkreist. Gerade darauf liegt nun aber der Hauptakzent der Argumentation. Denn für den „zum Herrn gewendeten“ Paulus (2Kor 3, 16) ist eine Rede von der Liebe ohne Rückbezug auf den, in dem sie für ihn (nach Röm 8, 39) leibhaftig Gestalt annahm, unvollziehbar. In seiner Damaskusvision wurde ihm das Geheimnis des Gottessohnes nicht nur durch einen göttlichen Liebeserweis enthüllt (Gal 1, 16); vielmehr war der ihm ins Herz Gesprochene für ihn zugleich der Inbegriff der Liebe. Der Motivation des Offenbarungsaktes entsprach auch dessen Sinn und Inhalt. Liebe war für ihn fortan nur in der Identität mit Jesus denkbar. Denn sein Lebensinhalt bestand (nach Gal 2, 20) für ihn in dem, der ihn geliebt und sich ihm hingegeben hatte.
Die distanzierte Sprechweise, wie sie im Hymnus auf die nach Art einer Idealgestalt gedachte Liebe vorliegt, gehört somit eindeutig einer „vorpaulinischen“ Lebenszeit des Verfassers an. Wenn Albrecht Oepke damit Recht behält, dass der „etwa Zwanzigjährige den Umschwung“ erlebte, der seinem Leben die neue und definitive Richtung verlieh, muss die Abfassung des Hymnus somit in den vorangehenden Lebensjahren erfolgt sein16. Eine Bestätigung dessen ist der Wendung zu entnehmen:
Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, urteilte ich wie ein Kind. Als ich aber zum Mann geworden war, legte ich ab, was kindlich war (1Kor 13, 11).
Was hier als ein bereits vollzogener Übergang beschrieben wird, erscheint in einer auf das Damaskuserlebnis vorausweisenden Aussage im Aspekt des Vollzugs:
Ich bilde mir nicht ein, es schon ergriffen zu haben. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt (Phil 3, 13).
Durch diese aus der Rückschau gesprochene Aussage gewinnt die erste noch mehr an Profil. Dann entstammt sie nach den Lehren der Psychologie des Jugendalters eindeutig dem Schwellenbewusstsein des Jugendlichen, der sich von der gerade erst überschrittenen Kindheit abgrenzt und im Interesse dieser Selbstunterscheidung auf das Kindesalter zurückblickt17.
Wenn man mit Albrecht Oepke und Eduard Spranger davon ausgeht, dass sich Bekehrungserlebnisse in der Regel zu Beginn des dritten Lebensjahrzehnts ereignen, und gleichzeitig mit der Forschung annimmt, dass das Damaskuserlebnis, das den zelotischen Verfolger in den glühenden Verteidiger und Propagandisten der christlichen Sache verwandelte, wenig später als ein Jahr nach Tod und Auferstehung Jesu anzusetzen ist, muss sich seine Lebenswende zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr, wenn nicht gar schon zuvor angebahnt haben. Wenn der Liebeshymnus Auskunft über die Verfassung seines Dichters und der von ihm überschrittenen Schwelle gibt, tritt die Vorzeit Pauli in ein neues und bisher kaum beachtetes Licht. Dann stand am Anfang der von Paulus vollzogenen Wandlung ein sich nach Liebe Sehnender, der seinem Verlangen in diesem Hymnus Ausdruck verlieh, und erst an deren Ende der Fanatiker, dessen Aggressivität dem Neid auf die Christengemeinde entstammte, die ihrem Selbstverständnis zufolge bereits im Vollbesitz dessen lebte, worum sich der nach Gesetzesgerechtigkeit Strebende vergeblich bemühte. Dann hätte diese Lebenswende auch nicht, wie meist unterstellt wird, die Signatur einer sich abrupt vollziehenden Metamorphose, durch die sich der fanatische Verfolger schlagartig in sein Gegenteil verwandelte. Vielmehr war sein wütender Vernichtungswille (Apg 9, 1;Gal 1, 13) in erster Linie ressentimenthaft veranlasst, und in der Christengemeinde hasste er dann nicht so sehr diejenigen, die von den „väterlichen Überlieferungen“ abwichen, als vielmehr das, was jene zu besitzen schienen, ihm aber trotz seines Gesetzeseifers fehlte (Phil 3, 6).
Umgekehrt tritt dann aber auch das gemeinhin als „Bekehrung“ eingeschätzte Damaskuserlebnis in einen neuen Aspekt. Es hätte dann nicht den Charakter eines alles Bisherige umstürzenden Einbruchs, sondern den der großen Liebeserfahrung, nach der sich Paulus zuvor ebenso glühend wie vergeblich sehnte, und darum den der erfüllenden Antwort auf seine Existenz- und Sinnfrage. So wurde es aber auch von Paulus selbst begriffen, als er in seinem Urzeugnis davon sprach, dass ihm das Geheimnis des Gottessohnes ins Herz gesprochen worden sei (Gal 1, 16) und dass er ebenso seinen Lebensinhalt (Phil 1, 21) wie seine wahre Identität erlangt habe (Gal 2, 20). Dass sich dieses Selbstzeugnis Pauli nicht oder doch nur partiell durchsetzen konnte, hängt zweifellos mit dem suggestiven Übergewicht der lukanischen Darstellung zusammen, die diesen Eindruck nicht nur ihrer narrativen Entfaltung und bildhaften Dramatik, sondern ebenso ihrer dreifachen Wiederholung verdankt und diese zudem an das Martyrium des Stephanus zurückbindet, sodass Paulus in ihrer Sicht tatsächlich als der durch göttliche Intervention verwandelte Verfolger erscheint. Doch was hat es mit dieser Verfolgertätigkeit tatsächlich auf sich?