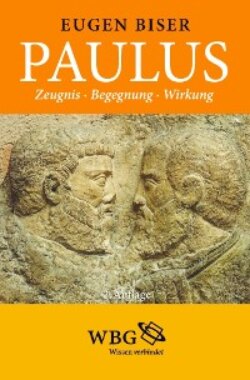Читать книгу Paulus - Eugen Biser - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Die Initiation Der Zugang
ОглавлениеPaulus ist der Glücksfall des Christentums. Denn er führte es aus der Verhaftung in der Gesetzesreligion in die Freiheit. Er brach damit gleichzeitig den Bann der Weltangst, dem die Spätantike zunehmend verfiel. So führte er es in räumlicher wie geistiger Hinsicht in die Dimension einer Weltreligion. Und er vollbrachte das, ohne mit seiner jüdischen Herkunft zu brechen und die Welt, wie es der Gnosis nahe lag, zu dämonisieren. Er erreichte das aber auch, ohne die griffbereiten Mittel pseudoreligiöser Praktiken, wie sie Simon Magus zu nutzen wusste (Apg 8, 9ff.), in Anspruch zu nehmen, begünstigt lediglich durch die Infrastruktur des Römischen Reiches und gestützt auf die beispiellose Hingabe an seine Sache und die vom „Beweis des Geistes und der Kraft“ (1Kor 2, 4) begleitete Überzeugungskraft seines Wortes.
Bei der Lektüre seiner Briefe stehen diesem Ersteindruck freilich eine ganze Reihe sperriger, ja gegensinniger Stellen entgegen, die ihm, kaum dass er aufkam, zu verwischen drohen. Und dem Zeugnis der Briefe steht zudem der Bericht der Apostelgeschichte entgegen, der jenem bei allen wichtigen Zusatzinformationen doch in entscheidenden Punkten widerspricht und zudem darauf schließen lässt, dass er schwerlich in Kenntnis des paulinischen Briefwerks abgefasst wurde. Denn dieser aus der Rückschau verfasste Bericht stellt Paulus zwar als den großen, von Gott berufenen Heidenmissionar heraus; doch verweigert er ihm den Rang eines Apostels im Vollsinn des Ausdrucks. Auch lässt er Paulus dreimal von dem visionären Erlebnis berichten, das seine große Lebenswende herbeiführte. Doch deutet er in keiner dieser Versionen an, dass es sich dabei um eine Schau des Auferstandenen und eine für die Christenheit grundlegende Ostervision handelte. Doch auch im paulinischen Briefwerk selbst fügen sich die Aussagen keineswegs bruchlos zu einem Ganzen. Vielmehr gilt hier, wie schon Gregor von Nazianz beobachtete:
Die einen bezeichnet er als seine Freude und Krone, den andern wirft er Unverstand vor. Mit denen, die den geraden Weg gehen, geht er einträchtig zusammen; die andern, die den bösen Weg einschlagen, hält er zurück. Bald verfügt er den Ausschluss aus der Gemeinde, bald lässt er Milde walten. Das eine Mal trauert er, dann wieder freut er sich. Im einen Fall gibt er Milch zu trinken, im andern teilt er Geheimnisse mit. Zu den einem lässt er sich herab, die andern zieht er zu sich empor. Bald droht er mit dem Stock, bald gibt er sich sanftmütig. Mit den Hohen erhebt er sich, mit den Demütigen erniedrigt er sich. Einmal bezeichnet er sich als den letzten Apostel, das andere Mal beruft er sich auf Christus, der durch ihn redet1.
Über die Jahrhunderte hinweg stimmt dem Albert Schweitzer mit der Charakteristik zu:
Bald ist der Apostel radikal, bald konservativ, bald tapfer, bald verzagt; in kleinen Dingen fest, in großen schwächlich nachgebend, einmal heftig, dann wieder mild; in allem voller Unklarheit und Widerspruch2.
Ungleich gravierender sind jedoch die gegenstrebigen und widersprüchlichen Stellen, die nur zum kleineren Teil situativ, also aus den unterschiedlichen Anlässen der jeweiligen Entstehung erklärt werden können. So steht dem aus der Naherwartung des Apostels entworfenen Bild vom Weltende mit der Wiederkunft Christi zum Gericht sein evolutionäres Geschichtsbild entgegen, das den Weltengang durch Leiden und Kämpfe dem Ziel der universalen Gotteskindschaft entgegenstreben sieht (Röm 8, 16–21). Ebenso widerspricht er seinem viel zitierten Bildwort vom Tod als dem „Sold der Sünde“ mit dem emphatischen Ausruf, mit dem er den Tod zum Antreiber des Bösen erklärt (1Kor 15, 56). Noch tiefer greifen die Divergenzen, die sich auf das Verständnis Jesu und seines Todes beziehen. Ist Jesus das Vorbild, das es nachzuahmen (1Kor 11, 1) und gesinnungshaft nachzuvollziehen gilt (Phil 2, 5), oder nicht vielmehr der dem Glaubenden einwohnende Inbegriff der mystischen Lebensgemeinschaft mit ihm? Und sind die mit ihm Geeinten dadurch so sehr geheiligt, dass sich an ihnen nichts Verwerfliches mehr findet (Röm 8, 1), oder bedürfen sie doch noch einer rechtfertigenden Intervention, wenn sie gerettet werden sollen (Röm 3, 24ff.)? Was aber Jesu Tod anlangt: Ist dieser, wie Paulus im Galater- und Römerbrief versichert (Gal 3, 13; Röm 3, 24), ein Sühne- und Opfertod oder aber, wie aus andern und nicht weniger aussagestarken Stellen hervorgeht (Röm 8, 39), der Exzess der in Christus erschienenen und von ihm gelebten Liebe Gottes?
Aus diesem Stimmengewirr führt nur ein Lösungsweg heraus. Es gilt, aus ihm den Vorschlag des Apostels herauszuhören und jene Stelle ausfindig zu machen, die Aufschluss über seinen denkerischen Ansatz, das Zentrum seiner Konzeption und sein Selbstverständnis gibt. Im Grunde durchzieht die Suche danach die gesamte Forschungsgeschichte, auch wenn sie sich nur an wenigen Beispielen ausdrücklich hervorheben und festmachen lässt. So erhob nach dem Kirchenhistoriker Erich Seeberg „Mani, der Mann, der sein Leben nach dem Bild des Paulus gestaltet hat“, dessen Grundsatz, „allen alles“ zu werden (1Kor 9, 22), zum Programm seiner gesamten Missionstätigkeit, bei der er sich den Persern als Perser, den Juden dagegen als Jude erwies3. Das überragende Paradigma dieser Suche ist jedoch Martin Luther, dem nach qualvollem Ringen bei der Lektüre des Wortes „der Gerechte lebt aus dem Glauben“ (Röm 1, 17) die Tore des Paradieses aufzuspringen schienen und der unter diesem Eindruck in der paulinischen Rechtfertigungslehre die „Lehre aller Lehren“ (Ebeling) und damit die Mitte der paulinischen Botschaft gefunden zu haben glaubte4. Es war allerdings, wie Albert Schweitzer im Licht seines mystischen Paulusverständnisses erkannte, der Fund in einem „Nebenkrater“ der paulinischen Heilslehre, der zur weiteren Fortsetzung der Suche auffordert5.
Schweitzers Kritik wies aber auch schon in die Richtung, auf welche die Kraftlinien im Strahlungsfeld des Apostels hinauslaufen. Sie konvergieren schließlich im leidenschaftlichsten aller Paulusbriefe, dem Galaterbrief, den Paulus in der Erbitterung über die gegen ihn und seine Gründungen gerichteten Angriffe verfasste6. Die Wucht dieser Attacke nötigte ihn, sein Innerstes offen zu legen, weil er sich ihrer, bei aller Polemik, letztlich nur so zu erwehren vermochte. In Worten, die bewusst an Wendungen des Propheten Jeremia angelehnt sind, blickt er zunächst auf seine Verfolgertätigkeit zurück, um dann in jähem Umschwung auf den sein Leben und Denken umgestaltenden göttlichen Eingriff einzugehen:
Da gefiel es dem, der mich vom Mutterschoß an auserwählt und in seiner Gnade dazu berufen hat, die Frohbotschaft von ihm unter den Heiden zu verkünden, seinen Sohn in mir zu offenbaren (Gal 1, 15f.)
Ihm, der sich zuvor nur für eine tradierte und damit vorgegebene Überzeugung eingesetzt hatte, wurde dem Zentralgehalt dieser Aussage zufolge das innovatorische Prinzip einer gottentstammten Wahrheit eingegeben, das ihn zugleich zu deren weltweiter Promulgation verpflichtete. Wenn Paulus im Fortgang des Briefs dann auch noch auf den Herzenstausch mit dem ihm „Eingesprochenen“ und zum Lebensinhalt Gewordenen zu sprechen kommt (Gal 2, 20), gibt er überdies zu verstehen, dass mit seinem Erlebnis der für ihn entscheidende Identitätsgewinn einherging. Seine Lebensgeschichte bietet somit das gegenteilige Bild einer sich organisch entwickelnden Biographie. Nicht aufgrund einer in ihm angelegten Qualifikation, sondern eines ihn verwandelnden Eingriffs wurde er zu dem, als welcher er in die Christentumsgeschichte einging. Diesem Ereignis verdankt er alles. Es brachte ihn zum Reden (2Kor 4, 13), es inspirierte ihn zu seinem theologischen Entwurf und gab ihm den Impuls zur Ausarbeitung seiner Botschaft und zur Abfassung seiner Briefe. Deshalb müssen seine Aussagen ständig auf dieses Ereignis zurückbezogen werden, da sie erst von ihm her ihren wahren Stellenwert gewinnen. Wie eine Hintergrundstrahlung durchhellt es sein ganzes Werk und stimmt es so trotz aller Widersprüchlichkeit zu einem, wenngleich logisch nicht fassbaren Ganzen. Darauf angesprochen, würde Paulus mit Goethe jedoch nur erwidern: „Je inkommensurabler, desto besser!“ Vor allem aber verlieh dieses Ereignis seinem Leben die prospektive Zielrichtung, die Paulus zu dem Bekenntnis veranlasste, dass ihm das Leben fortan in dem Wunsch bestehe, den immer umfassender zu begreifen, von dem er sich ergriffen fühle (Phil 3, 12), während er das, was hinter ihm liegt, vergesse (3, 13). Dennoch konnte er „das Alte“, über das er sich geradezu triumphierend erhebt (2Kor 5, 17), nicht auf sich beruhen lassen, da das „Neue“ erst in der Abgrenzung davon sein volles Relief gewann. Nicht umsonst kommt er, und dies sogar (wie Phil 3, 4f.) mit Nachdruck, auf seine „Vorgeschichte“ zu sprechen. Dabei hebt er mit dem Hinweis, dass er das, was ihm vormals als „Gewinn“ erschien, nunmehr als „Verlust“ und „Unrat“ einschätze, darauf ab, dass er erst im Rückvergleich zur vollen Gewichtung des „ihm zum Lebensinhalt Gewordenen“ gelangte.
Damit verschiebt sich die bisher dominierende synchrone Sicht in den für Paulus ungleich wichtigeren diachronen Aspekt. Doch so entspricht es der gegensätzlichen Selbstdarstellung des Apostels, der sich einmal mit dem Bild vom Schatz im Tongefäß (2Kor 4, 7) im Querschnitt und dann mit dem Wort von seiner permanenten Selbstüberschreitung (Phil 3, 8) im Längsschnitt charakterisiert. Was diesen bei weitem vorherrschenden Zug seiner Denk- und Lebensform anlangt, so ist bei ihm offensichtlich mit Überholungsprozessen zu rechnen, aufgrund deren er einmal eingenommene Positionen aufgibt, um gegebenenfalls dann doch wieder auf sie zurückzugreifen. Der bereits angesprochene Fall seines Schwankens zwischen einer hamartiologischen Begründung des Sterbens (Röm 6, 23) und der thanatologischen Herleitung des Bösen (1Kor 15, 56) ist ein exemplarischer Beleg dafür. So wird man dem harten Urteil Albert Schweitzers nur schwer widersprechen können: „in allem voller Unklarheit und Widerspruch“. Tatsächlich war Paulus „ein Mensch mit seinem Widerspruch“; aber gerade in seinem Widerspruch – ein Mensch. Und als solcher die leibhaftige Aufforderung, das, was er in seinen widersprüchlichen Äußerungen offen ließ, fort- und zu Ende zu denken.