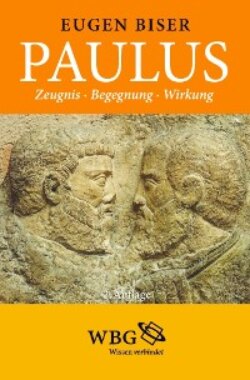Читать книгу Paulus - Eugen Biser - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Profil
ОглавлениеIn der Hellsichtigkeit seines Hasses gab Nietzsche darauf die wohl zutreffendste Antwort mit der Feststellung:
Paulus glaubte an Jesus, weil er ein Objekt nötig hatte, das ihn konzentrierte und dadurch befriedigte103.
Unwillkürlich greift er damit auf das Begriffsbild vom Schatz im Tongefäß (2Kor 4, 7) und dessen Erläuterung durch das Wort von dem sich im Gegenzug zum Zerfall des äußern Menschen auferbauenden „innern Menschen“ (4, 16) zurück. Für die Frage der Profilbestimmung ergibt sich daraus eine dialektische Signatur. Paulus begreift sich als der in der Anfechtung Starke, als der im Verlust Gewinnende, als der im Zerbrechen voll zu sich selbst kommende. Im Gefühl, wie nur je ein Gladiatorenkämpfer als Todeskandidat auf den letzten Platz gestellt worden zu sein, beschreibt er das selbst mit den bitteren Worten:
Mir kommt es so vor, als habe Gott uns Apostel – wie Todeskandidaten – auf den letzten Platz gestellt. Denn wir sind ein Schauspiel für die Welt, für Engel und Menschen. Wir sind Toren um Christi willen – ihr seid ja klug in Christus. Wir sind schwach – ihr seid stark. Ihr seid angesehen – wir gelten nichts. Bis zur Stunde leiden wir Hunger und Durst, gehen wir nackt, werden wir misshandelt, sind wir obdachlos und mühen wir uns ab mit unsrer Hände Arbeit. Doch schmäht man uns – wir segnen; verfolgt man uns – wir dulden; beschimpft man uns – wir reden gut zu. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Auswurf aller bis jetzt (1Kor 4, 9–13).
Als sei das noch nicht genug, wiederholt er diese Selbstanzeige in der Folge nochmals, wobei er sich, bezeichnend für seine virtuose Sprachkraft, zu einer wahren Wortkaskade steigert:
Niemandem geben wir den geringsten Anstoß, damit unser Dienst nicht in Verruf gerät. Vielmehr empfehlen wir uns in jeder Hinsicht als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnis, in Nöten und Ängsten, unter Schlägen, in Kerkerhaft, bei Aufständen, in Mühen, Nachtwachen und Fasten …, bei Ehre und Schmach, bei Verleumdung und Lob, als Schwindler geltend und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohl bekannt, als Todverfallene und doch überlebend, als Geschlagene und doch nicht umgebracht, als Betrübte und doch allzeit fröhlich, als Bettler, die viele beschenken, als Habenichtse, die doch alles besitzen (2Kor 6, 3ff.8ff.)104.
Trotz dieser Häufung von Leidensaussagen behält Jürgen Becker mit seiner Beobachtung Recht, dass Paulus eher „versteckt“ als breit ausführend auf die von ihm ausgestandenen Strapazen und Torturen eingeht, sodass man in Erinnerung an seinen Leidenskatalog versucht sein könnte, zu den von ihm erwähnten „Gefahren von Flüssen, Räubern und in der Wüste“ (2Kor 11, 26) Schillers „Bürgschaft“, die dramatisch von der Überquerung eines angeschwollenen Flusses, vom Kampf mit Räubern und von der Not des Verdurstens zu erzählen weiß, zur Verdeutlichung heranzuziehen105. Dabei hängt der Bericht in „Kurzformeln“ nach Becker auch damit zusammen, dass Paulus „die Leiden als Kehrseite des apostolischen Dienstes“ versteht und sie mit dem wiederholten Wort von seinem „Mitgekreuzigtsein“ mit Christus (Gal 2, 19; Phil 3, 10) und der Versicherung, dass er mit den „Malzeichen Jesu“ dessen Sterben an seinem Leib trage (Gal 6, 17; 2Kor 4, 10), in einem passionsmystischen Sinn rechtfertigt106. In der Schilderung der Theaterszene mit den an den „letzten Platz“ gestellten Todeskandidaten und deren ekstatischem Gegenstück im zweiten Korintherbrief hebt Paulus aber vor allem auf die für die Profilbestimmung ungleich wichtigere Dialektik seines Existenzvollzugs ab. Ihm ist das Leiden auch in dem Sinn auf den Leib seiner kämpferischen Natur geschrieben, als er sich immer erst aus der Erniedrigung zu seiner vollen Höhe erhebt und erst in der Anfechtung sein volles Format gewinnt. Er bedarf geradezu der Widerstände und Gegnerschaften, weil erst der davon ausgehende Druck seine stupenden Energien in ihm freisetzt. Deswegen war er geradezu strukturell dafür disponiert, den für die Weltwirksamkeit des Christentums entscheidenden Bruch mit der jüdischen Gesetzesreligiosität zu vollziehen. Und deswegen waren es neben den Irritationen und Konflikten seiner Gemeinden nicht zuletzt die Gegner, die ihn zur Ausarbeitung seiner Konzeption und zur Gestaltung seiner Botschaft veranlassten.
Was wäre Paulus ohne seine Gegner, deren Spur sich durch nahezu alle seine Briefe hindurchzieht? Denn sie provozierten ihn nicht nur, sondern wurden von ihm geradezu zur unfreiwilligen Mitgestaltung seiner Botschaft herangezogen, sodass der Eindruck entsteht, dass er sein Profil an ihrem Widerstand schärfte. Bemerkenswert ist dafür der Schluss der „Narrenrede“. Sie beginnt zwar mit einer heftigen Attacke auf die „Überapostel“, von denen sich die Gemeinde einfangen und misshandeln ließ (2Kor 11, 20) und die ihn durch ihre anmaßende Behauptung, die wahren „Diener Christi“ zu sein, zu seiner exzessiven Selbstdarstellung nötigten. Doch am Schluss dieses Ausbruchs, in dem er der Gemeinde sein eigenes Leidensgesicht vor Augen stellte, so wie er den vom Abfall bedrohten Galatern den gekreuzigten Christus vor Augen gezeichnet hatte (Gal 3, 1), verliert er die Gegner für einen Augenblick aus den Augen, wenn er der Gemeinde vorhält:
Zum Narren bin ich geworden; doch ihr habt mich dazu gemacht! (2Kor 12, 11).
Dabei war er nur zu sehr im Recht. Denn das von ihm entworfene Selbstporträt war weit mehr als eine Replik auf die gegen ihn gerichteten Angriffe. Es war eine konfessorische Selbstdarstellung, mit der er sich nicht nur gegenüber der schwierigen Gemeinde auswies, sondern den Grundstein für die gesamte autobiographische Literatur der Folgezeit legte. Die volle Profilbestimmung wäre aber erst dann erreicht, wenn sich der Selbstgewinn nachweisen ließe, der mit dieser vielfachen Beeinträchtigung und Beschädigung einherging.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass dieser sich bisweilen bis zum Zynismus steigernde Polemiker (Gal 5, 12; 2Kor 11, 13; Phil 3, 2) im Grunde ein, wenngleich zunächst frustrierter, Liebender war und blieb. Dafür sprechen die beiden Hymnen auf die Liebe, die sein Briefwerk wie ein Goldrahmen umfassen. Der erste und ungleich bekanntere ist der des ersten Korintherbriefs, der deutlichen Kriterien zufolge der „Vorzeit“ des Apostels entstammt und von der Liebe hauptsächlich aus der Position des Entbehrenden und Sehnenden spricht107. Demgegenüber wirkt der Hymnus des Römerbriefs wie ein Dokument der Erfüllung dessen, was der Autor des ersten Hymnus entbehrt und ersehnt hatte:
Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Wenn er seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern für uns alle hingegeben hat – wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Angst oder Not, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn (Röm 8, 31f.34.37ff.).
Wenn man die beiden Hymnen als die Eckpfeiler der von Paulus durchmessenen inneren Biographie und des von ihm durchschrittenen Denkwegs versteht, wird dieser als der Progress von der entbehrten zu der gefundenen Liebe ersichtlich, die für Paulus vor allem die in Jesus verkörperte und ihm von diesem entgegengebrachte ist. Wenn für ihn schon das Erkennen einem vorgängigen Erkanntsein entstammt (Gal 4, 9; 1Kor 8, 2f.; 13, 12), dann besteht die Liebe für ihn erst recht in der Erfahrung, dass er ohne Verdienst und Vorleistung von Jesus geliebt wurde (Gal 2, 20)108.
Deshalb galt in seinem Fall nicht „der Weg ist das Ziel“, sondern umgekehrt „das Ziel ist der Weg“, weil er auf seinem Denk- und Lebensweg im Grunde nur das einzuholen brauchte, was ihm in seinem Damaskuserlebnis zugesprochen und eingegeben worden war. Dass es einer seine ganze Lebenskraft beanspruchenden Anstrengung bedurfte, um mit dem grundsätzlich schon erreichten Ziel auch faktisch gleichzuziehen, erklärt Paulus im Kontext seines haptischen Osterzeugnisses, wenn er betont, dass er sich nicht einbilde, „es schon ergriffen zu haben oder gar schon vollendet zu sein“, dass er aber dem Siegespreis seiner himmlischen Berufung „nachjage“ und deswegen vergesse, was hinter ihm liege, um sich nach dem vor ihm liegenden Ziel „auszustrecken“ (Phil 3, 12ff.). Wenn er im Angang dazu von seinem Verlangen nach Gleichförmigkeit mit dem Tod und der Auferstehung Jesu spricht (3, 10), lässt er erkennen, dass es ihm bei diesem Prozess um eine wachsende Anverwandlung an den zu tun ist, von dem er sich seit seiner Damaskusstunde ergriffen weiß.
Dennoch ergibt sich daraus kein bruchloses und glattes Profil, da Paulus bei diesem Bestreben sein leidenschaftliches Temperament und seine innere Hochspannung nur allzu oft in die Quere kam. Wenn er erst einmal einen Gegner ins Visier genommen hat, lässt er seinem Temperament nicht selten, wie insbesondere im Fall seiner sich bis zum Kastrationsrat steigernden Gegnerbeschimpfungen (Gal 5, 12; 2Kor 11, 13f.; Phil 3, 2.19), die Zügel schießen. Schwerer noch fällt die Stelle ins Gewicht, an der er sich nicht von seinen Gefühlen fortreißen lässt, sondern sich im Vollbewusstsein seines Tuns mit der allzu toleranten Gemeinde von Korinth „im Geist versammelt“, um den Blutschänder, wenngleich in der Hoffnung auf seine endzeitliche Rettung, „dem Satan auszuliefern“ (1Kor 5, 3ff.)109. Davon fallen Schatten auf das Bild des Apostels, der sonst seinen Gemeinden mit väterlicher (1Thess 2, 12; 1Kor 4, 15), ja mütterlicher (1Thess 2, 7; Gal 4, 19) Zuwendung begegnet und sie geradezu in seinem Herzen trägt (2Kor 7, 3; Phil 1, 7).
Wer Paulus im Hinblick darauf, wie es nur allzu oft geschieht, herabzuwürdigen sucht, hat offensichtlich keinen Sinn für die extreme Anspannung, aus der all das hervorging. Und ebenso hat er den aus dem Blick verloren, der seine einzigartige Denk- und Lebensleistung einer schwachen Konstitution (1Kor 2, 3; 2Kor 12, 9f.) und einem Übermaß an Strapazen, Torturen und Gefährdungen abrang. Angesichts dieses Tatbestands muss jede Kritik verstummen, zu der ohnehin nur der berechtigt wäre, der auch nur annähernd Vergleichbares gelitten hat. Auch zöge er sich das Verdikt des Kirchenhistorikers Karl Holl zu, der Kleinasien vorwarf, Paulus für das Geschenk des Christenglaubens „mit dem schwärzesten Undank“ entlohnt zu haben110.
74 N. Fuerst, Der Schriftsteller Paulus, Darmstadt 1989, 79–82.
75 H. von Kleist, Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, in: Sämtliche Werke, München und Zürich 1961, 784–788.
76 J.W. von Goethe, Faust II, 1. Akt: Finstere Galerie.
77 Näheres in dem Exkurs „Paulus und der Tod“ (S. 294ff.).
78 E. Lohse, Paulus. Eine Biographie, München 1996, 82.
79 Hieronymus, Epistolae 22, 30; dazu H. von Campenhausen, Lateinische Kirchenväter, Stuttgart 1960, 114f.
80 K. L. Schmidt, Kolaphizo, in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament III, Stuttgart 1938, 820f.; R. Meyendorf, Der Apostel auf der Couch. Paulus, mit den Augen eines Psychiaters betrachtet, in: R. Niemann (Hrsg.), Paulus – Rabbi, Apostel oder Ketzer?, Stuttgart 1994, 30–159; J. Becker, Paulus. Der Apostel der Völker, Tübingen 1989, 185ff.; G. Lüdemann, Die Auferstehung Jesu. Historie, Erfahrung, Theologie, Göttingen 1994, 109ff.; Ders., Paulus, der Gründer des Christentums. Lüneburg 2001, 167–171; H. Fischer, Gespaltener christlicher Glaube, Hamburg 1974, 62f.
81 S. Kierkegaard, Der Pfahl im Fleisch (Ausgabe Haecker), Innsbruck 1984, 46f.
82 A.a.O., 46.
83 G. Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, Göttingen 1983, 146f.
84 Th. K. Heckel, Der innere Mensch. Die paulinische Verarbeitung eines platonischen Motivs, 90f.
85 Tertullian, Adversus Marcionem IV, c. 33, 8; Origenes, Matthäuskommentar XIV, c.7, nach H. Merklein, Jesus, Künder des Reiches Gottes, in: Studien zu Jesus und Paulus, Tübingen 1987, 153.
86 G. Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, Göttingen 1983, 346.
87 Dazu mein Beitrag: Paulus, der Entdecker der christlichen Subjektivität, in: R. L. Fetz, R. Hagenbüchle und P. Schulz (Hrsg.), Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität, Berlin 1998, 286–297.
88 L. Schenke, Die Urgemeinde. Geschichtliche und theologische Entwicklung, Stuttgart 1990, 246f.; dazu meine Studie: Das Antlitz. Eine Christologie von innen, Düssseldorf 1999, 164–177.
89 Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, 108; J. Gnilka, Paulus von Tarsus, 174f.
90 U. Wilckens, Der Brief an die Römer II, Zürich 1993, 224–227.
91 S. Kierkegaard, Einübung im Christentum (Ausgabe Hirsch und Gerdes), Gütersloh 1980, 37f.
92 A.a.O., 71.
93 So Kierkegaard schon in den „Philosophischen Brocken“ (Ausgabe Richter), Hamburg 1964, 69ff.; H. Gerdes, Sören Kierkegaards „Einübung im Christentum“. Einführung und Erläuterungen, Darmstadt 1982, 15f., 67; 92; H. Fischer, Die Christologie des Paradoxes. Zur Herkunft des Christusverständnisses Sören Kierkegaards, Göttingen 1970, 74–94; ferner die Ausführungen meiner „Einweisung ins Christentum“, 49–59.
94 Wilckens, a.a.O., 227; J. Gnilka, Paulus von Tarsus, 232.
95 M. Buber, Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950, 45; dazu meine Schrift: „Buber für Christen. Eine Herausforderung“, Freiburg 1988, 117–121.
96 So formuliert Buber im Blick auf die johanneische Thomasszene (Joh 20, 28): Zwei Glaubensweisen, 131.
97 G. Theißen, Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, 153f.
98 Buber, a.a.O., 27; 63. Näheres dazu in dem Abschnitt „Paulus und Buber“ des 2. Teils (S. 258ff.).
99 A.a.O., 163.
100 A.a.O., 165.
101 Ebd.; Theißen, a.a.O., 117–120.
102 M. Buber, Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie, Zürich 1953, 149.
103 Nachlassaufzeichnung vom Sommer 1880; nach J. Salaquarda (Hrsg.), Nietzsche, 1996, 291.
104 J. Becker, Paulus. Der Apostel der Völker, Tübingen 1989, 180–189.
105 A.a.O., 187.
106 A.a.O., 187ff.; aber gegen Beckers Bestreitung eines passionsmystischen Zusammenhangs.
107 Dazu nochmals das in dem Abschnitt „Die Vorzeit“ Gesagte (oben S. 19ff.).
108 J. Becker, a.a.O., 81f.
109 J. Gnilka, Paulus von Tarsus, 173f.
110 K. Holl, Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis zu dem der Urgemeinde, in: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte II. Der Osten, Tübingen 1928, 66.