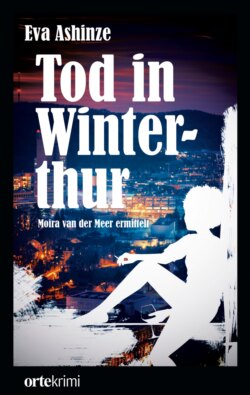Читать книгу Tod in Winterthur - Eva Ashinze - Страница 10
Оглавление5
Ich beobachtete Norah eine Weile, während sie schlief. Sie lag reglos auf der Seite, die Knie angezogen und die Hände nahe am Gesicht. Embryonalstellung. Ihr Gesicht war verquollen und verriet die Qualen der letzten Stunden. Ansonsten sah sie ruhig und friedlich aus, ihr Atem klang gleichmässig. Dieses Bild war trügerisch. Norah würde lange keinen Frieden finden. Sie würde nie mehr die alte sein. Sie war jetzt schon eine andere Frau.
Ich ging in die Küche, zündete mir eine Zigarette an und öffnete das Fenster. Die Mittagssonne strahlte heiss vom Himmel. Der Sommer ist nicht meine Jahreszeit. Da liegt zu viel Fröhlichkeit in der Luft. Zu viel Glückseligkeit. Ich wünschte mir, dunkle Wolken würden aufziehen, ein starker Regen einsetzen.
Ich kochte mir einen starken Kaffee und rauchte eine weitere Zigarette. Ich rekonstruierte für mich den Ablauf der Tat: In der Tatnacht war das Opfer alleine zu Hause gewesen. Offensichtlich war Jan lange aufgeblieben. Vielleicht hatte er gearbeitet. Ein Glas Wein getrunken. Irgendwann war der Einbrecher zur Hintertür hereinmarschiert, hatte Jan überrascht, ihn mit mehreren Schüssen niedergestreckt und anschliessend die Wertgegenstände mitgehen lassen. Die Schüsse waren unbemerkt geblieben. Kein Nachbar hatte die Polizei gerufen. Am Morgen kam Norah nach Hause und fand Jans Leiche. Die Polizei kam. Die Kriminaltechnik kam. Später stiess ich dazu.
Ich nahm einen langen Zug und hielt eine Weile den Atem an, bevor ich den Rauch wieder ausstiess. Ich sah in den strahlend blauen Himmel hinauf. Das Diebesgut. Die offene Tür. Die Waffe. Die Schüsse. Jan, tot. Norah, schlafend in meinem Bett. Etwas fehlte. Aber was? Ich rauchte zu Ende, drückte die Zigarette aus. Ich versuchte zu glauben, dass ich es mit einem ganz normalen Fall zu tun hatte. Es gelang mir nicht wirklich.
Mein Telefon läutete. Ich erkannte die Nummer, zögerte kurz und nahm dann ab.
«Moira», sagte mein Vater. «Ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt, du brauchst meine Hilfe.»
Ich hatte vierundzwanzig Jahre lang keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt. Er war nach Nigeria, in seine Heimat abgehauen, als ich fünfzehn war und meine kleine Schwester Maria dreizehn. Seither hatte ich jeglichen Versuch einer Kontaktaufnahme von seiner Seite abgewehrt. Ignoriert. Bis vor ein paar Monaten. Ich hatte den Tod eines jungen Mädchens untersuchen müssen. Dabei war meine eigene, relativ erfolgreich verdrängte Vergangenheit wieder aufgekocht. Meine verschwundene Schwester. Meine dysfunktionale Mutter. Der abwesende Vater. Schliesslich hatte ich zum Telefon gegriffen und ihn angerufen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hatte ich wieder die Stimme meines Vaters gehört. Seither standen wir sporadisch in Kontakt. Nicht, dass wir jetzt die besten Freunde wären. Dass die Vergangenheit überwunden und die Verletzungen geheilt wären. Aber wir befanden uns in einem Prozess der Annäherung.
«Vielleicht», antwortete ich meinem Vater, «vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe.» Ich erzählte ihm von meinem neusten Fall. Nicht der Fall der verschwundenen Eizellen. Der andere. Der Fall der vielen Zufälle. Ich erzählte ihm vom ermordeten Jan.
«Was soll ich tun?», fragte ich seufzend.
«Tu, was du immer tust», antwortete mein Vater. «Geh den guten Weg.»
Tja, was sollte ich sagen? Das half mir nicht wirklich weiter.
«Das ist dein Name, weisst du? Mmesoma. Der gute Weg.»
Ich verstand nur Bahnhof.
«Der Name findet einen. Nicht umgekehrt», fuhr mein Vater fort.
«Ich verstehe nicht», sagte ich. «Mein Name ist Moira.»
«Moira ist der Name, den deine Mutter dir gegeben hat. Er bedeutet Schicksal. Mmesoma ist der Name, den deine Ahnen für dich ausgesucht haben. Der gute Weg.»
Ich schwieg eine Weile. Ich musste das Gehörte erst einordnen. «Ich wusste nicht, dass ich einen zweiten Vornamen habe», sagte ich schliesslich.
«Nein. Deine Mutter wollte es so. Eine Erwähnung dieses Namens, und sie ist explodiert. Du kennst sie ja.» Ein glucksendes Lachen war zu hören.
Ich konnte das nicht lustig finden. Meine Mutter ist Alkoholikerin. Ein Glas zu viel oder zu wenig, ein Wort zu viel oder zu wenig hat einen Wutanfall zur Folge. Das war schon immer so. Deswegen war mein Vater wohl auch abgehauen und hatte mich und meine Schwester Maria mit Mutter allein gelassen. Aber das war eine andere Geschichte.
Moira und Mmesoma. Schicksal und der gute Weg. Vielleicht konnte ich irgendwann etwas damit anfangen. «Und Maria?», fragte ich.
«Was ist mit ihr?», erwiderte mein Vater die Frage.
«Welchen Namen haben ihr die Ahnen gegeben?»
«Ngozi. Gesegnet.»
Nun musste ich ein Lachen unterdrücken. Ein zynisches Lachen. «Da haben sie aber schön danebengegriffen», sagte ich.
Mein Vater schwieg eine Weile. «Deine Schwester ist an einem gesegneten Ort», sagte er. «Wo immer sie auch ist, es geht ihr gut.»
«Woher willst du das wissen?», fragte ich einigermassen aggressiv.
«Ich weiss es. Ich fühle es.»
Ich sagte nichts. Ich sagte nicht, dass ich keinen Deut auf solche Gefühle gab. Das waren Hirngespinste. Wunschdenken.
«Du glaubst mir nicht.» Mein Vater war nicht dumm. «Noch nicht. Aber es wird die Zeit kommen, wo du selbst die Dinge spürst.»
Bald nach dieser rätselhaften Aussage beendeten wir unser Telefonat. Ich war nicht klüger als zuvor. Aber ich war um einen Namen reicher. Mmesoma. Ich sagte ihn leise vor mich hin. Er klang gar nicht mal so übel.