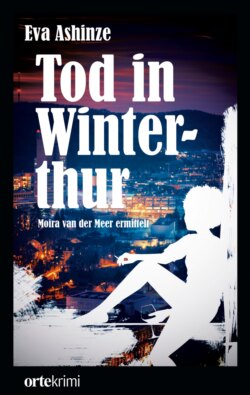Читать книгу Tod in Winterthur - Eva Ashinze - Страница 17
Оглавление12
Am nächsten Tag weckte mich das Läuten des Weckers um sieben Uhr. Ich war müde und hätte sonst etwas darum gegeben, den Kopf wieder aufs Kissen legen und weiterschlafen zu können.
Nach meinem Traum war an schlafen nicht mehr zu denken gewesen. Ich hatte lange Zeit auf der Fensterbank gesessen, geweint und um Jan getrauert. Später hatte ich mich zwar wieder ins Bett gelegt, aber mich während gefühlten Stunden hin- und hergewälzt. Entsprechend ging es mir heute. Aber ich musste aufstehen, ich musste in die Kanzlei. Die Fälle stapelten sich auf meinem Schreibtisch, ich hatte ein Plädoyer in einer Strafsache vorzubereiten, ich sollte diverse Schreiben verfassen, Anrufe tätigen. Und ich musste mich an den Fall der verschwundenen Eizellen machen. Immerhin hatte ich einen Vorschuss von 10 000 Franken akzeptiert. Eigentlich sollte dieser Fall sogar absolute Priorität haben.
Doch die Sache mit Jan und Norah war dazwischen gekommen. Ich fuhr hoch. Jan und Norah. Heute Nachmittag stand auch noch die Einvernahme an. Ich stiess einen Fluch aus, verliess mein Bett und setzte in der Küche Kaffee auf. Eine halbe Stunde später war ich auf dem Weg ins Büro.
Der Himmel war blau und wolkenlos; es war ein klarer, noch kühler Sommermorgen. Ein Morgen voller Versprechungen, ein Morgen, an dem alles im Bereich des Möglichen schien. Aber bald würde es wieder heiss werden und drückend.
Vorausschauend nahm ich mein Fahrrad für die kurze Strecke. Ich würde der Mittagshitze später so zwar nicht entgehen können, aber ich konnte sie schneller hinter mir lassen als zu Fuss.
Im Büro wimmelte ich Melvin ab, der schon vor mir da gewesen war. Er schien seit dem Einbruch das Büro nicht mehr zu verlassen, obwohl er als freier Journalist an keine Zeiten gebunden war. Egal. Solange er mich nicht behelligte, konnte er von mir aus in seinem Büro übernachten.
Ich erledigte erst die üblichen Routinearbeiten: Post und Mails durchgehen, To-Do-Liste aktualisieren, Tagesplan erstellen. Dann legte ich eine neue Akte an. Eine Akte mit dem Titel «Der Fall der verschwundenen Eizellen».
Nachdem das erledigt war, sass ich eine Weile ratlos da und fragte mich, wo ich anfangen sollte. Was ich von Corazollas an Unterlagen erhalten hatte, war spärlich und schnell gelesen. Ich beschloss, nicht direkt auf Angriff zu gehen. Ich würde die Wunschkinder-Klinik nicht anschreiben und Aufklärung verlangen. Das würde nichts bringen; es war nicht zu erwarten, dass die Klinik von ihrer bisherigen Aussage abweichen würde, nämlich dass Corazollas sich irrten. Ich musste anders vorgehen, subtiler. Erst einmal würde ich einige Erkundigungen über die Firma einholen und mir selbst ein Bild machen.
Einige Zeit später lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück, schaute zur Decke. Im Internet hatte ich erfahren, dass der Kopf der Wunschkinder-Klinik, dieser Doktor Brock, sich einen Namen innerhalb der Gilde der Reproduktionsmediziner gemacht hatte. Er war anscheinend eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Wer in seiner Klinik einen Termin vereinbarte, der wusste bereits, dass der Star der Babymacher dort das Zepter schwang. Seine Erfolgsrate war hoch, höher als die der anderen. Die Kosten waren wahrscheinlich entsprechend. Die Wunschkinder-Klinik war als Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen, und Doktor Brock sass auch im Verwaltungsrat. Etwas schlauer als zuvor war ich nun. Die Frage war, wie weiter. Kurzerhand setzte ich mich wieder gerade hin, rief die Seite der Wunschkinder-Klinik auf und füllte das standardisierte Onlineformular mit den Angaben zu meiner Person aus, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. Ich schickte das Formular ab und wandte mich anderen Dingen zu.
Kurze Zeit später, ich kam soeben von draussen, wo ich im spärlichen Schatten des Zwergapfelbaums eine Zigarette geraucht hatte, läutete mein Telefon. Die Sekretärin der Wunschkinder-Klinik war am Apparat. Wenn das kein zuvorkommender Service war? Ich war innert weniger als einer Stunde seit Kontaktaufnahme zurückgerufen worden.
«Sind Sie alleinstehend?», fragte die Empfangssekretärin. «Ihre Angaben waren da etwas missverständlich. Wenn ja, dann dürfen wir Ihnen leider keinen Termin anbieten. Künstliche Befruchtung ist in der Schweiz von Gesetzes wegen Paaren vorbehalten.» Sie machte eine kurze Pause. «Heterosexuellen Paaren», fügte sie hinzu, als sei sie unsicher, was meine sexuelle Ausrichtung anbelangte.
«Oh, das ist kein Problem», log ich aalglatt. «Ich habe einen Partner. Einen heterosexuellen Partner.» Nachdem das geklärt war, erhielt ich – erhielten wir – einen Termin. Bis dahin würde ich mir etwas einfallen lassen, was meinen fiktiven Partner anbelangte. Hindernisse waren schliesslich dazu da, um überwunden zu werden.