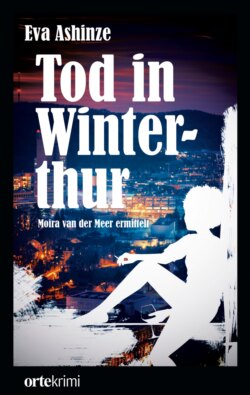Читать книгу Tod in Winterthur - Eva Ashinze - Страница 15
Оглавление10
Kurz darauf traf Rebecca ein. Sie war klein und rundlich mit wilden Locken. Ich liess Willy und Norah alleine, nahm Rebecca mit zu mir hoch und erzählte ihr noch einmal – diesmal etwas ausführlicher als am Telefon –, was geschehen war. Rebecca war verstört und wütend.
«Ich hoffe, sie finden den Kerl», sagte sie zornig. «Ich hoffe, sie erschiessen ihn, machen kurzen Prozess mit ihm.» Ihre Reaktion schien mir übertrieben und nicht ganz echt. Aber sie war gewillt und in der Lage, in der nächsten Zeit auf Norah aufzupassen, und darauf kam es an.
Wir holten Norah bei Willy ab und ich begleitete sie zum Auto. Norah war etwas wackelig auf den Beinen, also stützten wir sie den ganzen Weg durch den Garten.
«Bis morgen», verabschiedete ich mich.
Norah sah mich fragend an.
«Die Einvernahme», erinnerte ich sie.
Sie nickte vage.
Ich seufzte. Die Chancen standen gut, dass sie den Termin in einer Stunde bereits wieder vergessen hatte. Nachdem die beiden losgefahren waren, ging ich wieder nach oben. Eigentlich stand mir der Sinn nur noch nach meinen eigenen vier Wänden. Ich musste mich aber noch bei Willy bedanken. Seine Hilfe war nicht selbstverständlich.
Willy sass in seinem Sessel und hörte sich eine seiner geliebten Jazzplatten an, diesmal war es John Coltrane. Dank Willy kenne ich mich mittlerweile etwas aus.
«Moira, kommen Sie, setzen Sie sich zu mir.» Willy winkte mich heran. «Auch noch einen?» Er hielt sein Whiskeyglas hoch.
Ich zögerte. Oben wartete eine geöffnete Flasche Wein auf mich. Zudem hatte ich mir vorgenommen, meinen Alkoholkonsum im Zaum zu halten. Vor ein paar Monaten – anlässlich des Falles Maria Okeke – war ich mehr betrunken als nüchtern gewesen. Es war nicht annähernd so ausgeartet wie früher, während und nach meinem Studium, aber trotzdem besorgniserregend. Seitdem versuchte ich, wieder massvoll zu trinken. Doch: Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach.
«Einen kleinen», antwortete ich.
Willy sah mich erstaunt an, enthielt sich aber eines Kommentars und stellte einen kleinen Whiskey vor mich hin.
Ich nickte dankend und hob mein Glas.
Willy tat es mir nach und schweigend prosteten wir einander zu. Eine Weile sassen wir einfach da und hingen unseren Gedanken nach.
«Danke», brach ich schliesslich das Schweigen.
«Gerne», sagte Willy. Es sah aus, als wolle er noch etwas sagen.
Ich sah ihn fragend an.
Er schüttelte leicht den Kopf. «Es ist nichts. Ich habe nur gerade an meine Frau gedacht.» Willy erwähnte seine Frau selten. Ich wusste, dass er sie geliebt hatte. Aber sie war schon lange tot, und Willy hatte gelernt, alleine zu leben. Er schien den Verlust überwunden zu haben. Was wohl nicht hiess, dass er sie nicht ab und zu vermisste. «Ich hoffe, Norah kommt darüber hinweg», sagte Willy.
«Sie ist noch jung» erwiderte ich.
«Das heisst gar nichts», meinte Willy. «Sie kann trotzdem daran zerbrechen. Das ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage des Gemüts. Und Norah scheint mir sehr fragil zu sein.»
Ich gab keine Antwort. Ehrlich gesagt hatte ich mir genug den Kopf zerbrochen über Norah. Ich wollte für heute damit abschliessen.
Willy schien das zu spüren. Er kam auf etwas ganz anderes zu sprechen. Leider wählte er keinen unverfänglichen, leichten Gesprächsstoff wie beispielsweise das Wetter. Oder das Fernsehprogramm. Nein, er musste Celina ins Spiel bringen. Meine Mutter Celina. «Ich habe Celina zum Essen eingeladen», informierte mich Willy.
Ich lächelte höflich. Schön für ihn.
«Es wäre nett, wenn Sie auch dabei wären.» Willy sah mich auffordernd an.
Mein Lächeln verblasste. Ich wünschte, ich hätte nicht noch bei Willy reingeschaut. Ich wünschte, ich wäre direkt nach oben gegangen.
Willy und Celina kannten sich aus Kindheits- beziehungsweise Jugendtagen. Sie waren in derselben Strasse gross geworden, in der Seidenstrasse. Willy war mehr als zehn Jahre älter als Celina, deswegen hatten sie sich aus den Augen verloren, als Willy mit Mitte zwanzig von zu Hause auszog. Vor Kurzem hatte Willy durch eine Verkettung von Zufällen ihre Bekanntschaft aber zu neuem Leben erweckt. Nicht gerade zu meiner Freude muss ich gestehen. Ich verstehe mich nicht besonders gut mit meiner Mutter. Nein, das ist eine schamlose Untertreibung. Eigentlich kann ich meine Mutter nicht ausstehen. Dass sie und Willy nun irgendwie freundschaftlich verbandelt waren, war, als dringe sie in mein Revier ein. Willy war mein Freund. «Eher nicht», antwortete ich.
Willy sah mich bittend an. «Moira. Irgendwann müssen Sie Frieden schliessen mit Ihrer Mutter. Die Vergangenheit hinter sich lassen. Je früher desto besser.»
Musste ich das? Nein. Ich kam ganz gut damit klar, meine Mutter zu verabscheuen. «Willy, glauben Sie mir, Sie möchten uns nicht beide gleichzeitig an Ihrem Tisch sitzen haben», sagte ich gespielt munter.
Willy öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber ich kam ihm zuvor: «Sie meinen es gut, ich weiss. Aber bei meiner Mutter und mir ist Hopfen und Malz verloren.» Ich erhob mich, um einen visuellen Schlusspunkt unter dieses Gespräch zu setzen.
«Sie können es sich noch überlegen», sagte Willy.
Ich nickte: Die Hoffnung stirbt zuletzt. «Gute Nacht, Willy.» Ich legte ihm kurz die Hand auf die Schulter. Sie fühlte sich schmal und zerbrechlich an.
«Gute Nacht, Charlie.» Ich streichelte dem jungen Golden Retriever, der zusammengerollt zu meinen Füssen auf dem Boden lag, über den seidigen Kopf. Er gab im Schlaf einen kurzen glücklichen Seufzer von sich. Hund müsste man sein.
«Gute Nacht, Moira.»
Unter der Tür drehte ich mich nach Willy um. Er sah plötzlich alt aus, wie er in seinem Sessel sass – alt und irgendwie traurig. Wider Willen verspürte ich den Anflug eines schlechten Gewissens, verdrängte ihn aber. Ich hatte heute genug mitgemacht. Trotzdem blieb ein unguter Nachgeschmack zurück, als ich die Treppen hochging in mein Reich.
In meinem Schlafzimmer entledigte ich mich meiner Kleidung und schlüpfte in ein übergrosses T-Shirt, das mir als Nachthemd diente. Es war erst kurz nach neun, doch der Tag hatte mich geschafft, körperlich und emotional. Ich goss mir ein Glas Rotwein ein und setzte mich wieder auf die Fensterbank, meinen angestammten Platz für die Gute-Nacht-Zigarette. Ich trank meinen Schlummertrunk, rauchte und lauschte auf die Geräusche aus dem Garten. Grillen zirpten, ab und zu raschelte es im Dunkeln. Vom nahen Waldrand waren die Glocken der Kühe zu hören, die dort ihre Weide hatten. Idylle pur. Die Stadt schien weit weg.
Ich geriet ins Träumen, dachte an vergangene Sommer, frühere Leben. Ich war beinahe froh, als ein Bus die Rychenbergstrasse entlangfuhr. Ansonsten hätte ich noch angefangen an diesem lauen Sommerabend über Gott und die Welt nachzudenken, mit unabsehbaren Folgen. Eine Flasche Wein hätte ich dazu mindestens trinken müssen. Und irgendwann hätten mich die Erinnerungen an meine verschwundene Schwester eingeholt. So aber holte mich das Geräusch des Motors rechtzeitig auf den Boden zurück.
Ich ging ins Bad, putzte die Zähne und legte mich ins Bett. Bevor ich einschlief, fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, Norah nach Paul Petersen zu fragen.