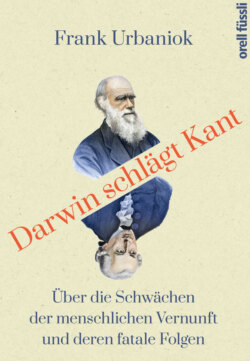Читать книгу Darwin schlägt Kant - Frank Urbaniok - Страница 18
2.4What you see is all there is (WYSIATI-Regel)
ОглавлениеWir haben eine außerordentlich hohe Bereitschaft, uns aus wenigen, oft zufälligen und unvollständigen Informationen eine Geschichte zu zimmern, die subjektiv passt. Dabei leisten uns der Halo-Effekt, der Rückschaufehler und viele weitere verzerrungsanfällige Mechanismen gute Dienste. Die subjektiv passende und angenehme Geschichte glauben wir gerne, halten sie für wahr, und das mit einem hohen Maß an innerer Überzeugung. Unser intuitives System ist darauf ausgerichtet, möglichst schnell eine kohärente Geschichte parat zu haben. Die Kohärenz der Geschichte ist das entscheidende Kriterium. Auf wie vielen Informationen diese Kohärenz beruht, von welcher Qualität diese Informationen sind, welche Informationen fehlen, das alles spielt keine Rolle. Häufig verfügen wir zwar nur über sehr wenige Informationen. Das beeinträchtigt aber nicht unsere Überzeugung, die wir mit einer Geschichte verbinden. Hier spielt nur die höchst subjektiv empfundene Kohärenz der Geschichte eine Rolle. Das ist der Kern der WYSIATI-Regel: Was wir nicht sehen, was wir nicht wissen, das gibt es nicht.
Kahneman beschreibt, dass es nicht auf die Menge oder die Qualität von Informationen ankommt. Wie stark wir von etwas überzeugt sind, hänge vor allem »von der Qualität der Geschichte ab, die wir über das erzählen können, was wir sehen, auch wenn wir nur wenig sehen«. Ist die Geschichte stimmig, dann sind wir restlos überzeugt. Zweifel und mögliche Widersprüche werden unterdrückt, und uns fällt gar nicht auf, dass uns viele wichtige Informationen fehlen. [4, S. 115]
Ein anderes Beispiel für die WYSIATI-Regel ist der Framing-Effekt: Die 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Operation zu überleben, wirkt beruhigender als die Aussage, dass ein 10-prozentiges Sterberisiko besteht. Dies, obwohl beide Aussagen inhaltlich genau das Gleiche bedeuten.
»In ähnlicher Weise ist Aufschnitt, der als ›90-prozentig fettfrei‹ beschrieben wird, anziehender als ›Aufschnitt mit 10 Prozent Fett‹. Die alternativen Formulierungen sind ganz offenkundig gleichbedeutend, aber eine Person sieht normalerweise nur eine Formulierung und ›nur was man sieht, zählt.‹« [4, S. 115]
Ein anderes Beispiel ist der Basisratenfehler. Er beschreibt, dass wir völlig unabhängig von der zugrunde liegenden statistischen Wahrscheinlichkeit einer Tatsache diese für wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten, je nachdem, ob uns eine um sie herum konstruierte Geschichte subjektiv kohärent erscheint oder nicht. Einer Versuchsgruppe werden zum Beispiel zwei Eigenschaften einer Person präsentiert: sanftmütig und ordentlich. Dann werden die Probanden gefragt, welchen Beruf diese Person wohl habe. Die meisten entscheiden sich in der dargebotenen Auswahl für den Beruf des Bibliothekars und nicht des Landwirts. Denn das Bild eines ordentlichen und sanftmütigen Bibliothekars kreiert eine subjektiv kohärente Geschichte. Statistisch gibt es aber sehr viel mehr männliche Landwirte als Bibliothekare, sodass es ungleich wahrscheinlicher ist, dass eine zufällig ausgewählte Person Landwirt statt Bibliothekar ist. [4, S. 17–18, 115]