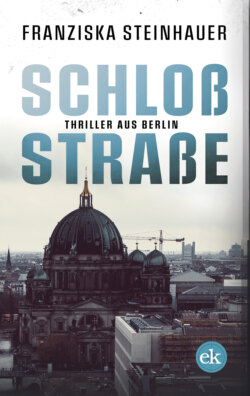Читать книгу Schloßstraße - Franziska Steinhauer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеDr. Friedemann Wendler schwenkte seine Tasse träge hin und her.
Beobachtete gedankenleer den kalten Kaffeerest, der über den Boden tanzte.
Trank dann den letzten Schluck.
Widerlich.
Er schüttelte sich.
Ein Spruch aus Kindertagen fiel ihm ein: Kalter Kaffee macht schön. Er lächelte flüchtig. Wahrscheinlich galt das nur für Frauen und nicht für deutlich ergraute Männer jenseits der Fünfzig. Aber schaden konnte es wohl nicht, vielleicht wirkte es ja doch. Mairegen machte angeblich auch schön, erinnerte er sich. Fuhr sich mit den Händen müde durchs Gesicht und konstatierte, auch das habe bei ihm nicht angeschlagen.
Mai – lange her.
Neben der Tasse lag ein Zettel.
Seine To-do-Liste für heute.
Zugegeben, lang war sie nicht. Es hätte keiner Notizen bedurft. Aber er legte immer eine an. Aus Gewohnheit. Erika, seine Frau, wollte immer schon beim Frühstück wissen, wie sehr der Tag verplant war.
Seine Augen marschierten in den Flur. Dort standen seine Koffer. Unausgepackt. Schon viel zu lange. Nur sein Necessaire hatte er rausgenommen, mehr nicht. Wozu auch? Störte sich doch niemand an den beiden Gepäckstücken. Die Wäsche auszuräumen wäre demnach nur ein Befolgen gesellschaftlicher Konventionen – und das lag ihm von jeher nicht.
Ganz anders als bei Marlon.
Der hatte schon als Kind begeistert Regeln befolgt. Und nun bestand sein gesamtes Leben daraus. Wie im Knast, dachte Dr. Wendler und zuckte heftig zusammen.
Seufzend stemmte er sich an der Tischplatte hoch. Schlurfte in die Küche, holte sich eine weitere Tasse Kaffee.
Die Erinnerung an das Gespräch mit seinem Sohn war schmerzvoll.
Desillusionierend. Deprimierend.
Nach dem Tod seiner Frau, Erika, musste er nun einsehen, dass er auch Marlon verloren hatte.
An eine Sekte. Ausgerechnet.
All sein Wissen, sein Geschick, seine Kunst, Menschen auf neue Wege zu bringen, hatten ihm nichts genutzt.
Kläglich versagt. Völlig gescheitert. Auf ganzer Strecke.
Marlon …
Offiziell hatte er einen Vortrag über moderne Methoden des Criminal Profilings zum Anlass genommen, nach Virginia zu fliegen. Quantico. Man lud ihn ein, freute sich auf den bekannten Kollegen aus Berlin. Und daneben vereinbarte er ein Treffen mit Marlon. Klar, er wusste besser als die meisten, welche Art Hirnwäsche man mit den neuen Mitgliedern durchführte, kannte die fiesen, manipulativen Tricks, mit denen viele dieser Sekten arbeiteten, das Selbstbewusstsein der Neuen ins Wanken brachten, sie gefügig und anfällig für die Ideologie machten.
Ihm konnte man nicht vormachen, Marlon rede all den Schwachsinn aus Überzeugung.
Shit!
Er hatte zu viel Milch in seine letzte Tasse Kaffee gegossen, brauchte ein Tuch aus der Küche, um das Gemisch aufzufangen.
Marlon sei bereit dazu, ihn zu treffen. So lautete die offizielle Formulierung.
In einem dieser Fast Food Restaurants am Highway. Bill´s Diner.
Ohne Begleitung.
Ein Vater-Sohn-Gespräch unter vier Augen. Keine Beobachter oder Lauscher in der Nähe. So war es versprochen worden – und genau das glaubte der Vater natürlich nicht. Sicher gäbe es Abhörmöglichkeiten, vielleicht übers eingeschaltete Handy, er würde wachsam sein, jedes noch so kleine Signal seines Sohnes registrieren und ihn dann aus den Klauen …
Nun, es war anders gekommen.
Marlon.
Keinesfalls wirkte er eingeschüchtert oder fremdgesteuert.
Selbstbewusst und arrogant nahm er ihm gegenüber Platz.
Legte als Erstes das ausgeschaltete Mobiltelefon auf den Tisch. Er wusste genau, wie sein Vater tickte.
Die Lotterjeans war einem teuren, erstklassig geschnittenen Business-Anzug gewichen, das viel zu weite Shirt verschwunden, dafür trug er jetzt figurnahes Hemd und Krawatte. Teuerste Marke. Die lockige Mähne, die ungepflegt bis über die Schultern gefallen war – gegen einen stylischen Kurzhaarschnitt getauscht. Der Psychiater konnte kaum glauben, dass der junge Mann im Anzug nach modischem Cut sein eigener Sohn war.
Von der ersten Sekunde an fand er sich in die Defensive gedrängt.
Seine Gesprächsstrategie? Zum Scheitern verurteilt.
Überrumpelt hörte er sich an, was Marlon zu sagen hatte.
Lauerte auf versteckte Signale, die eine Seele in Not aussandte. Da waren keine. Zu keinem Zeitpunkt.
Marlon wirkte ruhig. Fast tiefenentspannt.
Drogen?
Er musterte sein Gegenüber.
»Lass das! Ich weiß, was du denkst. Es gibt keine Hirnwäsche, keine Drogen, keinen Zwang, keine Kontrolle. Ich bin nicht verkabelt. Keiner belauscht unser Gespräch. Du kannst es nicht akzeptieren, deinen Sohn an eine ›Sekte‹ verloren zu haben. Dabei ist es so, dass du mich schon vor langer Zeit verloren hast. Hör mir einfach zu«, forderte der junge Mann.
Sicher, einen Teil der Wahrheiten hatte er so oder so ähnlich zu hören erwartet. Sie waren seit Jahren Bestandteil jeder Diskussion zwischen ihnen gewesen. Einiges traf ihn allerdings tief. Er sei kein guter Vater gewesen – geschenkt. Das sahen viele Kinder während der Pubertät so, es legte sich in der Regel später. Bei Marlon schien es etwas länger zu dauern, egal. Dass er seine Frau unglücklich gemacht habe, das war neu und verletzend. Der Vorwurf, er habe sie sich selbst und dem verzehrenden Krebs überlassen, ohne ihr zur Seite zu stehen, traf ihn hart. War möglicherweise nicht ganz unzutreffend, wie ein Teil seines Denkens mahnte. Workshops, Kongresse, Fortbildungen – jeder Grund sei ihm recht gewesen, der belastenden Begegnung mit der Sterbenden auszuweichen, behauptete der Sohn zornig.
Am Ende erklärte Marlon kalt, nun könne der Besucher in aller Ruhe nach Deutschland zurückkehren und weiter sein spießiges Besserwisserleben führen. Vielleicht gelegentlich mal über dieses Gespräch nachdenken. Das müsse er aber nicht. Denken sei, wie allgemein bekannt, freiwillig. Dabei hatte der Sohn zynisch gegrinst. Es habe auch keinen Sinn, irgendwelche läppischen Karten zum Geburtstag oder zu Weihnachten zu schicken. Das habe in der neuen Gemeinschaft, in der er lebe, nicht die geringste Bedeutung. In ihrem Zusammenleben habe das Ich untergeordnete Bedeutung. Das Wir war entscheidend. Wenn er jedoch ernsthaft mit ihm in Kontakt treten wolle, dann sei das jederzeit möglich, aber nur als Vater, nie mehr als Psychiater.
Marlon stand nach diesen Worten auf.
Wandte sich grußlos um und ging.
Kein Blick zurück.
Er selbst hatte während der gesamten Unterhaltung vergeblich auf diesen Gesichtsausdruck gewartet, den er aus Sitzungen mit Betroffenen so gut kannte. Ein intensives, verzweifeltes Flehen um Rettung in den Augen, ein Zittern, ein Gehetztsein, Zeichen der Hilfsbedürftigkeit. Ein Griff an die bebenden Lippen, der die Worte Lügen strafte, mit denen man der neuen Gruppierung Treue schwor, eine winzige Geste, mit der die schweren Anwürfe gegen den Vater, die unglaublichen Vorhaltungen entkräftet würden.
Nichts davon.
So sehr er auch beobachtete, er entdeckte nur Kraft und Entschlossenheit, gute Balance. Geschäftsmäßiger Austausch. Marlon hatte Überzeugung ausgestrahlt, saß dem Vater selbstbewusst in der Funktion eines Managers der »Familie der Erleuchteten« gegenüber.
Ratlos fahndete der Vater nach Schatten, die dem Rücken Marlons folgten; als der junge Mann das Restaurant verließ, musste erkennen, dass es keine gab.
Dr. Wendler spürte mit professioneller Sicherheit, wenn eine Sache aussichtslos war.
Er konnte nur die Segel streichen
Desillusioniert kehrte er zu seinem Workshop nach Quantico zurück. Wenig später dann nach Berlin.
In die Wohnung, in der niemand mehr auf ihn wartete, die er mit niemandem mehr teilen würde. Die überdimensioniert schien, ein Labyrinth, in dem ein Verlaufen jederzeit möglich war. Schloss die Tür hinter sich, ging nicht ans Telefon, checkte keine Mails. Öffnete die erste Flasche Brandy. Weitere folgten.
Die Welt sollte ihn in Ruhe lassen!
Er wollte mit ihr auch nichts mehr zu tun haben.
Ein Psychiater, der nicht einmal sich selbst helfen konnte, wie wäre der dann anderen auch nur ein guter Ratgeber? Nach der ersten Düsternis zog das emotionale Dauergrau in sein Denken ein. Fatalismus. Dr. Wendler verlor sich in Selbstmitleid. Ja, das diagnostizierte er wohl – konnte oder wollte nichts dagegen tun – gab sich ganz dem Gefühl der vollkommenen Nutzlosigkeit und des Versagthabens hin.
Mied jeden nachbarschaftlichen Kontakt.
Zum Einkaufen huschte er schattengleich die Straße entlang. Metzger, Bäcker, Apotheke, Supermarkt – alles nur wenige Schritte weit entfernt.
Schloßstraße.
Jedes Ziel fußläufig erreichbar.
In den ersten Tagen nach seiner Heimkehr hatte er eine Mail an Marlon begonnen.
»Lieber Marlon, was soll ich tun? Ich war die längste Zeit meines Lebens Psychiater, kürzere Zeit Ehemann und noch kürzere Zeit Vater. Es tut mir leid, wenn du meinst, ich wäre ein schlechtes Exemplar gewesen. Ich fürchte, deinem Wunsch, mich zu melden, wenn ich nur noch Vater sein will, kann ich weder jetzt noch in Zukunft entsprechen – vermutlich weiß ich gar nicht, wer ich bin, wenn ich den Psychiater ablege. Wahrscheinlicher ist, dass ich es ohnehin nicht kann. Aber vielleicht kommst du mir ein bisschen entgegen und wir können dennoch …« An dieser Stelle hatte er das Tippen beendet. Die Mail nicht verschickt. Sie wartete im Ordner »Entwürfe«. Würde wohl nie auf den Weg gebracht.
Sie klang zu sehr nach unwürdigem Gebettel um Zuwendung, nach einer Entschuldigung für sein eigenes Sein ganz allgemein.
Und so weit war er noch nicht.
Nicht ganz jedenfalls.
Weihnachten. Die Nagelprobe. Kein Fernsehen, keine Gäste, kein Braten, kein Baum und – keine Familie.
Alleinsein war scheiße!
Abgeliebtsein noch schlimmer.
Er beschloss, es zu wagen. Erst wieder mal duschen, saubere Kleidung anziehen und dann im Blue Cube testen, wie gut er mit Jingle Bells und als Weihnachtsmänner verkleideten Studenten klarkäme. Im schlimmsten Fall gar nicht.
Ob Marlon wohl zur Beisetzung seines Vaters oder sogar der des forensischen Psychiaters nach Deutschland reisen würde?