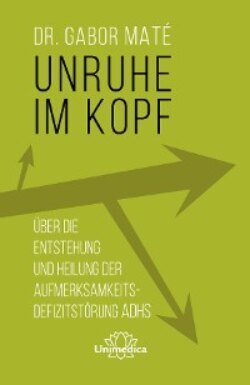Читать книгу Unruhe im Kopf - Gabor Mate - Страница 12
KAPITEL 4 Eine konfliktreiche Ehe: ADHS und die Familie (I)
ОглавлениеKennzeichnend für eine konfliktreiche Ehe ist, dass Mann und Frau wütend und mit dem anderen nicht zufrieden sind. Die Stimmung in konfliktgeladenen Beziehungen ist zwar die meiste Zeit über intensiv negativ, wird aber in der Regel von Zeiten ebenfalls intensiver, manchmal sehr leidenschaftlicher Nähe unterbrochen. Konflikte können zur Sucht werden. Dies ist sowohl eine vertraute Situation als auch eine eindrückliche Erinnerung daran, wie stark Menschen miteinander verflochten sind. Menschen suchen nicht nach Streit, haben aber keinen anderen Weg der Interaktion gefunden.
—DR. MICHAEL E. KERR
Family Evaluation
Meine Frau Rae und ich haben drei Kinder: zwei Söhne, heute 23 und 20 Jahre alt, und eine zehnjährige Tochter. Bei allen drei Kindern wurde ADHS diagnostiziert, genau wie bei mir.
Unsere Familie könnte fast als Paradebeispiel für das genetische Argument dienen: Ein finanziell gesichertes, krisenfestes und seit fast 30 Jahren verheiratetes Paar der Mittelklasse, das sich und seine Kinder liebt. Es gibt weder Alkoholismus noch Drogenabhängigkeit, keine Gewalt in der Familie und keinen Missbrauch. Wenn diese Kinder eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben, dann muss es einfach an ihren Genen liegen. Was an dieser Umgebung könnte ADHS verursacht haben?
Die Umgebung ist ebenso wenig die Ursache von ADHS, wie die Gene die Ursache sind. Hier trifft bestimmtes Genmaterial auf eine bestimmte Umgebung und ADHS kann dann die Folge sein. Ohne dieses Genmaterial keine ADHS. Ohne diese Umgebung keine ADHS. Die nachhaltig prägende Umgebung ist die Herkunftsfamilie.
Was unsere Ehe betrifft, so war sie fest an dem Ende des Spektrums verankert, das man als „konfliktreich“ bezeichnen kann. Wir haben viele Probleme bewältigt, aber es hat Jahrzehnte gedauert und eine Menge Energie gekostet. Im Rückblick schrecken wir davor zurück, wie verletzend und dunkel es sich zeitweise angefühlt hat, und vor allem, wie unsere Streitereien das Leben unserer Kinder belastet haben.
Heute feiern wir unsere Ehe. Unsere Schiffe, die bei schwerem Seegang herumgeschleudert und herumgeworfen wurden, sind endlich sicher im selben Hafen angekommen. Aber die Stürme haben von unseren Kindern ihren Tribut gefordert. Am Ende seines herrlich freimütigen Essays My Own Marriage (dt.: „Meine eigene Ehe“) schrieb der bedeutende US-amerikanische Psychotherapeut und Lehrer Carl Rogers über die Schwierigkeiten, die seine erwachsenen Kinder in ihren Beziehungen hatten. „Die Tatsache, dass wir uns als Paar zusammengerauft haben und eine für uns befriedigende Beziehung führen“, fasste er zusammen, „war keine Garantie für unsere Kinder.“ Kinder sind für Eltern ein wunderbarer Ansporn und Antrieb, etwas über sich selbst, über den anderen und über das Leben selbst zu lernen. Unglücklicherweise kann ein Großteil des Lernens auf deren Kosten gehen.
Von einem Mangel an Liebe war in unserer Familie nie die Rede. Aber die Liebe, die die Eltern fühlen, bedeutet nicht unbedingt, dass diese Liebe auch von dem Kind gefühlt wird. Die Atmosphäre bei uns zu Hause war häufig von einem offenen oder unterdrückten Konflikt zwischen den Eltern geprägt, von enttäuschten Erwartungen auf beiden Seiten und von tiefen Ängsten, derer wir uns nicht einmal bewusst waren.
Meine Frustrationen über das Leben konnten ohne jede Vorwarnung in Form von Wutausbrüchen oder kalten Rückzügen über Rae oder direkt über die Kinder hereinbrechen. Ich konnte relativ fremden Menschen gegenüber äußerst mitfühlend und hilfreich sein, den Menschen aber, die mir am nächsten stehen, auf der einen Seite liebevolle Unterstützung und auf der anderen Seite feindselige Ablehnung entgegenbringen. Nirgendwo äußerte ich meine Ängste und ungelösten Spannungen – das heißt, meinen ungelösten Kummer – so offen und verletzend wie in meinem eigenen Heim.
Als meine Kinder noch klein waren, ging es mir nur in meiner Rolle als superaktiver und gefragter Arzt gut. Neben meinen beruflichen Aufgaben habe ich mich häufig gleichzeitig auch um andere äußerst anspruchsvolle Projekte gekümmert. Ich trug meinen Beeper wie eine Auszeichnung mit mir herum. Vor allem in den ersten Jahren hoffte ich, er würde sich melden, damit andere Menschen sehen konnten, wie wichtig ich war. Ich habe vielleicht in jeder einzelnen meiner Aktivitäten Befriedigung gefunden, war aber nie mit mir oder meinem Leben zufrieden. Ich hatte große Schwierigkeiten, irgendwelche neuen Aufgaben abzulehnen – bis auf das, was ich zu Hause erledigen sollte. Wenn ich um Hilfe gebeten wurde, war es mir nahezu unmöglich, Nein zu sagen, egal was dies für mein persönliches Leben bedeutete. Indem ich dieses überdrehte Verantwortungsgefühl anderen gegenüber akzeptierte, vernachlässigte ich meine Verantwortung gegenüber den einzigen Menschen, für die ich wirklich unverzichtbar war. Dieses Pflichtgefühl gegenüber der ganzen Welt beschränkt sich nicht auf ADHS, ist aber typisch dafür. Es gibt niemanden mit ADHS, der es nicht hat.
Es wäre zu mühsam, die verschiedenen Aktivitäten auch nur aufzulisten, denen ich nachgegangen bin, als ich mir meiner ADHS-Muster vor vier Jahren zum ersten Mal bewusst wurde. Neben meiner anstrengenden Praxistätigkeit, meiner Arbeit in der Geburtshilfe und der psychologischen Beratung von Patienten war ich medizinischer Koordinator der Palliativstation des Vancouver Hospital, einer der größten Hospizeinrichtungen Kanadas. Außer im Urlaub hatte ich fünf Jahre lang fast jede Nacht und jedes Wochenende Bereitschaftsdienst auf der Palliativstation. Jeden Moment konnte ich gerufen werden, um bei einer Entbindung dabei zu sein oder um mich um einen unheilbar kranken Menschen zu kümmern. Hinzu kam noch, dass ich wöchentlich eine medizinische Kolumne für die Zeitung The Globe and Mail schrieb. Und damit es auch etwas gab, was ich in meiner Freizeit tun konnte, stellte ich Recherchen für ein Buch an, das ich – in typischer ADHS-Manier – wie eine heiße Kartoffel fallen ließ, sobald die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mein Interesse geweckt hatte.
So kann man nicht leben und nicht zu den Betroffenen gehören. Ich war ständig unterwegs und hinkte meinem Zeitplan immer hinterher. Meine Zeitungskolumnen schrieb ich spät nachts, kurz vor dem Abgabetermin. Meine Praxis war immer voller Patienten, die viel zu lange warten mussten. Ich vergaß mehr oder weniger, dass meine hektische, getriebene Arbeitsweise bedeutete, dass andere ihre Arbeitsabläufe anpassen und ändern mussten, worüber ich offiziell nie mit ihnen verhandelt hatte. Die Krankenschwestern auf der Palliativstation, zu denen ich eine auf Gegenseitigkeit beruhende respektvolle und herzliche Beziehung hatte, sagten, die Arbeit mit mir gleiche der Arbeit im Zentrum eines Tornados. Maria Oliverio, die Krankenschwester in meiner Praxis – die irgendwann den Friedensnobelpreis gewinnen sollte –, ging auf ihre eigene effiziente, stille und ruhige Art die Wände hoch. Die Menschen empfanden mich als angespannt, drängend, beharrlich.
Die Folgen dieses kamikazeähnlichen Balanceakts für meine Familie waren verheerend. Auf Raes Schultern lastete die gesamte Verantwortung der Organisation und Betreuung nicht nur unseres Heims, sondern der Familie selbst. Ohne jegliche Diskussion oder bewusste Entscheidung wurde sie in die Rolle des emotionalen Dreh- und Angelpunktes der Familie gedrängt. Sie fühlte sich allein gelassen. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass ich ihre eigene Berufung als Malerin für zweitrangig hielt.
Hinzu kam, was ich die „Wochenendverzweiflung“ der Getriebenen nenne. Jeden Samstagmorgen kam der Absturz. In einer Hülle aus entkräfteter Lethargie versteckte ich mich hinter einem Buch oder einer Zeitung oder starrte missmutig aus dem Fenster. Ich war nicht nur erschöpft von der turbulenten Woche, sondern wusste auch nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ohne den Adrenalinrausch an den Wochentagen konnte ich mich nicht konzentrieren, war ziellos und ohne Energie. Ich fühlte mich ausgelaugt, war reizbar und weder aktiv noch fähig, mich auszuruhen.
Rae war verletzt, verunsichert und wütend. Sie zog sich emotional zurück. Ein Teufelskreis hatte sich geschlossen, als meine eigene Angst und Wut, verlassen zu werden, ins Spiel kamen. In diesem Gemütszustand haben wir unsere Kinder erzogen.
Kleine Kinder können die Motive Erwachsener unmöglich verstehen. Einem kleinen Kind bedeutet es nicht viel, dass es von einem Elternteil geliebt wird, wenn dieser Elternteil immer wieder verschwindet und fast nie zu Hause ist. Das Kind erfährt ein Gefühl der Verlassenheit, ein unterschwelliges Wissen, dass es Dinge in der Welt gibt, die für den Elternteil viel wichtiger sind als es selbst und dass es die Aufmerksamkeit des Elternteils nicht verdient. Es bekommt, zunächst unbewusst, immer mehr das Gefühl, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung sein muss. Darüber hinaus fängt es an, sich mehr und mehr um die Befriedigung seiner Bedürfnisse zu bemühen: Es fordert Kontakt, verhält sich auffällig oder versucht, dem Elternteil zu gefallen, um Zustimmung und Aufmerksamkeit zu bekommen.
Natürlich hatten wir auch viele gute Zeiten, in denen wir uns verbunden fühlten und unsere Kinder die Wärme unserer gegenseitigen Liebe spüren konnten. Unsere Fotoalben sind randvoll mit glücklichen Erinnerungen. Aber es gab oft genug harte Zeiten, in denen es schwer für die Kinder war, ein Gefühl der Sicherheit zu entwickeln. Das emotionale Klima war zu unvorhersehbar und verwirrend.
Die meiste Zeit über war ich nicht nur physisch abwesend, sondern hatte auch Schwierigkeiten, mich auf den jeweiligen Augenblick zu konzentrieren. Kleine Kinder leben vollständig in der Gefühlswelt der rechten Gehirnhälfte des Hier und Jetzt, genau dort, wo ich mich am wenigsten wohlfühlte. Meine auf der ADHS beruhende Abgelenktheit und Geistesabwesenheit sahen so aus, dass ich durchaus dazu fähig war, einem meiner Söhne oder meiner Tochter eine Geschichte vorzulesen, ohne ein Wort davon wirklich aufzunehmen und mich dabei in Gedanken oder Fantasien zu verlieren. Wenn das Kind mir dann eine Frage zu der Geschichte stellte, die ich gerade vorgelesen hatte, konnte ich nicht antworten. Selbst ohne solche Beweise können Kinder die Nichtpräsenz des Elternteils spüren. Sie leiden darunter.
Einige der stressigsten Zeiten für uns waren zwei von Raes Schwangerschaften und die ersten Lebensjahre unserer Kinder. Als eines unserer Kinder zwölf Monate alt war, durchlebte Rae eine ausgewachsene klinische Depression. In der schlimmsten Zeit schlief sie nur wenig und konnte den körperlichen Anforderungen der Elternschaft kaum gerecht werden. Ihr war schmerzlich bewusst, dass sie dem Kind nicht die emotionale Nähe geben konnte, die es brauchte, und war gleichzeitig völlig hilflos. Viele Monate lang wurde bei ihr weder eine Depression diagnostiziert noch wurde sie angemessen versorgt. Zu diesem Versäumnis kam es vermutlich, weil sie die Frau eines Arztes war – übrigens keine Seltenheit. Ich selbst war ihr zu nahe, zu bedroht von dem, was geschah, zu stark in das Geschehen verstrickt, um klar sehen zu können.
Es gibt Dinge, von denen ich wünschte, sie in den ersten Lebensjahren meiner Kinder nicht getan zu haben, aber am meisten bedauere ich, was ich nicht getan habe: meinen Kindern eine aufmerksame, sichere und verlässliche elterliche Präsenz zu schenken. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich Entspannung finden und mich von den Zwängen, die mich getrieben haben, befreien kann, um diese wunderbaren kleinen Menschen, die sie waren, in vollen Zügen genießen zu können.
Das, was ich hier geschrieben habe, erweckt vielleicht den Anschein, ich würde mich als den Schurken des Stückes sehen, wenn es um unsere Familie geht. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht meine Absicht, über mich selbst oder irgendjemand sonst ein Urteil zu fällen. Zum einen war mein Beitrag nur für die Hälfte der Anspannung zwischen Rae und mir verantwortlich. Wie ich in einem späteren Kapitel über Beziehungen erörtern werde, wählen Menschen ihren Partner mit einem untrüglichen Instinkt aus. Sie wollen die eine Person finden, die genau dem Ausmaß ihrer unbewussten Ängste entspricht und ihre eigenen Funktionsstörungen widerspiegelt. Und die für sie all ihren ungelösten emotionalen Schmerz entfesseln wird. Das traf auf uns beide sicherlich zu. Zweitens geht es mir nicht um Urteile oder Schuldzuweisungen. Mir geht es darum zu verstehen. Im Rückblick können Rae und ich erkennen, dass in all diesen Jahren ein folgerichtiger Prozess zwischen uns stattgefunden hat. Angesichts dessen, was wir wussten, wer wir waren und was jeder von uns in unsere Ehe mitbrachte, musste alles so geschehen, wie es geschehen ist. Es trifft auch zu, dass wir unseren Kindern das Beste gegeben haben, was uns zur Verfügung stand, und dass wir dies auch weiterhin tun.
Nichts von dieser persönlichen Geschichte wäre von Interesse, wenn es sich einfach nur um eine einzelne Geschichte über die emotionalen Bemühungen einer Familie handeln würde. Dem ist nicht so. In nahezu jeder der Familien, denen ich begegnet bin und in denen ein Kind ADHS hatte, gab es Geschichten wie diese, die sich zwar in den Einzelheiten unterscheiden, aber ähnlich voller Spannung und Stress sind. Während sich die meisten Eltern in den ersten Lebensjahren ihres Kindes der Belastungen bewusst sind, berichten einige von ihnen auch, dass die Monate, in denen ihr ADHS-Kind ein Säugling und Kleinkind war, für sie eine Zeit des reinen Glücks war. In der weiteren Diskussion geben sie in der Regel zu, dass die glücklichen Zeiten von erheblichen Belastungen durchmischt waren, die sie zunächst nicht als solche erkannt haben. Tatsache ist, dass wir in dieser Gesellschaft oft ziemlich weit von unserer eigenen emotionalen Realität entfernt sind. (Eine weitere Diskussion über Familien aus Erwachsenen und Kindern mit ADHS finden Sie in Kapitel 12.) Ich glaube, dass in genau diesen Belastungen, die die Eltern erleben, obwohl sie den festen Willen haben, das Beste für ihre Kinder zu tun, die Umgebungsursachen des Aufmerksamkeitsdefizits zu finden sind. Auch die bereits existierenden Forschungsdaten unterstützen diese Sichtweise, selbst wenn nicht alle Forscher oder Wissenschaftler aus den ihnen vorliegenden Belegen die gleichen Schlussfolgerungen gezogen haben. Wir werden uns mit diesem Thema beschäftigen, nachdem wir untersucht haben, wie das faszinierende Zusammenspiel von Erbanlagen und frühkindlichen Erfahrungen die Entwicklung des menschlichen Gehirns prägt.