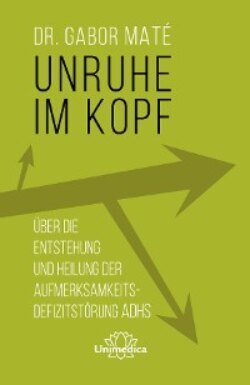Читать книгу Unruhe im Kopf - Gabor Mate - Страница 17
KAPITEL 8 Eine surrealistische Choreographie
ОглавлениеEine der auffälligsten Besonderheiten des menschlichen Gehirns ist die außergewöhnlich große Entwicklung der Frontallappen – bei anderen Primaten sind sie viel weniger entwickelt und bei allen anderen Säugetieren kaum sichtbar. Sie sind der Teil des Gehirns, der sich nach der Geburt am stärksten entwickelt und am meisten wächst.
—DR. OLIVER SACKS
Eine Anthropologin auf dem Mars
Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Gebilde im gesamten Universum. In ihm gibt es zwischen 50 und 100 Milliarden Nervenzellen, oder Neuronen, die sich jeweils verzweigt haben, um Tausende möglicher Verbindungen mit anderen Nervenzellen zu bilden. Man schätzt, dass die Nervenfasern eines einzigen menschlichen Gehirns, würde man sie aneinanderlegen, eine mehrere tausend Kilometer lange Strecke ergeben würden. Die Gesamtzahl der Verbindungen, oder Synapsen, beläuft sich auf mehrere Billionen.1 Die parallel und gleichzeitig verlaufende Aktivität von unzähligen Schaltkreisen im Gehirn sowie Netzwerken von Schaltkreisen erzeugt in jeder Sekunde unseres Lebens Millionen von Impulsmustern. Das Gehirn wurde sehr treffend als „Supersystem der Systeme“ bezeichnet. Selbst wenn die gesamte Hälfte der grob zweihunderttausend Gene im menschlichen Organismus für das zentrale Nervensystem vorgesehen ist, kann der genetische Code einfach nicht genug Informationen enthalten, um die unbegrenzte Anzahl möglicher Gehirnschaltkreise vorherzubestimmen. Allein aus diesem Grund kann die biologische Vererbung allein nicht für die eng miteinander verknüpfte Psychologie und Neurophysiologie bei einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung verantwortlich sein.
Die Erfahrungen in der Welt bestimmen die feine Vernetzung des Gehirns. Der Neurologe und Neurowissenschaftler Antonio Damasio hat es so ausgedrückt: „Ein großer Teil jedes Schaltkreises im Gehirn ist zu jedem Zeitpunkt des Erwachsenenlebens individuell und einzigartig und spiegelt die Geschichte und die Gegebenheiten dieses speziellen Organismus wider.“2 Dies gilt auch für Kinder und Kleinkinder. Nicht einmal in den Gehirnen genetisch identischer Zwillinge finden sich die gleichen Muster in Gestalt von Nervenzellen oder der Anzahl und Konfiguration ihrer Synapsen mit anderen Neuronen.
Die Mikroschaltkreise des Gehirns werden durch die Einflüsse während der ersten Lebensjahre formatiert, ein Zeitabschnitt, in dem das Gehirn erstaunlich rasch wächst. Fünf Sechstel der Verzweigungen von Nervenzellen im Gehirn finden nach der Geburt statt. Im ersten Lebensjahr werden neue Synapsen mit einer Geschwindigkeit von drei Milliarden pro Sekunde gebildet. Zu einem großen Teil bestimmen die individuellen Erfahrungen jedes Kleinkindes in den ersten Jahren, welche Gehirnstrukturen sich wie gut entwickeln werden und welche Nervenzentren mit welchen anderen Nervenzentren verbunden werden. Diese Erfahrungen bauen die Netzwerke auf, die das Verhalten kontrollieren.3 Die kompliziert programmierten Interaktionen zwischen den Erbanlagen und der Umgebung, die die Entwicklung des menschlichen Gehirns darstellen, werden bestimmt durch „eine fantastische, nahezu surrealistisch komplexe Choreografie“, wie es J. S. Grotstein von der Abteilung für Psychiatrie am UCLA treffend formuliert hat. Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung ist das Resultat einer Fehlvernetzung der Gehirnschaltkreise bei anfälligen Kleinkindern in dieser entscheidenden Wachstumsphase.
Von allen Säugetieren hat der Mensch bei der Geburt das am schwächsten ausgereifte Gehirn. Andere Tiere erledigen bereits früh in ihrem Leben Aufgaben, zu deren Ausführung Menschen erst nach vielen Monaten fähig sind. Ein Pferd kann am Tag seiner Geburt bereits laufen. Affenkinder können sich schon wenige Wochen nach der Geburt an das Fell ihrer Mutter klammern. Ein Menschenkind kann erst gegen Ende seines ersten Lebensjahres die für vergleichbare Aktivitäten erforderlichen visuellen Fähigkeiten, Muskelkontrolle, Gleichgewicht und Orientierung im Raum koordinieren.
In der Zeit nach der Geburt wächst das menschliche Gehirn, anders als das unserer engsten evolutionären Verwandten, der Schimpansen, mit der gleichen Geschwindigkeit weiter wie im Mutterleib. Während sich die Größe des Schimpansengehirns von der Geburt bis zum Erwachsenenalter nicht mehr als verdoppeln wird, hat sich die Gehirnmasse des Menschen im Alter von vier Jahren bereits verdreifacht. Bis zum Erwachsenenalter hat sich die Größe unseres Gehirns vervierfacht, was bedeutet, dass drei Viertel des Wachstums unseres Gehirns außerhalb des Mutterleibs nach der Geburt stattfinden und davon wiederum der größte Teil in den ersten Jahren.
Man kann dies als einen von der Natur ausgehandelten Kompromiss betrachten. Wir haben die Möglichkeit des aufrechten Gangs bekommen, während sich gleichzeitig unsere Vordergliedmaßen zu Armen und Händen entwickelten, die zu vielen schwierigen und komplizierten Aktivitäten fähig sind – eine Entwicklung, die den Impuls zu einer großen Ausdehnung des Gehirns und insbesondere der Frontallappen gab. Diese Frontallappen koordinieren die Bewegungen der Hände. Sie sind außerdem zuständig für die Problemlösung sowie für die sozialen und sprachlichen Fähigkeiten, die die Menschheit dazu befähigt haben, in vielen unterschiedlichen Lebensräumen zu leben. Wenn wir mit einer aufgrund unserer Erbanlagen starr festgelegten Vernetzung auf die Welt kommen würden, wären die Frontallappen weitaus weniger fähig zu lernen und sich an die vielen möglichen unterschiedlichen Umgebungen anzupassen, in denen Menschen leben.
Das menschliche Becken musste sich verengen, um unseren aufrechten Gang zu erleichtern, sodass ein länger als neun Monate andauerndes Wachstum im Mutterleib zu Säuglingen geführt hätte, die für eine sichere Geburt zu groß gewesen wären. Bereits gegen Ende der neunmonatigen Schwangerschaft ist der Kopf der größte Teil des Körpers, derjenige, der am ehesten auf dem Weg durch den Geburtskanal stecken bleiben kann. Im Gegenzug mussten sich unsere evolutionären Vorfahren damit zufriedengeben, dass sich das ungeheuer große menschliche Gehirn außerhalb der relativ sicheren Umgebung des Mutterleibs entwickeln muss, wo es außerordentlich anfällig für potenziell widrige Umstände ist.
Den neuesten Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaften zufolge impliziert die Gehirnentwicklung beim menschlichen Säugling einen Konkurrenzkampf, der als „neuronaler Darwinismus“ beschrieben wurde.4 Nervenzellen, Schaltkreise, Netzwerke und Netzwerksysteme wetteifern miteinander ums Überleben. Die Neuronen und Verbindungen, die für das Überleben des Organismus in einer bestimmten Umgebung am nützlichsten sind, werden aufrechterhalten. Andere verkümmern und sterben ab. Nervenbahnen, die nicht über die vollständigen Wachstumsvoraussetzungen verfügen, werden sich überhaupt nicht oder nur defekt oder unvollständig entwickeln. Die Vorräte an Neurochemikalien, die zu wenig genutzt werden, werden kleiner, und die Fähigkeit des Gehirns, diese herzustellen, nimmt ab. Durch die Eliminierung ungenutzter Zellen und Synapsen und durch die Bildung neuer, durch die Umgebung begünstigter Zellen entwickeln sich nach und nach spezialisierte Schaltkreise, die für die zahlreichen unterschiedlichen Aktivitäten des menschlichen Gehirns zuständig sind.
Neuronaler Darwinismus bedeutet, dass unser genetisches Potenzial für die Gehirnentwicklung nur unter günstigen Bedingungen voll ausgeschöpft werden kann. Um dies besser zu verstehen, müssen wir uns nur einen Säugling vorstellen, der in einem dunklen Raum leben muss. Er wird auf den Arm genommen, gefüttert und für sein körperliches Wohlbefinden wird gesorgt, aber niemand spricht mit ihm. Nach einem Jahr derartiger Entbehrungen wäre das Gehirn dieses Kleinkindes nicht mit dem Gehirn anderer Kleinkinder vergleichbar, unabhängig davon, welches Potenzial es geerbt hat. Trotz uneingeschränkt guter Augen bei der Geburt und gesunder Nerven, die visuelle Bilder an das Gehirn weiterleiten, würden sich die ungefähr 30 neurologischen Einheiten, die zusammengenommen die visuelle Wahrnehmung ausmachen, nicht entwickeln. Selbst die bei der Geburt vorhandenen neurologischen Komponenten des Sehvermögens würden verkümmern und nutzlos werden, wenn dieses Kind etwa fünf Jahre lang kein Licht gesehen hat. Irreversible Blindheit wäre die Folge. Wenn wir das Kind in den ersten zehn Jahren mit Stille umgeben würden, wäre es nie in der Lage, das Sprechen zu lernen. Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung ist darüber hinaus ein Beispiel dafür, wie die neuronalen Schaltkreise und die Biochemie des Gehirns an einer optimalen Entwicklung gehindert werden können, wenn entsprechende Eingaben aus der Umgebung gestört werden. Und wie sehen dann die optimalen Bedingungen für eine umfassende Entwicklung des Gehirns aus?
Die drei Bedingungen, ohne die ein gesundes Wachstum nicht stattfinden kann, können in der Matrix des Mutterleibes als selbstverständlich angesehen werden: Ernährung, eine physisch sichere Umgebung und die ununterbrochene Beziehung zu einem sicheren, immer gegenwärtigen mütterlichen Organismus. Das Wort Matrix stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Gebärmutter“. Die Gebärmutter ist die Mutter und in vielerlei Hinsicht bleibt die Mutter die Gebärmutter, selbst nach der Geburt. In der Umgebung der Gebärmutter ist vonseiten des heranwachsenden Kindes für die Befriedigung seiner Bedürfnisse keine Aktion oder Reaktion erforderlich. Das Leben im Mutterleib ist ohne Zweifel der Prototyp eines Lebens im Garten Eden, wo es an nichts mangeln kann und nichts erarbeitet werden muss. Wenn es kein Bewusstsein gibt – wir haben noch nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen –, dann gibt es auch keine Entbehrungen oder Angst.
Außer unter Bedingungen größter Armut, die in Industrieländern ungewöhnlich, wenn auch nicht unbekannt sind, werden die Bedürfnisse von Kleinkindern in Bezug auf Nahrung und Unterkunft mehr oder weniger befriedigt. Die dritte grundlegende Voraussetzung, eine sichere, geborgene und nicht übermäßig belastete emotionale Atmosphäre, ist diejenige, die in westlichen Gesellschaften am ehesten beeinträchtigt sein kann.
Der Säugling besitzt nicht die Fähigkeit, bald nach der Geburt dem Elternteil zu folgen oder sich an ihn zu hängen, und ist auch sonst in vielerlei Hinsicht neurologisch und biochemisch unterentwickelt. Die ersten neun Monate des Lebens außerhalb der Gebärmutter scheint die Natur als zweiten Teil der Schwangerschaft vorgesehen zu haben. Der Anthropologe Ashley Montagu hat diese Phase als Exterogestation bezeichnet, das heißt, als Reifung außerhalb des Mutterleibes.5 Während dieser Zeitspanne muss die Sicherheit der Gebärmutter durch die fürsorgliche Umgebung der Eltern gewährleistet sein. Damit das Gehirn und das Nervensystem weiterhin reifen können – bei anderen Spezies findet dies im Uterus statt –, muss die Bindung, die bis zur Geburt direkt physisch war, jetzt sowohl auf physischer als auch auf emotionaler Ebene fortgesetzt werden. Die elterliche Umgebung muss den Säugling physisch und psychisch so sicher halten, wie er von der Gebärmutter gehalten wurde.
Für die zweiten neun Monate der Reifung außerhalb der Gebärmutter hat die Natur quasi einen Ersatz für die direkte Verbindung über die Nabelschnur vorgesehen: das Stillen. Abgesehen von dem unersetzlichen Nährwert und dem Immunschutz, den die Muttermilch dem Säugling bietet, dient die Stillphase als Übergangsstadium von der ununterbrochenen körperlichen Verbindung zur völligen Trennung vom Körper der Mutter. Der Säugling ist jetzt zwar nicht mehr in der Gebärmutter, wird aber dennoch in der Wärme des Körpers der Mutter gehalten, von dem er weiterhin seine Nahrung erhält. Darüber hinaus vertieft das Stillen das mütterliche Gefühl der Verbundenheit mit dem Baby und verbessert damit die emotional symbiotische Bindung. Ohne Zweifel hat die Tatsache, dass vor allem in Nordamerika immer weniger gestillt wird, dazu beigetragen, dass die emotionalen Unsicherheiten in den Industrieländern so weit verbreitet sind.
Emotionale Sicherheit und Wärme in der Umgebung des Kleinkindes sind sogar noch wichtiger für eine gesunde Entwicklung des Gehirns als das Stillen. Diese Sicherheit ist nicht auf die Liebe und die bestmöglichen Absichten der Eltern reduziert. Sie hängt ebenso von einer weniger kontrollierbaren Variable ab: der Freiheit der Eltern von Belastungen, die das psychische Gleichgewicht untergraben können. Ein friedliches und beständiges emotionales Milieu während der gesamten Kindheit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vernetzung der neurophysiologischen Schaltkreise der Selbstregulation. Wird dieses Milieu beeinträchtigt, wie es in unserer Gesellschaft häufig der Fall ist, wirkt sich das negativ auf die Entwicklung des Gehirns aus. ADHS ist eine der möglichen Konsequenzen.