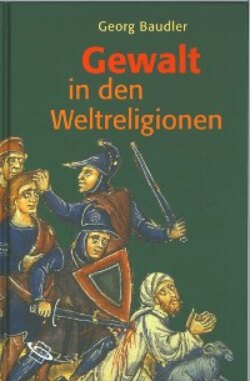Читать книгу Gewalt in den Weltreligionen - Georg Baudler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Mutter-Kind-Beziehung
ОглавлениеDer älteste Anspruch der Wirklichkeit, der auch zur Entstehung des spezifisch menschlichen Denkens und Fühlens geführt hat, entstammt sehr wahrscheinlich der Mutter-Kind-Beziehung. Das Kind war für die Mutter und die Mutter war für das Kind die wichtigste, sie emotional am stärksten ansprechende Wirklichkeit. In der von Raubtieren bevölkerten Savanne ein noch völlig hilfloses Kind zu gebären, zu ernähren und großzuziehen, war eine Aufgabe, deren Mühe und Schwierigkeit für uns heutige Menschen kaum mehr vorstellbar sind, insbesondere wenn man bedenkt, dass das menschenartige Wesen weder mit Hörnern oder Reißzähnen ausgestattet, noch zu einer so schnellen Flucht fähig war wie eine Antilope oder ein Zebra. Die amerikanische Paläoanthropologin Nancy Makepeace Tanner, die viele Jahre lang selbst Feldforschungen durchführte, hat detailliert die Lebensumstände dieser frühen Hominiden erforscht und die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung für die Entstehung des Menschen beschrieben.5 Es ist kennzeichnend für die Gewaltverhaftetheit und die Gewaltfaszination unserer Gesellschaft, dass die Interpretation der Vormensch-Funde in Südafrika, wie sie Raymund Dart6 gegeben hat – der Vormensch als brutal-gewaltiger „Killeraffe“ –, eine breite Resonanz in den Medien gefunden hat und noch heute das Bewusstsein vieler Menschen prägt. Das Menschsein hat sich nach dieser Vorstellung einbahnig durch eine immer stärkere Verfeinerung der Jagdwerkzeuge und Jagdmethoden ergeben. Wenig später wurde indes klar, dass Dart die Knochenfunde falsch interpretiert hatte. Das häufige Zusammentreffen von Hominiden- und Raubtierknochen weist nicht darauf hin, dass diese frühen Hominiden schon Raubtiere gejagt haben, sondern umgekehrt darauf, dass sie Beute der Raubtiere geworden sind. Der Australopithecus, aus dem heraus sich der Mensch entwickelt hat, war kein gewaltiger Jäger, sondern ein Sammler und Aasesser, der für Raubtiere leicht erjagbar war. Diese Sammeltätigkeit, zu der auch das Aufsuchen von Fleischüberresten an den Fressplätzen der Raubtiere gehörte, war vor allem die Aufgabe der Frau, die nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kinder Nahrung herbeischaffen musste. Doch als Adrienne L. Zihlmann und Makepeace Tanner dem falschen Bild vom Man the Hunter das richtige Bild von der Frau als Sammlerin – Woman the Gatherer – gegenüberstellten, wurde dies nur von feministischen Kreisen hauptsächlich in Amerika beachtet. Dass man in allen bisherigen Evolutionstheorien den Anteil der Frau vergessen hatte, führte zu keinen Schlagzeilen in der Presse.
Dabei ist genau hier das Terrain, wo jener Rubikon verläuft, jener Grenzfluss, an dem sich das Leben zum Menschsein hin öffnet.7 Gewiss kann alles, was dem Menschen in seiner Welt begegnet, für ihn eine symbolische, Sterblichkeit und Tod transzendierende Bedeutung bekommen. Aber es ist naheliegend, dass für das Kind die Mutter und für die Mutter das Kind stärker noch als Steine, Bäume, Tiere und Wolken eine symbolische, das bloß Gegenständliche transzendierende Bedeutung ausstrahlen. Durch den aufrechten Gang des Australopithecus und die wachsende Gehirngröße bedingt, ist nicht nur das Menschenkind, sondern auch schon das Hominidenkind eine „biologische Frühgeburt“8. Die Zuwendung und Fürsorge der Mutter blieb auch noch nach der Geburt eine Art geistig-symbolischer „Uterus“, ohne den das Kind nicht leben konnte; und umgekehrt lenkt das kleine, hilflose Wesen, das die Mutter gebar, alle Kräfte und alle Aufmerksamkeit der Mutter auf sich und motiviert sie zu ihrem mütterlichen Handeln.
Von Anfang an ist dieses Handeln ein Kampf gegen den stets drohenden Tod und umgekehrt befreit die Fürsorge der Mutter das Kind von seiner kreatürlichen Einsamkeits- und Todesangst. Dieses Angehen gegen den Tod, das spätestens beim Neandertaler auch zu einem ausgebildeten Bestattungskult führt, überschreitet das instinkthafte, rein biologisch bedingte Verhalten in dem Augenblick und in dem Maße, als infolge der zunehmenden Intelligenz dem Hominiden die eigene Sterblichkeit, der Tod, als allenfalls aufschiebbare, aber nicht überwindbare Grenze aufgeht. Die Drohung des Todes – hauptsächlich durch das Gefressenwerden von einem Raubtier – ist für diese hoch entwickelten Lebewesen stets gegenwärtig. Deshalb hört für die Mutter ihre Sorge und Fürsorge für das Kind nicht mit dessen Erwachsenwerden auf. Die Aufmerksamkeit bleibt weiter auf es gerichtet; und umgekehrt spürt auch noch der erwachsene Hominide den Drang, sich bei Gefahr in die Fürsorge der Mutter zu flüchten. Auf diese Weise bewirkt die Wahrnehmung des Todes als bleibender Gefahr, dass Mutter und Kind lebenslang verbunden bleiben und sich lebenslang gegenseitig erkennen; ähnliches ist auch schon bei Schimpansen beobachtbar.
Auf diese Weise entsteht ein sich aufschaukelnder Regelkreis: Die bleibende Verbundenheit lässt den Tod der Mutter oder den Tod des Kindes immer als etwas erfahren, das in gewisser Weise den beobachtenden Hominiden selber trifft. Es ist nicht nur irgendein Lebewesen derselben Art und derselben Horde, das stirbt, sondern die Mutter bzw. das Kind als immer noch bleibender Teil der eigenen Existenz. Die Regelmäßigkeit, in der dieses Sterben erfahren wird, lässt die Absolutheit des Todes und damit die Sterblichkeit des eigenen Wesens aufdämmern. Auf diese Weise entsteht das nicht mehr zu verdrängende Bewusstsein, dass sowohl die Mutter wie auch das von der Mutter umsorgte Kind notwendig einmal sterben werden. Wenn trotz dieses Todesbewusstseins die Mutter unter Aufbietung aller ihrer Kräfte für das Kind sorgt und das Kind sich zur Mutter als dem Ort einer scheinbar absoluten Sicherheit flüchtet, dann bringt dieses Handeln eine neue Stufe des Bewusstseins zum Ausdruck, ein Bewusstsein, das den Tod als absolutes Ende negiert.
Dieses Bewusstsein, das vielleicht erst in Jahrmillionen in einen ausgeprägten Bestattungskult mündete, ist wahrscheinlich die früheste Form dessen, was Ulrich Lüke als „Transzendenzbewusstsein“ bezeichnet, in dem sich das Leben zum Menschsein hin öffnet.9 Versuche mit höheren Primaten, vor allem Schimpansen, zeigen, dass diese Lebewesen durchaus auch schon ein Ich-Bewusstsein besitzen. Sie können sich im Spiegel und auf dem Bildschirm selbst erkennen, ja sogar Abbildungen einzelner Körperteile ohne den übrigen Körper als zu ihnen gehörig identifizieren.10 Auch Werkzeuggebrauch und rudimentäre Werkzeugherstellung können schon bei Schimpansen beobachtet werden. Wenn Jane Goodall, die zwanzig Jahre lang in einem Reservat in Tansania das Leben wilder Schimpansen beobachtete, berichtet, dass auch hier die Mutter und ihre Kinder sich lebenslang erkennen und miteinander verbunden bleiben, und bei Schimpansenkindern hospitalismusähnliche Erscheinungen auftreten, wenn sie ihre Mutter verloren haben, dann scheint auch hier schon ein durch die Mutter-Kind-Beziehung gestiftetes Transzendenzbewusstsein aufzudämmern. Dies gilt besonders hinsichtlich ihrer Beobachtung, dass Schimpansenmütter ihr Kind, wenn es gestorben ist, oft noch tagelang mit sich herumtragen und Pflegehandlungen an ihm ausführen.11 Dieses auf einen späteren Bestattungsritus vorausweisende Verhalten – Pflege über den Tod hinaus – so zu interpretieren, als würden dabei nur „Gewohnheitsaktivitäten der Mutter langsam abklingen“12, ist unlogisch, weil dann bei weniger intelligenten Säugetieren dieses Verhalten auch oder sogar noch stärker zu beobachten sein müsste. Die höheren Primaten befinden sich vielmehr in einer Art Tier-Mensch-Übergangsfeld, das bei einer offenen, vom Menschen unbeeinflussten Evolution möglicherweise zu einer neuen Form von Menschwerdung führen könnte.13 Transzendenzbewusstsein, dieser Rubikon zum Menschsein, ist ein das Lebewesen umgreifendes und es in das Leben einbettende Todesbewusstsein. Die Mutter-Kind-Beziehung ist der Ort, wo dieses Bewusstsein aufwachen und sich festigen kann.
Die in allen frühen Religionen und Kulturen anzutreffenden Muttergottheiten und deren Mythen haben ihren Ursprung im transzendenten Anspruch der Mutter-Kind-Beziehung. Die Mutter ist für das Kind in den frühen Phasen unabweisbar ein Gottessymbol. Das Kind erfährt sich in allen seinen Lebensbezügen – Essen, Trinken, Schlafen, Sauberkeit, körperliches Wohlbefinden – an die Mutter verwiesen und von ihr abhängig. Wenn die Mutter oder der die Mutterfunktion übernehmende Vater als nicht unmittelbar anwesend erfahren werden, erwacht im Kind eine Angst vor der Einsamkeit und dem Alleinsein, die unbewusst eine Todesangst darstellt. Mutter und Vater sind für das Kind die Garanten des Lebens, des Heils und der Sicherheit. Wenn Kinder im Alter des Spracherwerbs abends im verdunkelten Raum einschlafen, wünschen sie Mutter oder Vater in zugewandter Nähe. Oft sprechen sie in dieser Situation litaneiartig den Mama-Namen aus (oder auch Mama-Papa), wahrscheinlich um sich mit dem Namen auch die Person zu vergegenwärtigen und in dieser Gegenwart die Angst vor dem Alleinsein zu überwinden. Solche Mama-Papa-Litaneien bilden die ersten Gebete eines Menschen. Denn die konkrete Mutter und der konkrete Vater können das Leben nicht garantieren. Sie werden vom Kind als Symbole eines absoluten Lebensschutzes angesprochen, d.h. als mütterliches Gottessymbol.
In Mutter und Vater lebt gegenüber dem kleinen Kind auch selbst ein starker unbewusster Drang, diese religiöse Symbolfunktion auszuüben. Der Religionssoziologe P. L. Berger sieht im Verhalten der ihr Kind tröstenden Mutter eine „Spur der Transzendenz“.14 Wenn die Mutter in dem bekannten Beispiel Bergers ihr ängstlich weinendes Kind in den Arm nimmt und schon allein durch diese Geste sagt: „Hab’ keine Angst, alles ist gut“, dann übt sie damit die „zeitlose Gebärde der Magna Mater“15 aus, wobei es gleichgültig ist, ob sie sich selbst als gläubige Christin oder als Atheistin und Agnostizistin versteht. Mit Recht fragt Berger angesichts dieser Geste: „Belügt die Mutter das Kind?“16 Die konkrete Frau weiß ja, dass sie trotz stärkster Bemühung das Kind weder vor Krankheit und Unglück noch vor Alter und Tod schützen kann. Indem sie wie selbstverständlich die Geste vollzieht – es nicht zu tun wäre unmenschlich –, fungiert sie dem Kind gegenüber bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt eben als Magna Mater, als eine Leiden und Tod überwindende Muttergottheit, gleichgültig ob sie an die Wirklichkeit einer solchen „Macht“ glaubt oder nicht.
Natürlich ist dies kein „Gottesbeweis“. Naturwissenschaftlich könnte man das Phänomen wahrscheinlich als einen überstarken Mutterinstinkt erklären, als ein Überschießen der in der Evolution der Lebewesen wirkenden Kraft, die zur Fortpflanzung der eigenen Gene drängt. Diese Kraft wäre dann eben stärker als das Wissen um die eigene Endlichkeit und die Sterblichkeit des Lebewesens Mensch. Die biologische Kraft, die zur Lebenserhaltung und Lebensfortpflanzung drängt, würde dieses dunkle Wissen gleichsam überblenden und das geschilderte Verhalten auslösen. Die Leben spendende und Leben erhaltende Muttergottheit, wie sie durch Funde schon aus der Vorgeschichte der Menschheit belegt ist, wäre dann die nachträgliche Ideologisierung des biologisch bedingten in sich widersprüchlichen Handelns.
Gewiss legt sich dem Naturwissenschaftler eine solche Erklärung nahe. Doch auch sie hebt den aufgedeckten Widerspruch nicht wirklich auf. Denn auch die biologische Erklärung arbeitet mit einem Lebenstrieb, der sich durch die Tatsache der Sterblichkeit und des Todes nicht eindämmen lässt, sondern über beides hinausgreift. Die Frage, die über eine agnostisch-atheistische oder eine religiös-gläubige Lebenshaltung entscheidet, ist, ob ich bereit und fähig bin, eine symbolische Dimension in den Vorgängen und Dingen der Wirklichkeit wahrzunehmen und mit ihr umzugehen, oder ob mir diese Bereitschaft und Fähigkeit fehlt. Die Muttergottheit ist ja nichts anderes als das, was im todumgreifenden Symbol des Lebens zum Ausdruck kommt.
Tiefenpsychologisch geschulten Lesern mag der hier entwickelte Begriff der Muttergottheit zu einseitig positiv erscheinen. Denn tiefenpsychologisch gehört zum sogenannten „Archetypus“ der Mutter auch der verschlingende Aspekt, wie er in den Hexen der Märchen sowie in Göttinnen wie Kali, Gorgo oder Anat zum Ausdruck kommt. Doch in der tiefenpsychologischen Anthropologie wird die geschichtliche Entwicklung des Menschseins eingeebnet. Ein nur etwa drei- bis fünftausend Jahre zurückreichender Querschnitt durch die Menschheitsgeschichte liefert die Bausteine und Versatzstücke zu einer statischen Anthropologie, die für alle Völker aller Zeiten festgeschrieben wird. Doch was sind drei- bis fünftausend Jahre menschlicher Geschichte gegenüber den Jahrmillionen, in denen sich das Menschenwesen entwickelt hat? Unter den vielen gefundenen Frauenstatuetten der Jüngeren Altsteinzeit, räumlich verteilt von Nordsibirien über den Mittelmeerraum bis Südfrankreich und Nordspanien und zeitlich aus vielen Jahrtausenden stammend, findet sich keine Gorgo und keine Kali.17 Offenbar ist der negative Aspekt des Mütterlichen nicht ein weiblicher „Elementarcharakter“, wie dies E. Neumann in der Nachfolge C. G. Jungs konstruiert.18 Solche Gestaltungen sind vielmehr der symbolische Ausdruck jener geschichtlichen Erfahrungen, wie sie während einiger Jahrtausende besonders in matriarchal geprägten Gesellschaften durch eine Muttergottheit, die grausame Menschenopfer fordert, gemacht wurden.19
Jedenfalls aber war vom Ursprung her die Mutter-Kind-Beziehung der Königsweg zur Entwicklung eines Transzendenzbewusstseins.