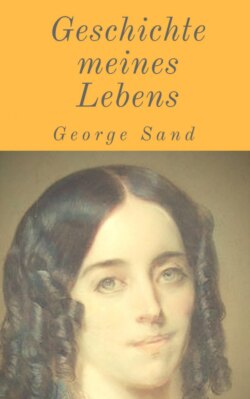Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. Kapitel. Fortsetzung der Briefe. — Saint-Jean. — Garnisonsleben. — Das „kleine Haus.“ — Abreise von Köln Einunddreißigster Brief.
ОглавлениеVon meinem Vater an meine Großmutter.
Den 21. Ventose Jahr VII (März 1799).
„Coulaincourt ist endlich abgereist; ich habe ihm Gesundheit und glückliche Reise gewünscht, er hat mir durch tiefe Verbeugungen geantwortet, die noch kälter waren als gewöhnlich — und ich habe nicht geweint. Das ist doch wunderbar!
„Der General sagt, daß ich mich nicht genug beschäftig; aber womit soll ich mich beschäftigen, wenn er mir nichts zu thun giebt? Ich habe nicht einmal ein Pferd zu reiten und unsere Zeit wird hier damit ausgefüllt, Besuche zu machen, in's Theater und zu Ball zu gehen. Wenn ich nicht die leidenschaftliche Liebe zur Musik besäße, würde ich mich zum Sterben langweilen, denn ich muß die Commandos und die Evolutionen der Escadron in meinem Zimmer studiren, wodurch ich nichts Bedeutendes lerne. Seitdem ich bei meinem Doktor bin, begleite ich dessen Tochter und auf meine Bitte hat auch die schöne Stiftsdame die Musik wieder aufgenommen, in der sie bewunderungswürdige Fertigkeit besitzt. Sie hat ein Klavier aus Mainz kommen lassen und spielt es mit viel Geschmack und Leichtigkeit. Dann spiele ich auch oft Violine und singe bei Madame Maret, der Frau des Oberkriegskommissärs in Köln. In ihrem Hause versammeln sich alle Franzosen, die zur guten Gesellschaft gehören, sogar der General besucht sie zuweilen.
„Wir haben eine sehr schöne Revüe gehabt, die durch prachtvolles Wetter begünstigt wurde. Da haben sich die Federbüsche und Stickereien mal in vollem Glanze zeigen können. Die Musik war sehr gut und das Alles stieg mir zu Kopfe ... ich war glücklich! Indessen giebt dies Alles nur Luft zum Handwerk, aber es befriedigt mich nicht. Es ist freilich wahr, daß der Krieg wieder begonnen hat, wennicht gar schon erklärt ist — Er muß sein! ich hoffe auf das Signal meiner Beförderung. Diese Hoffnung darf Dich nicht erschrecken. Bedenke, daß in den verschiedenen Corps Ergänzungen nöthig sein werden, und daß endlich auch ich an die Reihe kommen muß. Kennst Du etwas Lächerlicheres als die Unterhandlungen von Rastadt? Man erweist sich von beiden Seiten große Höflichkeiten und man beschießt sich unter Freundschaftsbetheuerungen.
„Was Du mir von der nächsten Ernte erzählst, ist nicht erfreulich. Aber in meiner optimistischen Weisheit habe ich mir ausgedacht, daß, wenn das Korn selten ist, es auch theuer sein muß, so daß Du nicht dabei verlierst. Es ist wahr, daß die Armen, auf die es zurückfällt, Dir wieder zufallen, und daß Du deren mehr als gewöhnlich zu ernähren haben wirst. So sehe ich denn wohl ein, daß mein Optimismus ein Irrthum ist, und daß sich ein gutes Herz nicht mit dem Reichthum verträgt.
„Sage zu Saint-Jean, im Heere hätte sich das Gerücht verbreitet, daß alle Männer von vierzig bis fünfundfünfzig Jahren einberufen werden sollten, und daß ich suchen würde, ihn als Koch in das Regiment zu bringen, damit er keinem Feuer, als dem der Küche ausgesetzt wäre — denn ich glaube, daß ihm dasjenige der Batterien nicht zusagen würde.“
Dieser Saint-Jean, beständiger Gegenstand der Neckereien meines Vaters, war der Kutscher des Hauses und der Gatte der Köchin Andelan. Dies alte Ehepaar ist bei uns gestorben, der Mann nur wenige Monate früher, als meine Großmutter, die es gar nicht erfahren hat, da ihre Lähmung erlaubte, es ihr zu verheimlichen. Saint-Jean war ein sehr drolliger Trunkenbold; sein Leben lang war er übermäßig feig und wurde besonders im Zustande der Trunkenheit von Gespenstern angefallen: von Georgeon, dem Teufel der Vallée-noire; von der weißen Windhündin, von dem großen Thiere, von allen Gestalten, die der Volksaberglaube unserer Gegend erschafft. Wenn er an Posttagen die Briefe von la Châtre holte, traf er zu dieser Reise von einer Meile die feierlichsten Vorbereitungen — und besonders im Winter, wenn er erst beim Anbruch der Nacht zurückkehren sollte. Sobald er sich Morgens durch einige Pinten Landwein ermuntert hatte, zog er ein Paar Stiefeln an, die wenigstens aus der Zeit der Fronde herstammten und hüllte sich in ein Gewand von unbeschreiblicher Form und Farbe. Er nannte dasselbe seine Roquemane — Gott mag wissen, wo er diesen Namen aufgefischt hatte. Dann umarmte er seine Frau; sie brachte respectvoll einen Stuhl herbei und mit seiner Hülfe schwang sich Saint Jean auf einen alten phlegmatischen Schimmel, der ihn in weniger als zwei kleinen Stunden (so war sein Ausdruck) zur Stadt trug. Hier vergaß er sich wieder zwei oder drei „kleine Stunden“ im Wirthshause, vor und nach den Besorgungen, und endlich, beim Einbruch der Dunkelheit, trat er den Rückweg an, den er selten ohne Hindernisse vollbrachte: bald begegnete ihm eine Räuberbande, die ihn durchprügelte; bald stürzte ihm ein ungeheurer Feuerball entgegen und sein „feuriges“ Roß rannte mit ihm querfeldein; bald legte sich der Teufel in irgend welcher Gestalt unter den Bauch seines Pferdes und verhinderte dessen Weitergehen; endlich setzte sich Satan wohl gar hinter ihm auf's Pferd und nahm ein so fürchterliches Gewicht an, daß das arme Thier nothwendiger Weise stürzen mußte. War er um neun Uhr Morgens von Nohant fortgeritten, so gelang es ihm wohl bis neun Uhr Abends zurückgekehrt zu sein, und während er dann langsam seine Mappe öffnete, um meiner Großmutter Briefe und Zeitungen zu überreichen, erzählte er uns mit dem ernsthaftesten Gesicht von der Welt die Geschichte seiner Visionen.
Eines Tages bestand er ein drolliges Abenteuer, dessen er sich eben nicht zu rühmen pflegte. Es war ein nebliger, düstrer Abend und er war auf seinem Heimwege in die tiefen Betrachtungen versunken, welche der Wein verursacht. Plötzlich sah er sich zwei bewaffneten Reitern gegenüber, die jedenfalls Räuber sein mußten. Zur Flucht war nicht mehr Zeit, und nun überfiel ihn plötzlich eine jener muthigen Regungen, die allein durch Furcht hervorgebracht werden. Er hält sein Pferd an, sucht die Räuber zu schrecken, indem er sich selbst zum Räuber macht und schreit mit fürchterlicher Stimme: Halt, meine Herren! das Geld oder das Leben!
Die Reiter erstaunen über solche Kühnheit, glauben von Banditen umgeben zu sein, ziehen den Säbel und sind drauf und dran, den armen Saint-Jean übel zuzurichten, als sie ihn plötzlich erkennen und in lautes Gelächter ausbrechen. Sie verließen ihn übrigens nicht, ohne ihm eine kleine Strafrede zu halten und ohne ihn mit dem Gefängniß zu bedrohen, wenn er dergleichen noch einmal versuchte. Er hatte die Gendarmerie überfallen.
In seiner Jugend war Saint-Jean in dem Marstall Ludwig's XV. eine Art Stallknechts-Untergehülfe gewesen und hatte sich aus jener Zeit feierliche, würdevolle Manieren und eine unerschütterliche Ehrfurcht für das Königthum bewahrt. Später war er Postillon gewesen, und als ihn, nach der Revolution, meine Großmutter als Kutscher in ihren Dienst nahm, erhob sich eine kleine Schwierigkeit, weil Saint-Jean sich weigerte, einen Kutschbock zu besteigen und seine Jacke mit rothen Aufschlägen und silbernen Knöpfen abzulegen. Meine Großmutter, die keinem Menschen widerstrebte, fügte sich denn auch seinem Begehren und so hat er sie sein Leben lang als Postillon gefahren. Da er aber die Gewohnheit hatte, im Reiten zu schlafen, warf er sie häufig um — mit einem Worte, er bediente sie fünfundzwanzig Jahre lang auf die unerträglichste Weise, ohne daß es seiner unglaublich gütigen und geduldigen Herrin in den Sinn gekommen wäre, ihn fortzuschicken.
Wahrscheinlich nahm er die Neckereien meines Vaters wegen Einberufung der fünfzigjährigen Rekruten für baare Münze, und verheirathete sich zu dieser Zeit mit der Andelan, um sich den Anforderungen der Republik zu entziehen. Wenn man ihn zwanzig Jahre später fragte: ob er bei der Armee gewesen wäre, gab er zur Antwort: nein, aber ich wäre fast dazu gekommen! Als mein Vater nach dem italienischen Feldzuge und der Schlacht von Marengo zum ersten Male auf Urlaub kam, ergriff Saint-Jean, der ihn nicht erkannte, bei seinem Anblick die Flucht. Als er nun sah, daß sich der Fremde in die Zimmer meiner Großmutter begab, lief er zu Deschartres, um ihm zu sagen, daß ein fürchterlicher Soldat trotz seines Sträubens in das Haus gedrungen wäre, und daß die gnädige Frau sicherlich ermordet würde.
Trotz alledem hatte er seine guten Seiten. Als er einst wußte, daß meine Großmutter in Verlegenheit war und sich ängstigte, weil sie ihrem Sohne nicht gleich Geld senden konnte, brachte er ihr in höchster Freude seinen Jahreslohn, den er wunderbarer Weise noch nicht vertrunken hatte. Vielleicht war ihm derselbe erst am Tage zuvor ausgezahlt — aber es war sein eigner Einfall und für einen Trunkenbold ist das viel! Meinem Vater vergab er es auch, wenn er die Pferde etwas anstrengte; aber auf seine alten Tage wurde er unduldsamer, und wenn ich reiten wollte, mußte ich häufig selbst satteln und zäumen, oder ich mußte wohl gar im Schritt bis zum nächsten Dorfe reiten, um meinem Pferde das Hufeisen wieder aufschlagen zu lassen, das ihm Saint-Jean heimlich abgenommen hatte, um mich am Schnellreiten zu hindern.
Von meinem Vater hatte Saint-Jean ein Paar silberne Sporen erhalten; er verlor einen davon, weigerte sich beharrlich, ihn zu ersetzen und bediente sich für den Rest seiner Tage nur eines Sporns. Wenn ihn seine Frau zu einem Ritt ausrüstete, versäumte er niemals, ihr zu sagen: „Madame, vergeßt nicht, mir meinen silbernen Sporn anzuschnallen.“
Aber obwohl sie sich „Madame“ und „Monsieur“ zu nennen pflegten, verging nicht ein Tag in ihrer süßen Ehe, ohne daß sie sich geprügelt hätten, und endlich starb der Vater Saint-Jean so betrunken, wie er gelebt hatte.
Aus dem Vorrath meiner Briefe theile ich hier noch einige mit.
Köln, 19. Floréal.
„Du magst sagen, was Du willst, mein Mütterchen, ich rieche nicht nach dem Stalle; die Wartung meines Pferdes ist eine Kleinigkeit und es kommt ja auch nur darauf an, eine besondere Kleidung zu diesem Zwecke zu haben. Und, meiner Treu! wenn sich auch mal etwas von diesem Duft an unsre Person hängt, so zeigen doch unsre Schönen nicht, daß sie es bemerken — und jedenfalls müssen sie sich daran gewöhnen; wenn wir wirklich im Kriege wären, würden wir noch schlechter riechen. — Erlaube mir, Dir zu sagen, meine gute Mutter, daß Dein Vorschlag, mein Taschengeld zu erhöhen, damit ich mir einen Bedienten halten kann, mir gar nicht zusagt. Ich mag das nicht, weil Du nicht reich genug bist, ein solches Opfer zu bringen und dann, weil ein gemeiner Jäger, der sich die Stiefel putzen und sich von einem Bedienten aufwarten ließe, der Spott des ganzen Heeres würde. Wenn ich bei dem Gedanken, in meiner Lage einen Kammerdiener zu halten, gelacht habe, so ist mir Deine Sorgfalt doch sehr rührend erschienen — und wenn es Dich in Verzweiflung bringt, mich mit der Mistgabel und dem Striegel zu sehen, so will ich Dir zur Beruhigung sagen, daß ich, wenn ich Luft dazu hätte, mein Pferd für sechs Franks monatlich durch einen Stallknecht des Generals besorgen lassen könnte.
„Die Frauen sind dazu geschaffen, uns über alles Leid der Erde zu trösten; nur bei ihnen finden wir jene zarte, reizende Sorgfalt, deren Werth durch Anmuth und Gefühl noch erhöht wird. Du, meine liebe Mutter, hast mir diese Sorgfalt bewiesen, als ich bei Dir war, und jetzt machst Du meine Fehler wieder gut. Oh! wenn Dir alle Mütter glichen, wären Frieden und Glück nie aus den Familien verschwunden. Durch jeden Brief von Dir, durch jeden Tag, der verfließt, werden meine Liebe und Dankbarkeit für Dich erhöht. O nein, wir dürfen das schwache Wesen nicht verlassen — ich weiß auch, daß Du es nicht verlassen wirst. Wir wollen den schrecklichen Vorwurf der jungen Vögel nicht rechtfertigen, die im Gedicht den Menschen vorwerfen, daß sie ihre Kinder in's Findelhaus bringen, während die Vogelmutter ihre Brut versorgt.
„Deine Betrachtungen, meine liebe Mutter, haben mich tief gerührt; leider haben sie mich zu spät belehrt, und wenn Deine Güte bei dieser Gelegenheit nicht die unvorhergesehenen Folgen meiner Leidenschaft wieder gut gemacht hätte, bliebe mir nichts als schmerzliche, unfruchtbare Reue. Aber die Tugend lehren und üben, ist Dein Beruf und Deine Gewohnheit. Leb wohl, meine gute, meine vortreffliche und geliebte Mutter; ich werde zum General berufen und habe nur noch Zeit, Dich in Gedanken zu umarmen.
Moritz.“
Zur Erklärung dieses Briefes möge Folgendes dienen: ein junges Mädchen, das zur Dienerschaft meiner Großmutter gehörte, hatte einem schönen Knaben das Leben gegeben, der später der Gefährte meiner Kindheit und der Freund meiner Jugend wurde. Das hübsche Geschöpf war nicht der Verführung erlegen, sondern hatte sich, wie mein Vater, durch die Leidenschaft der Jugend hinreißen lassen. Meine Großmutter entfernte sie ohne Vorwürfe, sorgte für ihren Lebensunterhalt, behielt das Kind und ließ es erziehen.
Der Kleine wurde zuerst einer sehr reinlichen Bauerfrau, die fast Thür an Thür mit uns wohnt, zur Pflege übergeben. Wir sehen aus den spätem Briefen meines Vaters, daß er durch seine Mutter Nachrichten über dies Kind erhält, und daß sie sich, um es zu bezeichnen, einer verblümten Redeweise bedienen und vom „kleinen Hause“ schreiben. Mit den „kleinen Häusern“ wollüstiger Edelleute aus der guten alten Zeit, war hier freilich keine Aehnlichkeit zu finden. Wenn auch von einem kleinen, ländlichen Hause die Rede war, so fanden dort doch keine andern Rendezvous statt, als zwischen einer zärtlichen Großmutter, einer rechtschaffenen Amme vom Lande und einem guten, dicken Kinde, das man nicht im Waisenhause lassen wollte und das mit derselben Sorgfalt erzogen werden soll, wie ein rechtmäßiger Sohn. Die Verirrung des Augenblickes sollte durch die Sorgsamkeit des ganzen Lebens gesühnt werden.
Meine Großmutter hatte Jean Jacques gelesen, sie liebte ihn und wußte seine Wahrheiten wie seine Irrthümer zu nützen; denn wer sich eines schlechten Beispiels bedient, um ein gutes zu geben, läßt das Böse sogar dem Guten zum Vortheil dienen.