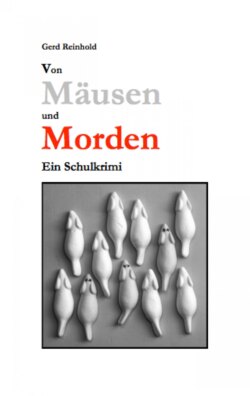Читать книгу Von Mäusen und Morden - Gerd Reinhold - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6.
Am Nachmittag im Garten konnte sich Hieronymus partout nicht auf seine Lektüre konzentrieren. Eigentlich wollte er einen Text für seinen Philosophie-Unterricht der zehnten Klasse lesen, aber er musste schließlich widerwillig zur Kenntnis nehmen, dass er zwar immer wieder den aufgeschlagenen Text anstarrte, aber überhaupt nicht las, nicht auffasste, was da stand, sondern seinen Gedanken nachhing, die überhaupt nichts mit dem Text zu tun hatten. Dabei waren die äußeren Bedingungen um ihn herum doch eigentlich ideal, um sich in die Gedankenwelt von Richard David Precht zu vertiefen, denn es war ruhig, wenn man von den gelegentlich unweit im Landeanflug oder beim Start befindlichen Flugzeugen absah, und auch von den Temperaturen her vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr so, dass man es gut draußen auf der Gartenbank aushalten konnte, wenn man sich eine Wolldecke umgelegt hatte.
Aber Hieronymus saß auf der weißen Holzbank unter dem großen Apfelbaum, der gerade zaghaft begann auszutreiben, im Garten der Boschs und konnte sich nicht für Prechts Gedanken interessieren, weil er immer wieder aufs Neue in eigene Gedanken abglitt und seine Augen gleichsam wie Brenngläser bereits Löcher in den Text zu brennen schienen. Als er nicht nur deswegen einmal aufsah, bemerkte er, dass Molly unmittelbar vor ihm stand und ihn ebenso geistesabwesend anstarrte wie er eben noch die Zeilen und Buchstaben auf dem weißen Papier und dabei wie meistens mit ihren Kiefern vor sich hin malmte.
Schafe sind Widerkäuer und Molly war ein Schaf, insofern waren ihre geduldig andauernden Kieferbewegungen nichts Ungewöhnliches, aber dass sie Hieronymus dabei so anstarrte, war schon ungewöhnlich. So, als wollte sie ihm sagen:
»Lass´ es, das wird ja doch nichts!«.
Als ob sie sich ertappt fühlte, sah Molly auch gleich weg, als ihr Blick von Hieronymus erwidert wurde und wandte sich wieder ihrer Haupt- und Lieblingsbeschäftigung zu, dem Grasfressen. Genau deswegen bewohnte Molly ja auch das Anwesen der Boschs im Narzissenstieg der Gartenstadt in Hamburg-Alsterdorf. Sie hielt den Rasen kurz, der den größten Teil des Grundstücks um das kleine Backsteinhaus ausmachte, und ersparte so einen lärmenden und vielleicht auch stinkenden Rasenmäher und vor allem die Mühe, diesen regelmäßig zu benutzen.
Vor einiger Zeit hatten Nachbarn Molly angetroffen, wie sie die nähere Gegend erkundet hatte, indem sie ein Stück die Straße hinunter gegangen war. Das hatte die Boschs zu zwei Konsequenzen bewogen. Zunächst war die bisherige Schwachstelle in der Umzäunung des Grundstücks beseitigt worden, indem auch der Zugang zur Haustür von der kleinen Pforte an der Straße aus zu beiden Seiten mit einem niedrigen Zaun flankiert worden war, so dass Mollys Neugierde Grenzen gesetzt waren. Zum Anderen hatte sie Gesellschaft in Form eines zweiten Schafs bekommen, allerdings keines echten, man hatte sich ja nicht auf die Schafzucht verlegen wollen, sondern in Form eines blauen Holzschafs ins Lebensgröße. Molly schien diesen Partner zu akzeptieren, auch wenn die Möglichkeiten der Interaktion wohl begrenzt waren, jedenfalls fand das blaue Schaf eine gewisse interessierte Duldung bei ihr.
Natürlich hatte diese Methode der Gartenpflege mittels eines lebenden Tieres auch seine Nachteile. So konnte man im Garten nicht nur überall sehen, wo das abgefressene Gras in veränderter Gestalt abgeblieben war, sondern man roch es auch. Zudem setzte so ein Schaf ja auch Wolle an und musste deshalb regelmäßig unter die Schere. Dafür konnte man es aber nicht bei den eigenen Frisör-Terminen einfach so mitnehmen, und so kam zu diesem Zweck zu vereinbarten Terminen ein befreundeter Schafzüchter aus der Wedeler Elbmarsch mit seiner Ausrüstung bei den Boschs vorbei, der Molly auch Kost und Logis für die kalte Jahreszeit und für die Sommerferien bot.
Zu den Boschs gehörten neben Molly und Hieronymus auch seine Frau Helene. Denkt man bei diesem Namen aber vielleicht an eine blonde Schlagersängerin, so liegt man sowas von falsch, denn Helene Bosch war in ihrer Haarfarbe dunkelkupferrot und in ihrer politischen Gesinnung sogar hellknallrot. Und beides sogar, obwohl sie Polizistin in Hamburg war. Dieses war auch der Grund, warum an der Haustür der Boschs kein übliches Namensschild hing, sondern nur eines mit dem dezenten Hinweis, dass hier »H.B. & H.B.« zuhause seien. Denn während Hieronymus´ Klientel aus dem »Wilden Osten« Hamburgs sich eher selten nach Hamburg-Alsterdorf in die Gartenstadt verirrte - genau genommen nie, da war sogar Helgoland schon naheliegender - traf dasselbe für die »Klienten« von Helene schon weniger zuverlässig zu. Verwunderlich in diesem Zusammenhang war aber, dass es zwar in der Nachbarschaft zunehmend Einbrüche gab, die Boschs aber in all den Jahren trotz des anonymisierten Namensschildes noch nie solchen »Besuch« gehabt hatten.
Zyniker sprachen bezüglich Helenes roter Haarpracht von einem »letzten Aufflammen« und Zyniker gab es bei der Polizei reichlich, aber Helene erreichte der Zynismus ihrer Kollegen schon lange nicht mehr.
Kinder hatten die Boschs nicht und eigentlich auch nicht vermisst bisher, denn Hieronymus als Lehrer pflegte bei dem Thema immer zu sagen:
»Was, keine Kinder - ich habe hunderte!«
Und Helene glaubte einfach, dass ihr Beruf als Mitglied der Hamburger Mordkommission mit seinen speziellen hohen Ansprüchen, erschütternden Erlebnissen und unregelmäßigen Arbeitszeiten ihr nicht die Chance gäbe, eigenen Kindern gerecht werden zu können. Deshalb gab es im Haushalt der Boschs außer ihnen und Molly kein weiteres Lebewesen, und man meinte, dass das auch gut so sei und man es auch mittlerweile, wo man damit begonnen hatte, in die reiferen Jahre zu kommen, nicht zu bereuen brauche. Obwohl ...?
Aber was war es denn eigentlich, was Hieronymus immer wieder und so nachhaltig vom Studium der zweifellos wertvollen Gedanken des prominenten und telegenen Philosophen abhielt? Zwar hatte er inzwischen erfolgreich sein Grübeln bezüglich des gewaltsamen Todes des Schulinspektors Mausmann zügeln können, nicht aber seine Erinnerungen an jenen Mann selbst. Mausmann hatte mehrfach das Leben beziehungsweise die berufliche Tätigkeit von Hieronymus tangiert und zwar mit einer stringenten und nachhaltigen Note des Unangenehmen. Vielleicht konnte man es sogar Bösartigkeit nennen. Zwar wusste Hieronymus, dass sich sein Chef, Schulleiter Dr. Zürn, zu den Freunden Mausmanns zählte, aber wegen seiner eigenen Begegnungen und Erfahrungen mit dem Mann fiel es ihm einfach schwer, sich vorstellen zu können, dass der viele Freunde in seinem Leben gehabt haben könnte.
Einmal, im vergangenen Schuljahr bei der jüngsten Inspektion der Peter-Ustinov-Schule, hatten sich Mausmann und er gegenüber gestanden und Hieronymus selbst hatte damals das nur knapp bezwingbare Bedürfnis verspürt, seinem Gegenüber an die Gurgel zu springen. Im Rahmen jener Inspektion war Mausmann unangekündigt in Hieronymus´ Unterricht gekommen und hatte verblüfft zur Kenntnis genommen, dass dieser mit nur drei Schülerinnen im Raum anzutreffen war anstatt mit einem ganzen Seminar-Kurs von vierundzwanzig im vierten Semester. Hieronymus hatte ihm dann erläutert, dass die anderen Kursteilnehmer gerade in ihren jeweiligen Arbeitsgruppen dabei wären, ihre Seminararbeit irgendwo in der Schule oder zuhause bei einem Mitglied der Gruppe zu bearbeiten. Oder dass sie irgendwo in der Stadt ein Interview führten, Erkundigungen beziehungsweise Messungen durchführten oder Fotos und Videos zu diesem Zweck erstellten.
»Wie beaufsichtigen Sie denn die Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler, wenn Sie noch nicht ´mal wissen, wo sie sich aufhalten?«, hatte Mausmann von Hieronymus wissen wollen, nachdem er ihn vor den Klassenraum gebeten hatte, um die anwesenden Schülerinnen nicht an dem Gespräch teilhaben zu lassen.
»Ich habe eine Liste von allen mit den Telefonnummern und Handynummern«, hatte Hieronymus erwidert. »Ich kann sie jederzeit anrufen, wenn es nötig sein sollte.«
»Schön und gut, dass Sie das können, aber das ersetzt doch keine Beaufsichtigung«, hatte Mausmann sofort begonnen Hieronymus anzugiften. »Sie haben eine Aufsichtspflicht, Herr Kollege!«
»Natürlich können mich die Schüler von unterwegs ebenfalls anrufen, wenn sie eine Frage haben oder wenn es ein plötzliches Problem gibt«, hatte Hieronymus versucht zu beschwichtigen, aber Mausmann hatte ihn kaum ausreden lassen, bevor er süffisant fortgefahren war:
»Ach ja, und bei einem Problem verlassen Sie dann womöglich während der Dienstzeit die Schule und eilen irgendwo hin in der Hoffnung, dass der Anrufer in der Zwischenzeit nicht unter die Räder gekommen ist?«
»Na ja, selbstständiges Lernen, die Erziehung zur Selbstständigkeit überhaupt, erfordert doch ein gewisses Loslassen ...«, hatte Hieronymus gerade noch ausstoßen können, bevor Mausmanns nächste donnernde Salve auf ihn niedergegangen war:
»Nach meinen Informationen findet jetzt gerade hier eine Doppelstunde im Fach Seminar statt, also Unterricht, und Sie erzählen mir hier ´was davon, dass ›die Schüler irgendwo arbeiten‹, und faseln ´was von ›Selbstständigkeit‹ ...!«
»Ja, aber ...«, hatte Hieronymus versucht mitzureden, aber Mausmann war jetzt so richtig schön in Fahrt gekommen und hatte bereits damit begonnen rot anzulaufen. Vielleicht hatte er nur einfach nicht damit umgehen können, eine andere Situation als die erwartete vorzufinden.
»Sie wissen ja noch nicht ´mal, ob die Schüler jetzt in der Unterrichtszeit überhaupt arbeiten oder ob sie sich gerade einen faulen Lenz machen!«, hatte er Hieronymus angeranzt.
Der hatte hierauf versucht, das Gespräch wieder auf eine sachlich-pädagogische Ebene herunter zu bringen, indem er eingeworfen hatte:
»Zum selbstständigen Lernen gehört natürlich auch das selbstständige Einteilen der für eine Aufgabe zur Verfügung stehenden Zeit!«
Und bevor Mausmann gleich wieder etwas hätte einwenden können, hatte er gleich nachgesetzt:
»Wenn die Schüler die Unterrichtszeit, die ich ihnen zur Verfügung stelle, anderweitig nutzen, dann müssen sie zwangsläufig ihre Freizeit opfern, wenn der Termin der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bevorsteht.«
Hieronymus hatte bei dieser Einlassung damals aber verschwiegen, dass die Schüler recht oft noch so wenig Selbstständigkeit erlernt hatten, dass sie tatsächlich bei vorherigen Arbeitsaufträgen die letzten Tage und oft auch Nächte vor dem Abgabetermin hatten durcharbeiten müssen, um die vorher versäumte Zeit aufzuholen. Oder dass sie trotz der von ihm vorher angedrohten Konsequenzen erst verspätet oder nur Marginales abgeben konnten.
Die formal festbetonierte Perspektive des Schulinspektors Mausmann hatte Hieronymus jedoch mit seiner letzten Aussage ebensowenig aufzuweichen vermocht wie mit weiteren Argumenten im Folgenden. Er hatte es wieder einmal mit einem der klassischen Widersprüche im Hamburger Schulwesen zu tun gehabt, nämlich dass den Einen nicht interessierte, was der Andere wollte, beide aber in ihren jeweiligen divergierenden oder sogar antagonistischen Interessen im konkreten Unterrichtshandeln der Lehrerin oder des Lehrers miteinander kollidieren mussten. Diesen Widerspruch als Grundsatz hatte Hieronymus bereits bei seiner Ausbildung im Referendariat kennen lernen müssen und er begegnete ihm seitdem immer wieder in immer wieder neuen Zusammenhängen.
Im vorliegenden Fall war es schlicht um das offiziell propagierte pädagogisch-didaktische Ziel gegangen, die Schüler gerade in den Jahren, kurz bevor sie die Schule beenden würden, zu möglichst viel Selbstständigkeit und Eigentätigkeit zu erziehen, und die teilweise im Widerspruch dazu stehenden Zwänge der Institution Schule mit ihrem System von Kontrolle, Beaufsichtigung und Bewertung. Eigentlich handelte es sich für Betroffene um den klassischen Konfliktfall der »double-bind-Theorie«, nach der es gar nicht möglich ist, es beiden Seiten zugleich recht und damit insgesamt richtig zu machen.
Letztlich hatte Mausmann dann, als er gemerkt hatte, dass Hieronymus sein Unterrichtshandeln argumentativ zu verteidigen verstand und nicht gewillt war, aufgrund der Einwände und Bedenken von ihm, dem Ranghöheren, aber nicht Vorgesetzten, klein beizugeben und ein: »Sie haben natürlich recht«, zerknirscht zu Boden zu hauchen, ihn einfach da vor dem Klassenraum stehenlassen und war grußlos und mit hochrotem Kopf den Flur hinunter davon gerauscht. Vermutlich hatte er sich dann sofort bei seinem Kumpel Dr. Zürn über den ach so uneinsichtigen Kollegen Bosch ausgeweint. Mit dem war Hieronymus zwar auch nicht gerade befreundet, aber er hatte damals gewusst, dass er in der strittigen Sache Rückendeckung von ihm bekommen würde, denn schließlich war diese Form des Unterrichts im Fach Seminar der Oberstufe in der Schule eine abgesprochene Sache gewesen und daher allgemein üblich.
Hieronymus hatte von Dr. Zürn auch nie etwas Diesbezügliches gehört, außer einige Zeit später die »wohlmeinende« Erinnerung an das Führen der Liste mit den Telefonnummern, verbunden mit der neuen Bitte, doch diese auch für gelegentliche Kontrollanrufe zu nutzen.
Auch an einen anderen Zusammenprall mit Mausmann erinnerte sich Hieronymus jetzt. Den Precht-Text hatte er inzwischen, ohne es wirklich zu bemerken, bereits beiseite gelegt, der würde warten müssen, bis er dran war. Der Schüler Max Mausmann war mitten im ersten Halbjahr des vorigen Schuljahres, als Hieronymus´ Klasse noch dem neunten Jahrgang angehörte, neu in seine Klasse gekommen, nicht sehr lange, bevor der nächste Elternabend anstand. Auf diesem Elternabend hatte Hieronymus Mausmann dann zusammen mit dessen Frau wiedergetroffen. Während Frau Mausmann-Heerenthal sich an dem Abend bereit gefunden hatte, sich als Elternvertreterin der Klasse neu wählen zu lassen, weil eine der beiden bisherigen Vertreterinnen den Posten hatte abgeben wollen, hatte sich ihr Gatte darin gefallen, wo immer es möglich war kritische Fragen zu stellen und herumzustänkern. Es war ihm offensichtlich nicht um das Wohl der Kinder oder um das seines Sohnes im Speziellen gegangen, sondern darum, Stimmung gegen Hieronymus zu machen. Der zufällige Umstand, dass er selbst Mitglied des Schulbetriebs war, hatte ihm dabei natürlich geholfen.
»Sind Sie sicher, dass Sie mit der geplanten Klassenreise im nächsten Herbst die behördlich vorgegebenen Höchstkosten für Projektreisen in der Mittelstufe nicht überschreiten werden?«, war eine seiner provokanten Äußerungen gewesen.
Eine andere wiederum betraf die Frage, ob Hieronymus als Deutsch-Fachlehrer in der Klasse die Schüler denn tatsächlich ausreichend auf die in der neunten Klasse in Kürze anstehenden Prüfungen zum Ersten Schulabschluss vorbereite. Diese Frage als bekannter Schulmann öffentlich so in den Raum zu stellen, hatte praktisch geheißen, sie zu verneinen oder zumindest Zweifel an der nachgefragten Tätigkeit zu sähen, wo vorher vielleicht noch keine Spur davon bestanden hatte, so dass andere Eltern sogleich begonnen hatten, nach bestimmten Themen und Inhalten des Deutschunterrichts, so wie sie diese von ihren Kindern mitbekommen hatten, zu fragen, während sich Mausmann feixend wieder in den Hintergrund der letzten Tischreihe zurückgezogen hatte.
Den Höhepunkt in seiner Unterminierungstaktik des Abends hatte aber die spätere Frage dargestellt:
»Sie wollen doch auch nochmal `was werden, oder?«, die eine von Hieronymus aktuell überhaupt nicht ins Auge gefasste und auch an dem Abend überhaupt nicht relevante Möglichkeit, trotz seines fortgeschrittenen Alters einmal die Karriereleiter ein Stückchen weiter nach oben zu gelangen, mit der unausgesprochenen Bedingung verknüpft hatte, dass Hieronymus dann an diesem Abend gut daran täte, den Wünschen und Vorstellungen der sich äußernden Eltern möglichst ohne Einwände unverzüglich nachzukommen.
Dieser war jedenfalls froh gewesen, als jener Elternabend endlich vorüber war und er aufgewühlt und verschwitzt endlich wieder hatte nachhause fahren können. Zu seiner großen Erleichterung hatte Frau Mausmann-Heerenthal die Lernentwicklungsgespräche in der folgenden Zeit bis zur Gegenwart immer alleine ohne ihren Mann bestritten. Mit der Frau konnte man wenigstens reden, vor allem über die Probleme und Fortschritte ihres Sohnes Max, auch wenn sie Hieronymus immer als eine etwas überbehütende Mutter vorkam.
Eigentlich verspürte er nicht wenig Genugtuung darüber, dass irgend jemand dem Mausmann »das Licht ausgeknipst« hatte. Schade um diesen Menschen war es seiner Meinung nach jedenfalls nicht. Er hoffte, dass er bald am Abend mehr über dessen Tod erfahren würde.