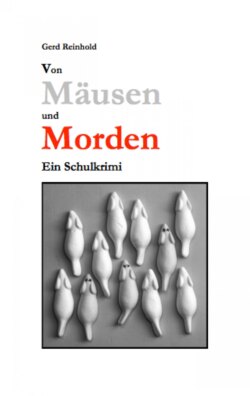Читать книгу Von Mäusen und Morden - Gerd Reinhold - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
Wie jede Schulwoche in diesem Schuljahr begann auch diese schon mit Stress, denn wenn man montags erst zur zweiten Stunde kam, konnte das nur stressig werden. Erst zur zweiten Stunde kommen zu müssen, verhieß zwar, etwas länger schlafen zu können am Montag, einem Tag, an dem das wertvoller war als an jedem anderen Tag der Woche, aber dieses Quantum Antistress wurde doch zumeist gleich wieder aufgefressen durch die Notwendigkeit, einen Parkplatz zu finden.
Die Peter-Ustinov-Schule im »Wilden Osten« Hamburgs war im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich vergrößert und erweitert worden, nur ihr Parkplatz nicht. Das hatten die Planer entweder schlicht vergessen, dass eine vergrößerte Schule auch mehr Parkplätze benötigt, oder sie hatten es kalt lächelnd ignoriert und sich über die dadurch entstehenden Einsparungen im Kostenrahmen gefreut. Vielleicht war es sogar der grassierenden politischen Formel von der »Fahrradstadt Hamburg« geschuldet, dass die Schule jetzt nicht genügend Parkplätze für ihr aus allen möglichen Stadtteilen anreisendes Personal bot. Konnte es denn tatsächlich jemanden geben, der die Vorstellung pflegte, dass es Menschen geben kann, die sich morgens früh aufs Rad schwingen, durch die ganze Stadt radeln und sich anschließend dem Energieverlust durch Horden unerzogener Kinder wildfremder Leute aussetzen, um am Nachmittag, am Spätnachmittag unter Umständen, wieder mit dem Rad nach Hause zu fahren? Und das nicht nur an einem Tag der Woche, sondern montags bis freitags jeden Tag? In welchem Wolkenkuckucksheim musste man leben, um so etwas für realistisch halten zu können, und war in diesem Heim vielleicht noch ein Plätzchen frei?
In den allermeisten Hamburger Schulen beginnt der Unterricht morgens um acht Uhr mit der ersten Stunde. Genauso auch an der Peter-Ustinov-Schule. Manche Unterrichtsstunden begannen aber auch schon kurz nach sieben Uhr am Morgen und nannten sich dann auch »Nullte Stunde«. Nomen est Omen, was den durchschnittlichen Lehr- und Lernerfolg solcher Stunden anbelangt, aber um alle vorgeschriebenen Unterrichtsstunden in eine Schulwoche quetschen zu können, musste es eben solche »Frühstunden«, wie sie auch genannt wurden, ebenso geben wie solche am späten Nachmittag einiger Tage.
Am Montag gab es diese »Frühstunden« an der Peter-Ustinov-Schule jedoch nicht, so dass an diesem Wochentag niemand das Glück hatte, garantiert einen der wenigen Parkplätze vor allen anderen als Belohnung dafür zu bekommen, dass man sich im Dienste der allgemeinen Volksbildung praktisch die Nacht um die Ohren geschlagen hatte. Aber gegen acht Uhr füllte sich der Parkplatz rasant, denn die meisten der anreisenden Lehrerinnen und Lehrer hatten ihren Dienst mit der ersten Stunde zu beginnen. Wer dann erst später zu kommen brauchte, zur zweiten Stunde oder noch später, hatte praktisch keine Chance mehr auf einen schuleigenen Parkplatz. Erst wenn man ganz spät mit dem zu beginnen hatte, was mit dem Euphemismus »Unterricht« bezeichnet wurde, zur vierten oder fünften Stunde etwa, entspannte sich die Parksituation wieder etwas, weil dann manche der früher Gekommenen für diesen Tag ihre Unterrichtsverpflichtung bereits schon wieder hinter sich hatten und zu ihren heimischen Arbeitsplätzen strebten, so dass einzelne Parkplätze von ihnen frei gemacht wurden.
Hieronymus Bosch aber hatte beinahe so etwas wie Glück am heutigen Morgen, denn er fand einen freien Platz für seinen Wagen nur etwa dreihundert Meter vom Schuleingang entfernt in der Straße, die vorbeiführte.
Mit seinem fünfhundert Jahre alten Namensvetter verband Hieronymus Bosch so etwas wie eine Hassliebe. Einerseits mochte er dessen Kunst, vor allem die apokalyptischen Massenszenen, andererseits verurteilte er ihn als üblen Usurpator seines Namens. Er bestand nämlich darauf, dass er, der Fünfundertjährige, ihm, dem im zwanzigsten Jahrhundert Geborenen, den Namen gestohlen hatte. Ob und inwieweit diese Einschätzung logisch war oder überhaupt nur sinnvoll, interessierte ihn schlicht nicht. An diesem Punkt hatte die Logik Pause und nichts zu suchen. Deshalb, wegen der Namensgleichheit, begann er jede namentliche Vorstellung seiner Person für gewöhnlich mit dem entsprechenden Hinweis auf den diebischen Charakter seines berühmten Namensvetters für den Fall, dass sein Gegenüber, dem er sich namentlich vorstellte, über das entsprechende Maß an abendländischer Bildung verfügte, um den namensgleichen Künstler kennen zu können. Meist war das nicht der Fall, und Schülern gegenüber konnte Hieronymus Bosch bereits seit einigen Jahren auf die Erläuterung zu seinem Namen verzichten.
Aus ganz ähnlichen Gründen schallte ihm aus der Schülerschaft auch schon seit Langem seines beruflichen Kürzels »HB« wegen der Spruch nicht mehr entgegen:
»Greif´ lieber zum HB, dann geht alles wie von selbst!«
Früher hingegen kam das schon gelegentlich vor, dass man ihn mit diesem geringfügig angepassten Zitat aus einer Zigarettenwerbung hochzunehmen versuchte, was dann immer anders als bei dem dabei als Vorbild dienenden »Hb-Männchen« der Trickfilmwerbung dazu führte, dass Hieronymus Bosch erst richtig »in die Luft« ging, aber inzwischen hatte sich der Spaß erledigt. Wer kannte denn noch das »Hb-Männchen«?
Jedenfalls mussten seine Eltern bei der Entscheidung für seinen Vornamen damals gehörig einen in der Krone gehabt haben, glaubte Hieronymus Bosch, auch wenn sie vielleicht die Kunst des Namensusurpators verehrt hatten. Für ihn gehörte sein Vorname in die Kiste mit der Aufschrift:
Was ich meinen Eltern nie verzeihen kann.
Zumal sie ihm auch keinen zweiten Vornamen gegönnt hatten, auf dessen Verwendung er sonst standardmäßig hätte ausweichen können. Zum Glück für ihn las er überhaupt keine Kriminalromane, nicht nur, weil er sie schlicht für »überkandidelt« hielt, also zu realitätsfern, sondern vor allem, weil er fand, dass das Leben auch so genug Aufregungen für ihn bereithielt. Anderenfalls hätte er sich bestimmt deutlich darüber aufregen müssen, dass ein US-amerikanischer Krimiautor ihm ebenfalls seinen Namen »geklaut« hatte für seinen polizeilichen Ermittler Hieronymus »Harry« Bosch.
Jetzt, da wir unseren Hieronymus Bosch schon ein wenig kennen gelernt haben und zuversichtlich sein dürfen, ihn noch besser kennen zu lernen oder sogar vertraut mit ihm zu werden, dürfen wir uns darauf beschränken, ihn nur noch mit seinem so ungeliebten Vornamen zu nennen, wie das ja auch andere tun, die niemals so vertraut mit ihm sein werden wie wir.
Nachdem Hieronymus seinen Wagen in die Parklücke bugsiert hatte, natürlich vorwärts mit zügigem Überrollen des Bordsteins, schließlich war sein Auto ja eigentlich geländegängig, stieg er aber nicht sofort aus, sondern hörte sich erst noch Once In Your Life von IDLEWILD zu Ende an:
»Life waits over the hill, over the hill ...«
Soviel Zeit musste einfach noch sein, denn unterwegs auf der Fahrt hörte man des Lärms wegen, den der Wagen verursachte, ja kaum etwas von der Musik.
Hieronymus hörte trotzdem unterwegs immer nur Musik vom Band, niemals Radio, denn für den allgemeinen »Dudelfunk« hatte er nichts übrig. Musik soll ja das Schmerzempfinden dämpfen, hatte Hieronymus einmal gehört. Er hielt sie deswegen für ideal für Leute seines Berufsstandes und war der Meinung, dass es sie auf Rezept geben sollte. Das ihn tagsüber ständig begleitende Gebrüll, Geschrei und Gekreische durchdrang die Wände, brachte sie zum Zittern, es drang ein in jeden Gedanken und vergiftete ihn genausoso wie jedes im Raum gesprochene Wort.
Bei Hieronymus` geländegängigem Wagen handelte es sich um einen Lada Niva, der aber nicht wie der in Wolfgang Herrndorfs Roman »tschick« eine hübsche hellblaue Farbe hatte, sondern seiner war in einem aufheiternden Grau. Ob aschgrau, steingrau, mausgrau, bleigrau oder sonst ein Grau ließ sich jedoch nicht genau bestimmen. Hieronymus Bosch hatte das Fahrzeug gebraucht von der Witwe des Vorbesitzers erworben, welcher ihn wegen seines Suizids nicht mehr verwendete. Ob bei dessen Depressionen, die letztlich zu seinem Selbstmord geführt hatten, das aufmunternde Grau des Lada eine Rolle gespielt hatte, ließ sich ebenfalls nicht mehr wirklich genau bestimmen. Da es sich um einen Psychotherapeuten gehandelt hatte, konnte es sein, dass die Wagenfarbe die therapeutischen Fähigkeiten seines Besitzers überstrapaziert haben mochte.
Natürlich wollte Hieronymus wegen der immerhin möglichen Rolle des Autos in der unglücklichen Biografie seines Vorbesitzers dieses eigentlich längst umlackieren lassen, in ein heiteres Schwarz zum Beispiel. Außerdem hatte er den bei abendlichem Herbstnebel in einer ihm unbekannten Gegend abgestellten Wagen schon zweimal erst bei Tageslicht am nächsten Tag wiederfinden können. Aber bisher hatte er es schon jahrelang bei der Absicht belassen, und derzeit war ja auch gerade Frühling und mit herbstlichem Nebel nicht unbedingt zu rechnen. Stattdessen hatte er dem Wagen ein Cassettenradio samt einer ordentlichen Lautsprecheranlage verpassen lassen. Nur literarisch interessierte Schüler oder solche, die sich zwangsweise im Deutschunterricht einmal mit dem Herrndorf-Roman hatten beschäftigen müssen, sprachen Hieronymus gelegentlich auf sein Auto an. Meist mit der Frage, ob das denn auch wirklich ein Lada Niva sei, denn natürlich konnten sie sich ein solches Auto nur in hellblau vorstellen.
Aber auch Hieronymus´ Haupthaar war bereits deutlich angegraut, und obwohl er glaubte, mitten im Leben zu stehen, hatte er doch bereits das Alter erreicht, bei dem sich junge Referendarinnen schwer taten mit dem kollegialen Du.