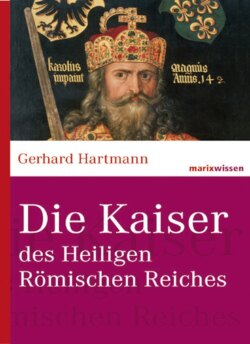Читать книгу Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches - Gerhard Hartmann - Страница 33
KAISER HEINRICH II.
Оглавление(1002–1024)
Ks. Heinrich II. wurde am 6. 5. 973 oder 978 möglicherweise in Hildesheim geboren. Seine Eltern waren Hz. Heinrich der Zänker von Bayern (951–995) und Gisela (950/55–1007), Tochter Kg. Konrads III. von Burgund († 993). Im Jahr 1000 ehelichte er KUNIGUNDE (um 975–1033), eine Tochter des Gf. Siegfried von Luxemburg (um 1919–998). Die Ehe blieb kinderlos.
Otto III. starb unverheiratet und kinderlos, so dass die Frage entstand, welchem nahen Verwandten die Nachfolge gelingen würde. In diesem Ringen setzte sich Herzog Heinrich von Bayern, der Sohn Heinrichs des Zänkers, durch. Er war ein Urenkel Kg. Heinrichs I. und stand damit genealogisch auf derselben Stufe wie Ks. Otto III.
Als Kg. Heinrich II. sein Amt antrat, war er ohne jede Illusion: In Italien tobte der Aufruhr, und die Polen nutzten das Interregnum, um Meißen zu besetzen. Für die idealistischen Vorstellungen seines Vorgängers war kein Platz mehr. Anstelle der renovatio imperii Romanorum Ks. Ottos III. sollte die renovatio regni Francorum treten.
Die damals stärkste Gefahr ging von Polen unter Boleslaw Chrobry (966–1025) aus. Die Auseinandersetzungen mit ihm beanspruchten Heinrich II. mit Unterbrechungen 15 Jahre lang. In dem schließlich Anfang 1018 abgeschlossenen Frieden von Bautzen blieben Meißen und Böhmen vor Boleslaws Zugriff bewahrt. Er musste auch die lehnsrechtliche Abhängigkeit vom Reich anerkennen. Mit Frankreich und Ungarn waren hingegen die Beziehungen ohne nennenswerte Probleme. In Italien gestalteten sich die Verhältnisse für Heinrichs II. jedoch am schwierigsten. Erst im Frühjahr 1004 kam er erstmals nach Italien, wo er zum rex Langobardorum gewählt und gekrönt wurde. Doch ein Aufstand zwang ihn, nach Deutschland zurückzukehren. Erst nach der zweiten Phase des Polenkriegs hatte er für Italien etwas mehr freie Hand. Zum Jahresende 1013 zog er rasch über die Alpen nach Rom und empfing zusammen mit seiner Gemahlin Kunigunde die Kaiserkrone. Im Frühsommer 1014 kehrte er zurück.
Die Stabilisierung an den Grenzen und die Durchführung der verschiedensten Heereszüge war Ks. Heinrich nur möglich, weil er zugleich eine erfolgreiche Innenpolitik betrieb. Dabei war er wie Otto der Große auf die herzogliche Gewalt bedacht. Hier bildete sich zunehmend die Nachfolge des meist ältesten Sohnes heraus, der als Lehnserbe angesehen wurde. Daher waren dem Kaiser/König bei der Herzogsnachfolge zunehmend enge Grenzen gesetzt. Somit wurde die Lehnsübertragung bald nur mehr ein formaler Akt, wie er bis zum Ende des Reiches 1806 dann charakteristisch war.
Deutlichere Akzente konnte Heinrich in seiner Kirchenpolitik setzen. Hier konnte er Vertraute zu Bischöfen ernennen. Die »kanonische Wahl« wurde auf ein schlichtes Zustimmungsrecht herabgestuft. Heinrich fühlte sich als »geweihter« König bzw. Kaiser sowohl für das Reich wie die Kirche zuständig. Diesen Synergismus zwischen Staat und Kirche, der dann von den nachfolgenden Saliern ausgebaut wurde, nennt man auch ottonisch-salisches Reichskirchensystem. In der Nachwelt besonders in Erinnerung blieb seine am 1.11.1007 auf einer Synode in Frankfurt vorgenommene Gründung des Bistums Bamberg, das sein Lieblingsort wurde.
Auf seinem rastlosen Weg durch das Reich in allen Belangen starb Ks. Heinrich II. in der Pfalz Grone. In dem aus seinen Mitteln erbauten Dom von Bamberg fanden er und später auch seine Gemahlin Kunigunde die letzte Ruhe. Dort hat man sein Gedächtnis besonders bewahrt und zu einem Kult gesteigert, so dass beide später heilig gesprochen wurden. Allerdings wird in neuester Zeit (Stefan Weinfurter) die »Heiligkeit« Heinrichs wegen dessen aus heutiger Sicht negativer Eigenschaften – man vermisst bei ihm u. a. die klassischen Herrschertugenden wie Barmherzigkeit und Milde – kritisch beurteilt.
Ks. Heinrich II. hat mit seiner sofortigen Rückverlegung des politischen Schwergewichts aus Italien nach Deutschland, mit seinen Sicherungsmaßnahmen an der Ost- und Westgrenze sowie mit seiner Vertiefung der religiösen Wurzeln und wirtschaftlichen Fundamente seines theokratischen Weihekönigtums das Erbe Ottos des Großen gesichert. Das Reich war bei seinem Tod gefestigt.