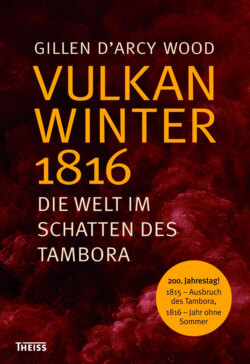Читать книгу Vulkanwinter 1816 - Gillen Wood - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Frankenstein-Wetter
ОглавлениеDer Unabhängigkeitskrieg zwischen Britannien und Amerika war mit dem Frieden von Paris im September 1783 zunächst beendet. Doch bis zur offiziellen Ratifizierung des Vertrags sollten wegen politischer Logistikprobleme und des anhaltend schlechten Wetters noch einige Monate vergehen. In Maryland war Annapolis, die provisorische Hauptstadt der Vereinigten Staaten, eingeschneit, weswegen die Kongressdelegierten das Vertragswerk nicht ratifizieren konnten, während Stürme und Eis auf dem Atlantik die Kommunikation zwischen den beiden Regierungen verzögerten. Am 12. Mai 1784 konnte Benjamin Franklin, der die Sache in Paris aushandelte, dann endlich den von König George höchstselbst unterzeichneten Vertrag an den Kongress senden.
Sogar während er sich noch damit abstrampelte, die kriegführenden Parteien zur Vernunft zu bringen, fand Franklin – ein unermüdlicher und sprunghafter Geist – die Zeit, über das veränderte Klima von 1783/1784 nachzudenken, das bei den jüngsten Ereignissen für so große Komplikationen gesorgt hatte. »Es scheint hoch oben in der Luft über allen Ländern eine Region zu geben, in der stets Winter herrscht«, schrieb er. Doch möglicherweise könnten der »universelle Nebel« und die Kälte, die aus der Atmosphäre herabgestiegen waren und ganz Europa eingehüllt hatten, einer vulkanischen Aktivität, insbesondere einem Ausbruch im nahen Island zugeschrieben werden.1
Franklins »Meteorological Imaginations and Conjectures« umfassen lediglich wenige Seiten mit zusammenhanglos hingeworfenen Gedanken, die er mitten in einem hochriskanten diplomatischen Drama niedergeschrieben hatte. Der unwahrscheinlich erscheinende Ruhm des Artikels als wissenschaftliches Dokument beruht darauf, dass es sich dabei um die erste veröffentlichte Theorie über eine Verbindung zwischen Vulkanismus und Wetterextremen handelt. Franklin schickte seinen Meteorologie-Artikel eiligst nach Manchester, wo ihm die ortsansässige Literary and Philosophical Society die Ehrenmitgliedschaft verliehen hatte. Am 22. Dezember 1784 erhob sich der Präsident der Gesellschaft, um in Franklins Namen zu sprechen. Zweifelsohne bestürzt über die Kürze des Aufsatzes, blieb ihm dennoch nichts anderes übrig, als die »Konjekturen« des berühmten neuen Mitglieds dem versammelten Auditorium zu Gehör zu bringen. Dort, in einem frostig-kalten Saal in Manchester, wurde die Theorie, dass Vulkanausbrüche das Klima ins Chaos stürzen können, zum ersten Mal öffentlich gemacht.
Zunächst schenkte niemand der Theorie Glauben. Noch während der Saal sich lehrte, war Franklins Idee der lange währenden Vergessenheit zu früh verkündeter Wahrheiten anheimgefallen. Aber er hatte natürlich recht. Der Ausbruch des isländischen Vulkans Laki im Juni 1783 brachte Europa im darauffolgenden Jahr eine abrupte Abkühlung, Missernten und Not und bescherte der Schifffahrt auf dem Atlantik gefährlich eisige Bedingungen. Aber dennoch hatte die Eruption keine weltweiten Folgen. Für die Beziehung zwischen Vulkanausbrüchen und Klima ist der Breitengrad von entscheidender Bedeutung. Da der Vulkan hoch im Norden liegt, gelangte das Auswurfmaterial des Laki nicht in die trans-hemisphärischen Strömungen des Klimasystems unseres Planeten und blieben seine meteorologischen Auswirkungen auf den Nordatlantik und Europa beschränkt.
Vor zweihundert Jahren hat niemand – nicht einmal Benjamin Franklin – den potenziell globalen Effekt vulkanischer Emissionen aus den Tropen begriffen, wo sich zwei Jahrzehnte nach der Laki-Eruption der größte Ausbruch des Jahrtausends auf unserem Planeten ereignete. Als der Tambora – auf der Insel Sumbawa in Südostasien – sich mit apokalyptischer Urgewalt im April 1815 in die Luft sprengte, brachte niemand dieses einzelne, geologische Ereignis, über das kaum berichtet wurde, mit den in rascher Folge eintretenden weltweiten Wetterkatastrophen in den drei Jahren danach in Verbindung.
Abbildung 1 Dieses Modell von der Sulfatwolke des Tambora aus dem Jahr 2007 zeigt deren globale Ausdehnung mit je einem Band hoher Aerosolkonzentrationen in den mittleren und hohen Breiten auf beiden Halbkugeln, insbesondere über dem Nordatlantik und Westeuropa. Die vulkanische Wolke befindet sich in diesem Modell in der Stratosphäre, 24 bis 32 Kilometer hoch über der Erde.
Innerhalb weniger Wochen hatte die stratosphärische Aschewolke des Tambora die Erde am Äquator umrundet, von wo sie sich anschickte, nach und nach auf allen Breiten das globale Klimasystem zu sabotieren. Im September 1815, fünf Monate nach dem Ausbruch, beobachtete Thomas Forster, der sich für die Meteorologie begeisterte, merkwürdige spektakuläre Sonnenuntergänge über Tunbridge Wells nahe London. »Schöner trockener Tag«, schrieb er in sein Wettertagebuch, aber »bei Sonnenuntergang eine feine rote Färbung, gekennzeichnet durch auseinanderstrebende rote und blaue Querstreifen.«2 Künstlern in ganz Europa fiel die veränderte Atmosphäre auf. William Turner malte leuchtend rote Himmel, die in ihrer farblichen Abstraktion wie ein Werbeplakat für diese spätere Kunstrichtung wirken. Zur gleichen Zeit schuf Caspar David Friedrich in seinem Atelier am Hafen von Greifswald einen Himmel mit einer chromsäurehaltigen Dichte, die – wie eine wissenschaftliche Studie feststellte – der »optischen Aerosoltiefe« des kolossalen Vulkanausbruches in jenem Jahr entsprach.3
Abbildung 2 Caspar David Friedrich, Ansicht eines Hafens (Greifswalder Hafei 1815/16), Schloss Sanssouci, Potsdam.
Forster, Turner und Friedrich – allesamt begeisterte Himmelsbeobachter – sahen den sichtbaren Ausdruck großer atmosphärischer Veränderungen im Nordatlantik. Aber weder Forsters Londoner Himmel »in Flammen« im September 1815 noch die knapp drei Jahre währende verheerende globale Abkühlung, die folgte, brachten irgendjemanden zu der Erkenntnis, dass ein weit entfernter Vulkanausbruch all dies verursacht hatte. Erst mit dem Kalten Krieg – und der Entwicklung meteorologischer Instrumente zur Messung des nuklearen Fallouts – fingen die Wissenschaftler an, das Vorkommen vulkanischer Aerosole in der Atmosphäre zu untersuchen. Der die Sonne abschirmende Staubschleier eines großen Ausbruches, so die Schlussfolgerung, kann bis zu drei Jahre lang über der Erde hängen. Zweihundert Jahre nach Franklins erster, vorsichtig tastender Theorie konnte die geophysikalische Kette, die Vulkanismus und Klima verbindet, endlich bewiesen werden.
Ich behandle diesen Punkt aus gutem Grund so ausführlich. Die gewaltige, manchmal unfassbare Herausforderung, dieses Buch zu schreiben, bestand darin, kataklysmische Weltereignisse nachzuzeichnen, deren Ursache den zeitgenössischen Akteuren selbst nicht bekannt war. Den Historikern erging es über viele Generationen hinweg kaum besser. Die durch den Tambora ausgelöste Klimakatastrophe erfolgte kurz nach den Verheerungen der Napoleonischen Kriege und stand stets im Schatten dieses epochalen Konflikts. Aus den Augen und aus dem Sinn, war der Tambora der vulkanische Tarnkappenbomber des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Dem mit Brechreiz kämpfenden Choleraopfer in Kalkutta, den verhungernden Bauernkindern in Yunnan oder County Tyrone, dem hoffnungsfrohen Erforscher einer Nordwestpassage durch das Arktische Meer oder dem bankrotten Landspekulanten in Baltimore, den Menschen auf der Welt war nicht klar, dass ihr Schicksal von einem Vulkan bestimmt wurde. Genauso schwierig für mich als Umwelthistoriker war es, die räumlich so weit auseinanderliegende Beziehung zwischen Ursache und Wirkung zu erfassen, indem ich zu messen versuchte, wie groß die Auswirkungen des Tambora-Ausbruches auf die Weltgemeinschaft im neunzehnten Jahrhundert waren. Die Unruhe, die der Vulkan verursachte, legte, auch über verschleierte Agenzien, große Distanzen zurück. Aber nur durch das Aufspüren solcher »Telekonnektionen« – einem Leitprinzip der Klima- und Umweltwissenschaften von heute – lässt sich die weltweite Tragödie des Tambora aus ihrer zweihundert Jahre währenden Vergessenheit holen.
Abbildung 3 Die Caldera des Tambora. An dem Morgen (am 3. März 2011), als das Foto aufgenommen wurde, rumpelte der Vulkan und war Schwefelgeruch wahrzunehmen. Ein paar Wochen danach begann der Feuerberg, Asche und Rauch zu spucken. Im September jenes Jahres haben die indonesischen Seismologen die Evakuierung des umgebenden Gebiets angeordnet. Die Vulkanologen gehen jedoch nicht davon aus, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, da das Ereignis von 1815 geologisch gesehen noch nicht lange zurückliegt.
Der Klimawandel ist schwer zu sehen und fast genauso schwer vorstellbar. Nachdem ich einen Tag lang vom tropischen Regen durchnässt durch die dichten Wälder auf der Insel Sumbawa geklettert war, gelang es mir fast nicht, den großartigen entleerten Gipfel des Tambora mit eigenen Augen zu sehen. Dann, bei Tagesanbruch am zweiten Morgen, hoben sich die Wolken mit einem Mal, und wir konnten den Aufstieg über die baumlosen Bergkämme vollenden. Während wir uns dem Gipfel näherten, kraxelten wir über seichte Lohetümpel und rauen Fels und hinterließen mit unseren Stiefeln Abdrücke im schwarzen Vulkansand. Beinahe ohne jede Vorwarnung fanden wir uns am Rand des großen umgedrehten Doms wieder, von dem Wände aus schierem Fels eintausend Meter tief hinab zu einem perlgrünen See führen. Meine Kamera surrte, als Puffwölkchen aus Schwefel träge Inversionen in dem stillen eigenen Universum der gähnenden Caldera des Tambora vollführten. Deren Durchmesser hätte anstatt der sechs auch tausend Kilometer betragen können. Mit meinem verschwimmenden Blick konnte ich nicht besser als meine Kamera von dem nicht verheilten Verdauungscanyon des Vulkans Maß nehmen, geschweige denn mir den einst jungfräulichen Gipfel eine Meile über uns am nunmehr offenen Himmel vorstellen. Als wir in der Nacht zuvor schlaflos und feucht in unseren Zelten lagen, hatten wir tief im Inneren der Erde ein Rumoren gespürt. Jetzt fiel uns der unmissverständliche Geruch von Schwefel in der Morgenluft auf. Als ich kurz zu Boden schaute, damit meine Sinne sich erholen konnten, merkte ich, dass ich auf schwammartigem Gestein stand, das nach geologischem Zeitmaßstab nur einen Lidschlag zuvor noch im brodelnden Magma der unterirdischen Kammer des Tambora umhergetrieben war.
Abbildung 4 Das Luftbild von der Caldera des Tambora, von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen, zeigt deren grandiose, mondähnliche Dimensionen.
Als ich dann über den schwindelerregenden Krater blickte, fühlte ich mich nicht besser gerüstet als der Pioniermeteorologe Thomas Forster im Jahr 1815, die katastrophale Wirkung der Explosion eines einzigen Berges auf die Geschichte der modernen Welt zu begreifen. Es war ein ruhiger Sonnenaufgang. Über den Baumspitzen kam die Bucht Telek Saleh in Sicht, das postkartenblaue Wasser war im milchigen Sonnenlicht mit Inseln getupft. Hinter uns erstreckten sich die Wälder der Halbinsel Sanggar, sie wirkten vollkommen friedlich. Hatte hier tatsächlich ein Ereignis von weltverändernder Urgewalt stattgefunden? Genauso wie die fröstelnden Zuhörer in jenem Saal in Manchester zweihundert Jahre zuvor sich bemüht hatten, Franklins Gerede über das kalte Wetter und einen isländischen Vulkan einen Sinn abzugewinnen, konnte ich die globale Tragweite der Tambora-Eruption schier nicht glauben.
Fünf Jahre Forschung in der Vulkan- und Klimawissenschaft, die Zusammenarbeit mit Gelehrten aus zahlreichen Disziplinen und oftmals zähe Detektivarbeit waren notwendig gewesen, um den Ausbruch des Tambora an jenem Morgen in meiner Vorstellungskraft wiedererstehen zu lassen: um, in Form eines Buches, die jahrelangen Auswirkungen der schweren Eruption von 1815 auf die Welt in der kritischen Phase nach den Napoleonischen Kriegen deutlich zu machen. Im Gegensatz zu Benjamin Franklin und Thomas Forster hatte ich den Vorteil, dass mir moderne wissenschaftliche Instrumente und Daten zur Verfügung standen, mit deren Hilfe ich die ansonsten nicht sichtbaren Telekonnektionen zwischen tropischen Vulkanausbrüchen, einer Klimaveränderung und dem Leben der Menschen zu »sehen« vermochte. Wer den Tambora auf dieser Route erklommen hat, kann dessen Größe nicht verkennen.
Der Tambora gehört zu einem dichten Vulkancluster am Sundabogen des Indonesischen Archipels. Diese sich von Ost nach West ziehende Vulkankette ist wiederum ein Teil des viel größeren Feuerrings, eines die Hemisphäre umspannenden Gürtels von Feuerbergen, die von der Südspitze Chiles über den Mount St. Helens im US-Bundesstaat Washington und den pittoresken Fuji in Japan bis hin zu Tamboras nächstem Nachbarn Krakatau, der 1883 zu weltweiter Berühmtheit explodierte, den Pazifik umschließen. Dieser fast 40.000 Kilometer lange Feuerring hat erhabene Vulkankegel vorzuweisen, und zwar ausschließlich an Küsten und auf Inseln. Der Tambora liegt rund 830 Kilometer nördlich einer tektonischen Rinne im transpazifischen Feuerring, die Sundagraben genannt wird und südlich von Sumbawa und den Nachbarinseln Lombok und Sumba einen Bogen schlägt.
Nach einer Ruhephase von möglicherweise tausend Jahren dauerten die desaströse Entleerung und der Einsturz des Tambora im April 1815 nur wenige Tage. Und ebendiese konzentrierte Energie des Ereignisses sollte die stärkste Wirkung auf die Menschen haben. Indem der Tambora seinen Inhalt mit solch biblischer Urgewalt in die Stratosphäre schleuderte, sorgte er dafür, dass seine vulkanischen Gase weit genug nach oben gelangten, um die jahreszeitlichen Rhythmen des globalen Klimasystems tiefgreifend stören und weltweit menschliche Gemeinschaften ins Chaos stürzen zu können. Die stratosphärischen Aerosole, die beim Ausbruch des Tambora 1815 entstanden und die Sonne abschirmten, verursachten die verheerendste, langanhaltende Periode extremen Wetters, die unser Planet seit womöglich Tausenden von Jahren erlebt hatte.
Schon für sich genommen eine dramatische Story. Doch meiner Geschichte des Tambora liegt ein noch akuteres Motiv zugrunde. Der große Ausbruch auf Sumbawa ist der jüngste, der einen drastischen Effekt auf das globale Klima hatte. Nach der Zeitrechnung der Geologie ereignete sich die Tambora-Eruption fast schon aufdringlich nah an unserer Zeit und schreit geradezu danach, untersucht zu werden. Am Vorabend des zweihundertjährigen Jahrestages seines Ausbruches und angesichts unserer eigenen, sich vervielfachenden Extremwetterkrisen rückt diese Eruption drohend als die ergiebigste Fallstudie ins Blickfeld, die wir haben, um zu verstehen, wie abrupte Klimaänderungen sich auf menschliche Gesellschaften in globalem Maßstab und über Jahrzehnte hinweg auswirken. Die Tambora-Klimakatastrophe von 1815 bis 1818 eröffnet uns ein wertvolles und anschauliches Fenster auf eine Welt, die von Wetterextremen erschüttert wurde und in der menschliche Gemeinschaften überall damit kämpften, sich an plötzliche radikale Verschiebungen bei Temperaturen und Niederschlägen sowie an einen nachfolgenden Tsunami aus Hungersnot, Krankheit, Entwurzelung und Umwälzungen anzupassen.
In den drei Jahren nach dem Ausbruch des Tambora zu leben bedeutete nahezu überall auf der Welt, zu hungern. In Neuengland hieß das Jahr 1816 »Jahr ohne Sommer« oder »Achtzehnhundertunderfroren«. In Deutschland wurde 1817 das »Hungerjahr« genannt. Überall auf dem Globus verdarben die Ernten durch Fröste und Dürren oder wurden von Regenfluten weggespült. In den Dörfern Vermonts überlebten die Menschen nur durch den Verzehr von Igeln und gekochten Brennnesseln, während die Bauern im chinesischen Yunnan den weißen Lehmboden der Felder aßen. Sommertouristen, die durch Frankreich reisten, hielten die vielen Bettler auf den Straßen für Heere auf dem Marsch.
Eine solche englische Reisegruppe überstand die kalten Tage, in denen die Ernten vernichtet wurden, in ihrer Villa am See bei Genf vor dem Kaminfeuer, wo sie Schauergeschichten austauschten. Mary Shelleys sturmgepeitschter Roman Frankenstein trägt den Stempel des Tambora-Sommers 1816, und ihre literarische Clique – zu der die Dichter Percy Bysshe Shelley und Lord Byron zählten – wird uns immer mal wieder als Tourenführer durch die leidende Welt von 1815 bis 1818 dienen. Wie ein Literaturhistoriker festgestellt hat: »Nie gab es eine besser dokumentierte Gruppe von Leuten« als Mary Shelleys Kreis von Freunden und Liebhabern. Die Spur ihrer Eindrücke, die sie uns aus den späten 1810er Jahren auf Papier hinterließen, wird uns immer wieder zum Tambora zurückführen.4
Im frühen neunzehnten Jahrhundert sah sich die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung (anders als Dr. Frankenstein) den gnadenlosen Naturgewalten ausgeliefert: Die meisten Menschen lebten von der Subsistenz-Landwirtschaft und hangelten sich prekär von Ernte zu Ernte durch. Als 1816, und auch im folgenden Jahr, weltweit die Ernten ausfielen, strömten von Indonesien bis Irland Legionen an hungernden Bauern vom Land in die Marktflecken, wo sie um Almosen bettelten oder im Tausch gegen Nahrung ihre Kinder verkauften. Durch Hungersnot begünstigte Krankheiten, wie Cholera und Fleckfieber, suchten den Globus von Indien bis Italien heim, während die Preise für Brot und Reis, die Grundnahrungsmittel der Welt, ohne Aussicht auf ein Ende in den Himmel schossen.
Überall auf dem europäischen Kontinent, der durch die Napoleonischen Kriege verwüstet war, sahen sich Zehntausende entlassene Veteranen außerstande, ihre Familien zu ernähren. Sie machten ihrer Verzweiflung in Revolten auf den Marktplätzen und in Brandschatzungen Luft, die sie wie militärische Feldzüge organisiert ausführten, während die Regierungen überall Revolutionen befürchteten. Menschliche Tragödien entfalten sich selten, ohne dass es auch Nutznießer derselben gibt. In dieser anhaltenden globalen Hungersnot, die erst mit den Rekordernten von 1818 ihr Ende fand, ging es den Bauern in Russland und im »Wilden Westen« Amerikas so gut wie nie zuvor, da sie ihr Getreide an die verzweifelten Aufkäufer in der atlantischen Handelszone zu stratosphärisch hohen Preisen abgaben. Doch für die meisten Menschen anderswo auf der Welt war es die »allerschlimmste Zeit«.
Der Zeitraum nach dem Tambora-Ausbruch, vor allem das »Jahr ohne Sommer« 1816, ist reich an Folklore und nach wie vor ein beliebtes Thema historischer Sachbücher. Doch diese Darstellungen beschränken sich auf 1816 und die Auswirkungen des Tambora auf Europa und Nordamerika.5 Mit der verlässlichen und stetig weiter anwachsenden wissenschaftlichen Literatur zum Tambora, Vulkanismus und globalen Klimawandel hat sich noch niemand ernsthaft befasst. Ich erfuhr vom Ausbruch dieses Feuerberges nicht aus einem Geschichtsbuch, sondern in einem Seminar der Atmosphärenwissenschaft, und mein erster aufgeregter Gedanke war: Es ist höchste Zeit, dass die Historiker beim Thema Tambora zu den Klimatologen aufschließen. Dieses Buch bleibt, durch alle Verästelungen seiner Entstehung, das Produkt dieser ersten Eingebung. Vulkanwinter ist die erste Untersuchung dieser ikonischen Zeitperiode, die eine vulkanologische Darstellung der Eruption von 1815 mit der Folklore des »Jahres ohne Sommer« wie auch dem ganzen Spektrum der biophysikalischen Wissenschaften, die für den Klimawandel von Bedeutung sind, zusammenführt. Es ist das erste Buch, in dem das Tambora-Ereignis nicht als Naturkatastrophe eines einzigen Jahres, nämlich 1816, sondern als die drei Jahre währende Episode einer drastischen Klimaveränderung, deren Auswirkungen bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein verfolgt werden können, behandelt wird.
Ich konzentriere mich hier auf die Geschichte der Menschen nach dem Ausbruch des Tambora. Doch durch die Beschäftigung mit der detaillierten Diskussion des Vulkans in der neueren wissenschaftlichen Literatur kann ich die Geschichte auf mehreren räumlichen Ebenen, von der molekularen bis zur globalen, erzählen. Mein Schwerpunkt in methodischer Hinsicht liegt nicht so sehr auf dem Einfluss der Natur auf die Geschichte – und noch weniger auf einem kruden Umweltdeterminismus –, sondern auf dem Tambora als Fallstudie zur fragilen Interdependenz menschlicher und natürlicher Systeme. Anders ausgedrückt: Dieses Buch betrachtet die ganz unterschiedlichen menschlichen Gemeinschaften von 1815 bis 1818 – und die Klimazonen, an die sie sich angepasst haben – als ein einziges anthropo-ökologisches Weltsystem, auf das der Tambora wie ein massiver traumatischer Störfall einwirkte. Nach dem April 1815 wurden viele menschliche Gesellschaften »verändert, verändert ganz und gar« – um eine Anleihe bei dem Dichter William Butler Yeats zu machen – und radikal aus ihrer bisherigen Verfasstheit gerissen. Bei meinen Feldstudien und Recherchen habe ich nicht alle Kontinente bereist. In manchen Weltgegenden – vor allem in Afrika, Australien und Lateinamerika – sind die zeitgenössischen Daten dünn oder überhaupt keine Archive vorhanden. Doch das Buch ist trotzdem ein reichhaltiger und einzigartiger Reisebericht, indem es die Hemisphären durchwandert und auf diese Weise die formgebende Hand dieses epochalen Ausbruches für die Geschichte der Menschheit nachzeichnet.
Überall in Asien beispielsweise – dessen Tambora-Geschichte noch nie erzählt wurde – waren die Auswirkungen der Eruption wohl am verheerendsten. Ein berühmtes antikes Genre der chinesischen Dichtkunst ist die Lyrik der Sieben Schmerzen. In solch einem Gedicht dramatisiert der Dichter, wie die fünf Körpersinne angegriffen werden, überlagert von der doppelten seelischen Drangsal der Ungerechtigkeit und Bitterkeit: insgesamt sieben Schmerzen. Das erste Gedicht dieses Genres stammt aus dem dritten Jahrhundert und erzählt von einem Mann, der durch den Bürgerkrieg aus seinem Heim vertrieben wird, eine Art Dante auf Chinesisch. Der leidgeprüfte Dichter Wang Can sieht reihenweise Leichen auf der Straße und begegnet einer von Qualen geplagten Frau, die ihr Kind auf den verdorrten Feldern ausgesetzt hat. Sie kann es nicht mehr ernähren, aber sie bleibt in der Nähe und lauscht seinem Weinen. Wie wir in Kapitel 5 sehen werden, erlebte der antike Lyrikstil der Sieben Schmerzen in der Tambora-Zeit von 1815 bis 1818 eine Renaissance, da er so gut das menschliche Leid wiedergab, das ein drei Jahre dauernder Klimakollaps verursacht hatte. Der in Vergessenheit geratene chinesische Dichter Li Yuyang, so stellt sich heraus, sprach so bewegend wie kein anderer für die vom Wetter verheerte Welt der späten 1810er Jahre.
Die Berichte über den Kollaps der Umwelt und die menschliche Tragödie, die Überlebende wie Li Yuyang uns hinterließen, müssen stellvertretend für die zahllosen historischen Zeugnisse eines individuellen wie kollektiven Traumas in der Tambora-Zeit stehen, die für immer verloren gegangen sind. Nach einer Megakatastrophe wie der Eruption dieses Vulkans verrät uns der Mangel an Schilderungen von Seiten der Opfer selbst etwas über das Ausmaß des Kataklysmus, aber auch darüber, wer dessen Hauptlast trug: die Millionen armen und ungebildeten Bauern der Welt im frühen neunzehnten Jahrhundert. Genau wie meine Sehkraft mich angesichts der schwindelerregenden Wirbel der weiten Caldera des Tambora im Stich ließ, so liegt auch ein umfassendes Panorama der menschlichen Krisen, die der Berg auslöste, jenseits des Machbaren. Doch mit einem Blick in der Sichtweise des einundzwanzigsten Jahrhunderts – mit dem Nachzeichnen der komplexen Telekonnektionen zwischen der Erde, dem Himmel und dem Schicksal der Menschen – lässt sich vielleicht zumindest die drunter und drüber gehende Geschichte einer zweihundert Jahre alten globalen Klimakrise angemessen erzählen und damit als Warnung unser eigenes Schicksal vorhersagen.