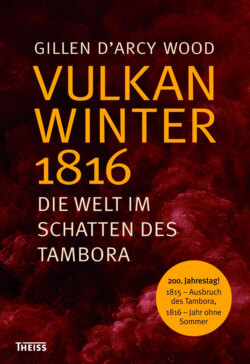Читать книгу Vulkanwinter 1816 - Gillen Wood - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Das Pompeji des Ostens Zeit des Ascheregens
ОглавлениеAm 10. April 1815 war Napoleon Bonaparte, kurz zuvor von der Insel Elba entkommen, wieder in Paris und zu seinen gewohnten Winkelzügen bereit. Während er einen alten Feind – den liberalen Publizisten Benjamin Constant – charmierte, eine neue französische Verfassung zusammenzustellen, die demokratische Rechte garantierte, traktierte er seinen Freund, den General Davout, eine Armee von 500.000 Mann aufzustellen. Der mit neuer Energie erfüllte Napoleon hatte vor, die volle diktatorische Gewalt über Frankreich und so weit als möglich über Europa wieder für sich zu reklamieren.
Drüben in Wien hatte am 10. April 1815 die adlige Elite Europas die endlose Abfolge von Bällen und Festbanketten abgebrochen, um die Aufgabe, den Kontinent zu zerstückeln, rascher zu erledigen. Jeder kleine Fürst und enteignete Graf des Ancien Regime war dort, um sich ein Lehnsgut zu sichern, während die Großmächte Land hin und her schoben wie Karten beim Baccarat. »Wir beenden die traurige Aufgabe des Kongresses, die das scheußlichste Stück Arbeit darstellt, das man je gesehen hat«, schrieb der Diplomat Emmerich Joseph von Dalberg.1 In der Zwischenzeit war der Herzog von Wellington in Brüssel eingetroffen, wohin er von Wien geeilt war, um die alliierten Streitkräfte gegen Napoleon zu organisieren, und das er allerdings ohne Truppen und Waffen vorfand. Beide Seiten waren von dem zwanzig Jahre währenden Konflikt erschöpft und in Auflösung begriffen, und ganz Europa erwartete einen schlimmen Flächenbrand mit ungewissem Ausgang.
Abbildung 5 Karte von Niederländisch-Ostindien im neunzehnten Jahrhundert. Kautschuk, Gewürze, Reis, Tabak, Nickel und Zinn zählten zu den Handelsgütern, die bei europäischen und chinesischen Kaufleuten sehr begehrt waren.
Am anderen Ende der Welt, auf Sumbawa – einem abgelegenen Inselaußenposten des europäischen Krieges im blauen Meer östlich von Java – war der Übergang zur Trockenzeit im April für die einheimischen Bauern eine geschäftige Phase. In wenigen Wochen würde der Reis reif sein, und der Radscha von Sanggar, einem kleinen Königreich an der Nordostküste der Insel, würde seine Leute zur Ernte auf die Felder schicken. Bis dahin arbeiteten die Männer seines Dorfes Koteh weiter in den umliegenden Wäldern und fällten Sandelholzbäume, die für die Schiffbauer auf den viel befahrenen Seefahrtsstraßen von Niederländisch-Ostindien von größter Bedeutung waren.
Auf den Feldern von Sanggar und dem halben Dutzend benachbarten Inselkönigreichen bauten die Menschen Mungbohnen, Getreide und Reis an, aber auch Feldfrüchte für den lukrativen regionalen Markt: Kaffee, Pfeffer und Baumwolle. Andere sammelten Honig oder an den Meeresklippen die Nester winziger Vögel, ein Aphrodisiakum, das bei den wohlhabenden, liebeskranken Chinesen sehr gesucht war. Auf den Wiesen des Dorfes pflegten die berühmten Pferdezüchter von Sumbawa ihre Tiere.2 Gegen diese Handelsgüter tauschten der Radscha und seine Dörfler eine Reihe praktischer Dinge und Luxuswaren, wie Vieh, Salz und Gewürze von den Inseln im Osten, Bronzeschalen aus China und hübsch verzierte Töpfe aus dem heutigen Kambodscha und Vietnam.3
Abbildung 6 Diese Karte von Sumbawa zeigt, wie sehr der Tambora die nordöstliche Sanggar-Halbinsel dominiert, die seit 1815 nur dünn besiedelt ist. Bima, die Hauptstadt der Insel, liegt im Osten. Im Westen, auf der Karte nicht zu sehen, befinden sich die kleineren, jedoch besser bekannten Inseln Lombok und Bali, und hinter diesen liegt Java, die Hauptinsel der Region. Der östliche Nachbar von Sumbawa ist die Insel Komodo, die Heimat der berühmten »Drachen«-Echse, des Komodowarans.
Sumbawa war rund vierhundert Jahre zuvor von Menschen der benachbarten größeren Inseln Java, Celebes und Flores besiedelt worden. Diese Pioniere wandelten große Areale der dicht bewaldeten Landschaft in Reisfelder und Grasland als Weide für das Vieh und Pferde um. Sumbawa konnte sich vor dem Ausbruch des Tambora einer großen Vielfalt an Ethnien und Sprachen rühmen. Die Bewohner der nordöstlichen Sanggar-Halbinsel beispielsweise sahen völlig anders aus als ihre Mitmenschen auf der Westseite von Sumbawa; auch verstanden sie die Sprache der jeweils anderen nicht. Von den Mutterinseln hatte Celebes den stärksten Einfluss auf Sumbawa als eine Art Vasallenstaat aufrechterhalten und erlegte von der mächtigen Hauptstadt Makassar aus den Sumbawanern drückende Steuern auf. Dann, im siebzehnten Jahrhundert, kamen die Holländer und beanspruchten die Region für sich. Es war für die Sumbawaner ein Glück, dass die Niederländer kaum Interesse an der Insel zeigten, aber zur gleichen Zeit die Macht von Makassar einschränkten. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts befand sich danach Sumbawa in einer besseren Situation als jemals zuvor: Es war wirtschaftlich in die Region integriert, jedoch auch mit einem gewissen Maß an politischer Unabhängigkeit ausgestattet.
Trotz seines Wohlstands konnte sich der Radscha von Sanggar allerdings nicht entspannt zurücklehnen. Nun, da sich die Bedingungen fürs Segeln nach dem Nachlassen der Regenfälle gebessert hatten, hielt er ein wachsames Auge auf die Piraten vom Sulu-Archipel im Norden, die auf der Suche nach menschlicher Beute für den Sklavenmarkt die Küstendörfer überfielen.4 Mit ihren schnittigen Segelschiffen, die bis zu einhundert bewaffnete Männer trugen, und einem Händchen für Überraschungsangriffe waren die Piraten für die Menschen von Sanggar ein entsetzlicher Anblick. Wurden sie früh genug gewarnt, konnten die jungen Männer tief in den Wald flüchten. Aber jeder war verwundbar, und der Radscha kann nicht ohne Angst an seine eigenen Kinder gedacht haben. Einmal von den Piraten geschnappt, wären ihre ererbten Privilegien – und ihr glückliches Dorfleben auf Sumbawa – für immer Geschichte. Aber die Sklaverei war eine Gegebenheit des Lebens. Während Ressourcen auf den Inseln im Überfluss vorhanden waren, traf das für Arbeitskräfte nicht zu. Menschen waren folglich die wertvollste Ware, und der Seehandel mit Frischfleisch war grausam und erbarmungslos. Zwischen 1770 und den 1840ern wurden mehrere hunderttausend Menschen auf den Sklavenmärkten Ostindiens verkauft. Es war das größte Sklavenhandelssystem außerhalb der atlantischen Zone.5
Ein anderer Grund zur Angst war naheliegender: der herrliche Berg Tambora, der höchste Gipfel in einem Archipel, der mit wolkenverhangenen Vulkanbergen gesegnet war. Die breiten bewaldeten Hänge des Tambora beherrschten die Halbinsei Sanggar, und sein Doppelgipfel diente der Schifffahrt – und den Piraten – als wichtige Navigationshilfe. Der seit Langem schlafende Tambora hatte einige Jahre zuvor ab und an zu rumpeln begonnen und von seinem Gipfel in luftiger Höhe dunkle Wolken ausgesandt. Ein britisches Schiff, dessen Kapitän der Diplomat und Naturforscher John Crawfurd war, segelte 1814 nah an dem »rülpsenden« Berg vorbei:
In der Ferne schwärzten die Aschewolken, die er ausstieß, eine Seite des Horizonts auf derartige Weise, dass sie den Anschein eines heraufziehenden tropischen Sturmes vermittelten … Als wir näher kamen, wurde die wahre Natur des Phänomens offenbar, und es fiel sogar Asche aufs Deck.6
Vor Ort gingen die Meinungen zur Ursache für das torkelnde Erwachen des Berges auseinander. Manche hielten es für eine Hochzeit bei den Göttern, während andere die Sache schwärzer sahen. Das Rumoren sei ein Zeichen des Zorns, sagten sie. Bei einem unrühmlichen Vorfall hatte ein sumbawanischer Häuptling einen muslimischen Pilger getötet. Eine heute noch auf der Insel beliebte Sage berichtet von einem zu Besuch weilenden »Scheich«, einem heiligen Mann, der außer sich darüber war, dass in der heimischen Moschee die Hunde frei herumliefen. Als die verletzten Einheimischen ihm aus Rache Hundefleisch vorsetzten, durchschaute der Scheich den Trick und begann zu beten. Im nächsten Moment war er verschwunden, war der geschlachtete Hund wieder lebendig und hob der Vulkan zu grollen an.7 Wieder andere glaubten, die Götter wären erzürnt, weil die Menschen zugelassen hatten, dass fremde weiße Männer mit ihren Schiffen und Waffen sie auf den Plantagen im nahen Java und Makassar versklavten.8
Der Radscha nahm all dies persönlich. In ganz Ostindien stellte der Vulkanismus ein Symbol der politischen Macht dar. Sultane zum Beispiel präsentierten sich als Nachkommen des Berggottes Shiva.9 Demzufolge galten Vulkanausbrüche als Spiegel menschlicher Angelegenheiten, als Strafe für die schlechte Verwaltung seitens der Regierenden. Das Rumpeln des Tambora war für den Radscha eine schlechte Nachricht. Es beunruhigte sein Volk und unterminierte in dessen Augen seine Legitimation.
Am Abend des 5. April 1815, ungefähr zu der Zeit, als seine Diener das Geschirr vom Abendessen abräumten, hörte der Radscha einen ungeheuren Donnerschlag.10 Vielleicht dachte er zunächst panisch, die Strandwache sei eingeschlafen und habe es so einem Piratenschiff ermöglicht, sich an die Küste heranzuschleichen und seine Kanone abzufeuern. Doch stattdessen starrten alle hoch zum Tambora. Von dessen Gipfel schoss ein Feuerstrahl in den Himmel, erleuchtete die Dunkelheit und ließ die Erde unter ihren Füßen erzittern. Der Lärm war unglaublich und schmerzhaft.11
Hohe Feuersäulen stiegen drei Stunden lang aus dem Berg auf, bis der dunkle Aschenebel sich mit der natürlichen Dunkelheit vermischte und das Ende der Welt anzukündigen schien. Dann, so plötzlich wie alles begonnen hatte, fiel die Wolke in sich zusammen, hörte die Erde zu beben auf und verstummte das durch Mark und Bein gehende Getöse. In den folgenden Tagen grollte der Tambora erneut gelegentlich, wobei auch Asche vom Himmel fiel. Doch für den Radscha schien die Katastrophe damit vorüber zu sein. Seine vorrangige Sorge galt der unmittelbar bevorstehenden Reisernte. Die Dorfbewohner schufteten Tag und Nacht auf den Feldern, um den dicken grauen sandigen Staubfilm von den Reispflanzen abzuwischen – eine schmutzige Sache.
In der Zwischenzeit waren die Kolonialbeamten im Südosten, in der Hauptstadt Bima, durch die Ereignisse des 5. April denn doch hinreichend beunruhigt, um einen Beamten namens Israel loszuschicken, der die Lage auf der Tambora-Halbinsel erkunden sollte. Wir wissen nicht, ob er anhielt, um die Situation mit dem Radscha von Sanggar zu besprechen, doch am 10. April hatte sein Bürokrateneifer den unglücklichen Mann direkt bis an die Hänge des Tambora geführt. Dort, im dichten tropischen Regenwald, fiel er gegen 19 Uhr als einer der Ersten dem mächtigsten Vulkanausbruch in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit zum Opfer.
Binnen weniger Stunden hörte das Dorf Koteh, wie auch alle anderen Siedlungen auf der Halbinsel Sanggar, zu existieren auf, es war den selbstzerstörerischen Zuckungen des Tambora zum Opfer gefallen. Diesmal stiegen drei verschiedene Feuersäulen in einer brüllenden Kakophonie vom Gipfel in westlicher Richtung auf, verhüllten die Sterne und vereinigten sich in größerer Höhe als der Ausbruch fünf Tage zuvor zu einem wirbelnden Feuerball. Der Berg selbst begann zu glühen, als Ströme kochenden verflüssigten Gesteins an seinen Flanken hinabliefen. Um 20 Uhr wurden die entsetzlichen Zustände in ganz Sanggar noch schlimmer, als ein Hagel aus Bimsstein niederging – mit Brocken »so groß wie zwei Fäuste«, vermischt mit einem Niederschlag aus heißem Wasser und Asche. Zehn Jahre nach dem Ereignis beschrieb ein indigener Dichter aus Bima das furchtbare Geschehen:
Der Berg erzitterte um uns herum,
Als sturzflutartig Wasser vermengt mit
Asche vom Himmel fiel.
Kinder schrien und weinten, und auch ihre Mütter,
In dem Glauben, die Welt sei in brennende Asche
verwandelt worden.12
An der Nord- und der Westflanke des Vulkans waren ganze Dörfer, wohl insgesamt zehntausend Menschen, bereits in einer wirbelnden Hölle aus Feuer, Asche, kochendem Magma und Windböen in Hurrikanstärke untergegangen. 2004 brachte ein Archäologenteam der Universität von Rhode Island die ersten Überreste eines Dorfes ans Licht, das von der Eruption verschüttet worden war: ein einzelnes Haus unter einer drei Meter dicken Schicht aus vulkanischem Bimsstein und Asche.13 Zwischen den Mauerresten fanden sie zwei verkohlte Leichen, wahrscheinlich ein Ehepaar. Die Frau, deren Knochen durch die Hitze verkohlt waren, lag mit ausgestreckten Armen auf dem Rücken und hielt ein langes Messer in der Hand. Der ebenfalls verkohlte Sarong hing ihr noch über der Schulter. Sie war vom Flammentod unterbrochen worden, als sie einer banalen Hausarbeit nachging – dem Zubereiten des Abendessens –, ganz ähnlich wie die in Gips bewahrten Körper von Frauen, Kindern und Haustieren in Pompeji, die bereits Anfang des neunzehnten Jahrhunderts bekannt waren. Der verkohlte Zustand der Frau am Tambora jedoch ist ein Beleg dafür, dass die Verbrennung bei einer weit höheren Temperatur erfolgte als jene, die der Vesuv im Jahr 79 erzeugte.
An der Ostseite des Berges wich der Niederschlag aus vulkanischem Schutt einem Ascheregen, doch für die noch lebenden Dorfbewohner sollte das keine Erleichterung sein. Die spektakuläre, einem Düsenstrahl gleiche »plinianische« Eruption (so benannt nach Plinius dem Jüngeren, der einen berühmten Bericht über die senkrechte Feuersäule des Vesuv hinterließ) ging unvermindert weiter, während glühende, sich schnell bewegende Flüsse aus Gestein und Magma, genannt »pyroklastische Ströme«, riesige Phoenixwolken aus erstickendem Staub erzeugten. Als diese brennenden Magmaflüsse ins kühle Meer eintauchten, kam es zu sekundären Explosionen, welche die Aschewolke des ursprünglichen pyroklastischen Stroms in der Luft auf doppelte Größe anschwellen ließen. Ein ungeheurer Schleier aus Dampf- und Aschewolken stieg auf, hüllte die Halbinsel ein und schuf so für jene, die darin gefangen waren, kurzfristig ein Mikroklima blanken Horrors.
Abbildung 7 Nach der plinianischen Eruption im Stil des Tambora stürzt der Schlot des Vulkans in sich zusammen und fließen pyroklastische Ströme aus Magma die Berghänge hinunter. Im Fall eines Ausbruches auf einer Insel, wie beim Tambora, erzeugen diese kochenden Ströme riesengroße sekundäre Aschewolken, sobald sie das kühlere Meerwasser erreichen. Dadurch können das ursprüngliche plinianische Ereignis und die nachfolgenden Phoenixwolken vulkanisches Material bis in die Stratosphäre hochschleudern – wie es 1815 geschah.
Zunächst traf ein »heftiger Wirbelwind« Koteh und blies die Dächer fort. Als er noch weiter an Kraft gewann, entwurzelte der vulkanische Hurrikan große Bäume und schleuderte sie wie brennende Speere ins Meer. Pferde, Rinder und Menschen flogen gleichermaßen hoch in den glühenden Wind. Wer das überlebt hatte, sah sich einem weiteren todbringenden Element ausgesetzt: Riesenwellen vom Meer. Die Besatzung eines britischen Schiffes, das vor der Küste in der Floresstraße kreuzte und mit Asche überzogen sowie von Vulkangestein bombardiert wurde, sah wie betäubt zu, wie ein drei Meter hoher Tsunami über die Reisfelder und Hütten entlang der Küste von Sanggar hinwegzog. Dann, als wären die kombinierten Kataklysmen der Luft und des Meeres noch nicht genug, begann das Land zu versinken, da der Einsturz des Tambora-Kegels wellenförmig überall in der Ebene Absackungen auslöste.
Es ist kaum zu glauben, dass irgendjemand so ein Höllenloch der Zerstörung überlebt haben könnte, doch dem Radscha von Sanggar und Mitgliedern seiner Familie sowie ein paar Dutzend Bewohnern seines Dorfes gelang es irgendwie, dem Inferno zu entkommen. Vielleicht machte der Radscha von seinen königlichen Privilegien Gebrauch, verlangte die besten Pferde im Stall und ritt an jenem Abend des 10. April früh genug los, um der Reichweite der Eruption entrinnen zu können. Er schlug dabei wohl einen südlichen Kurs durchs Landesinnere, weg vom Meer ein, dessen Reaktion mit den pyroklastischen Strömen den todbringenden Wirbelwind und den Tsunami erzeugten. Auf der schmalen Route zwischen Koteh und Dompu – dem einzigen Streifen der Halbinsel, der von der Lava verschont blieb – führte sie ihre unglaubliche Flucht zwischen fünf Meter hohen Schmelzflüssen hindurch, die zu beiden Seiten spuckten und rauchten. Ihre Rettung kommt schier einer neuzeitlichen Teilung des Roten Meeres gleich. Der Radscha von Sanggar und seine Gruppe verdankten das, was ihnen an Leben verblieb, sowohl der Topografie des Tambora, durch welche der Magmafluss der Eruption am 10. April stärker nach Nordwesten und Süden gelenkt wurde, als auch den Passatwinden, welche die Vulkanasche in westliche Richtung zu den Inseln Bali und Java trieben.
Nach dem Kataklysmus lagen an den Tagen ohne Sonne überall in den Straßen auf der bewohnten Ostseite der Insel zwischen Dompu und Bima Leichen unbeerdigt. Dörfer standen verlassen da, deren überlebende Bewohner hatten sich auf der Suche nach Nahrung zerstreut. Da die Wälder und Reisfelder vernichtet und die Brunnen der Insel mit vulkanischer Asche verunreinigt waren, sollten in den folgenden Wochen rund vierzigtausend Insulaner durch Krankheit und Verhungern dahingerafft werden, womit die geschätzte Zahl der Toten infolge des Ausbruchs auf über hunderttausend Menschen stieg, die größte Zahl derartiger Opfer in der aufgezeichneten Geschichte.14 Sogar der wohlhabende Radscha des nunmehr untergegangenen Königreiches von Sumbawa konnte seine geliebte Tochter nicht retten, die von dem Grauen und einer unerbittlichen Diarrhö, welche sie sich durch das mit Asche vergiftete Wasser zuzog, geschwächt war.
Eines Tages, viele Wochen später, hörte der Radscha, Engländer seien mit einem Schiff voll Reis auf die Insel gekommen. Er eilte nach Dompu, wo er sich mithilfe seines Titels eine Audienz beim englischen Leiter der Mission, Lieutenant Owen Philipps von der Kriegsmarine, verschaffte. Verzweifelt und gramerfüllt wie er war, konnte der Radscha gar nicht anders, als sich davor zu hüten, in der Gegenwart des Gesandten des englischen Gouverneurs allein gelassen zu werden. In der lokalen Zoonomie waren die niederländischen Oberherren Pferdeegel, die den indigenen Menschen das Blut aussaugten, während die Sumbawaner selbst Büffeln glichen: massigen langmütigen Lasttieren. Doch diese neuen Eroberer, die Briten, wirkten bis hinunter zu den Fellen, welche die Offiziere zur Zierde trugen, wie rotgesichtige Tiger: prachtvoll, aber tödlich.15
Nachdem er den schrecklichen Ausbruch des Tambora überlebt hatte, verfügte der Radscha jedoch für Lieutenant Phillips von der Royal Navy über ausreichend Mut und Gewitztheit. Er gab Phillips eine Beschreibung dessen, was am 10. April 1815 auf der Halbinsel Sanggar geschehen war – der einzige existierende Augenzeugenbericht der gewaltigen Explosion des Tambora. Er erzählte seine Geschichte so gut, dass der englische Offizier ihn dafür mit mehreren Tonnen Reis für sein Volk belohnte und ihn ausführlich in seinen Depeschen zitierte. Der Radscha dankte dem Engländer gefühlvoll, verließ ihn jedoch rasch wieder, zweifelsohne im Kopf immer noch aufs Überleben konzentriert und ohne groß zu registrieren, welchen Dienst er der Geschichte geleistet hatte.