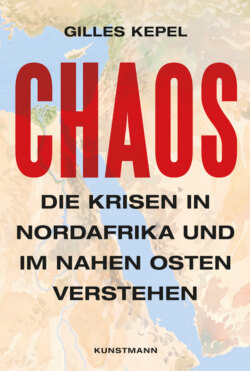Читать книгу Chaos - Gilles Kepel - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kampf um die Kontrolle über die Islamisierung in den 1980er-Jahren
ОглавлениеNeben dem Dschihad in Afghanistan nahm in den 1980er-Jahren die Islamisierung der politischen Ordnung im Nahen und Mittleren Osten stetig zu, und der Antagonismus zwischen dem schiitischen und sunnitischen Lager um den Kontrollanspruch vertiefte sich. Das wichtigste Schlachtfeld war dabei der Erste Golfkrieg zwischen September 1980 und August 1988. Von Saddam Hussein ausgelöst und vom Westen in der Absicht unterstützt, die iranische Expansion einzudämmen, kostete er vermutlich einer Million Menschen das Leben und bot den Revolutionsgarden und den Basidschi (»Mobilisierten«) die Möglichkeit, ihre Taktik des Selbstmordangriffs zu testen – was ihre Kommandanten »Märtyrer-Operationen« nannten –, die sich später zunächst in den Libanon und Israel, dann in den Nahen und Mittleren Osten, nach Europa, nach Amerika und schließlich in die gesamte Welt ausbreitete.
Parallel dazu eröffnete Teheran weitere, nicht weniger wichtige Fronten: Der libanesische Bürgerkrieg und der israelisch-palästinensische Konflikt reihten sich in die Auseinandersetzungen ein, die der Iran zeitgleich gegen den Westen und dessen Verbündete als auch gegen fast alle sunnitischen Organisationen führte – mit Ausnahme der Hamas. Tatsächlich begann die Islamische Republik, um sich gegen die Koalition ihrer Feinde zu verteidigen und den Druck auf ihre Grenzen durch den Irak und an der Küste des Persischen Golfs zu lockern, eine zweite Kampflinie in der Levante und eine dritte in Europa (die über den Umweg von Geiselnahmen eng mit dem Libanon verbunden war). Bis zu Chomeinis Tod im Juni 1989 machte sich das von ihm geführte Land auf der Suche nach den Schwächen seiner Gegner völlig frei von den bis dato geltenden Regeln der Kriegsführung und des internationalen Rechts. Es führte Schläge aus, um seine Gegner zur Anerkennung seiner Forderungen zu zwingen und den direkten militärischen Druck zu drosseln – die Mittel reichten dabei von der Fatwa gegen Rushdie über Selbstmordanschläge bis hin zur Entführung westlicher Staatsangehöriger. Nach Ende des Kriegs mit dem Irak begann der nun abgesicherte Iran aufs Neue, sich der Staatengemeinschaft anzunähern, um die für den Fortbestand des Regimes gefährliche Isolation zu beenden. Unterdessen fand die iranische Vorgehensweise Nachahmer im sunnitischen Dschihadismus, der dann weltweit jenen Terrorismus verbreitete, den die Islamische Republik begonnen hatte, ihn allerdings anders verstand. Der sunnitische Dschihadismus stützte sich nicht, wie im Iran, auf einen zentralisierten Staatsapparat und ließ sich später auch nicht wieder in die weltweite institutionelle Ordnung einfügen.
Die sunnitischen Bemühungen um die Eindämmung der iranischen Revolution basierten folglich auf zwei Hauptachsen, zum einen auf Afghanistan, zum anderen auf Irak, in ersterem Fall durch den Dschihad, in letzterem durch Saddam Hussein. Beide bekamen unablässig Unterstützung aus dem Westen – was im Rückblick wie eine sehr kurzsichtige Strategie wirkt.
Der afghanische Dschihad, der sich ursprünglich gegen die Sowjetunion richtete, sollte ein großes Narrativ liefern, das eine Alternative zur kriegslüsternen Begeisterung und Dritte-Welt-Rhetorik der iranischen Propaganda bot. Saudi-Arabien und seine Verbündeten wollten beweisen, dass sie besser als andere in der Lage waren, den Angriff der sowjetischen Atheisten auf den Islam abzuwehren. In der islamischen Vorstellung nahm diese Invasion den Platz der Besetzung Palästinas durch Israel ein, der ein immer noch zentraler Konflikt für den zerfallenden arabischen Nationalismus war – bis er schließlich gegen Ende des Jahrzehnts durch das Auftauchen der Hamas ebenfalls islamisiert wurde. Mit dem gemeinsamen Aufruf, alle Muslime weltweit sollten ihren Glaubensbrüdern in Afghanistan beistehen, schlossen sich die Salafisten der arabischen Halbinsel und die Muslimbrüder in ihren Bemühungen zusammen und machten ihre Stimme im Gewirr aller politischen Tendenzen des sunnitischen Islam hörbar, die sich angesichts der schiitischen Herausforderung aufgefordert fühlten, die universelle Hegemonie über ihren Glauben auszuüben.
Ihr wichtigster Ideologe war ein palästinensischer Muslimbruder, Abdallah Azzam, der sich in Peschawar niedergelassen hatte – in jener pakistanischen Grenzstadt, die als Basis für Operationen im Nachbarland Afghanistan und als Einfallstor für militärische Lieferungen diente. Peschawar wurde auch zum Drehkreuz für Dschihadisten aus der ganzen Welt, die hier ihr Basislager aufschlugen (das auf Arabisch Qaida heißt und der berühmten Organisation ihren Namen gab). In seinem Manifest mit dem Titel Folgt der Karawane! rechtfertigt Azzam die Verpflichtung aller Muslime zum Kampf in Afghanistan im Namen eines »Verteidigungsdschihad«, der jeden dazu zwang, seine Kräfte zu mobilisieren, um das von Ungläubigen angegriffene islamische Territorium zu befreien. Diese Verpflichtung galt für jeden: kein Staat, kein Ehemann, kein Vater minderjähriger Kinder, kein Sklavenbesitzer durfte sich entziehen. Jeder Gläubige musste seinen Möglichkeiten entsprechend mitwirken, »mit der Hand, der Zunge oder dem Herzen« – indem er mit Waffen kämpfte, Geld gab, Reden hielt, predigte oder wenigstens betete. Es handele sich, so Azzam unter Berufung auf die Heiligen Schriften, um eine »individuelle Verpflichtung« (fard ayn), deren Missachtung im Jenseits schwere Strafen nach sich ziehe. Dieser Text sowie viele von Azzams Artikeln für die gleichnamige Zeitung al-Dschihad fanden ein Echo in einer Fatwa der wichtigsten, den Salafisten und Muslimbrüdern nahestehenden sunnitischen Ulemas, die Gläubige aus der ganzen Welt zum Kampf aufrief. Überall wurden Rekrutierungsbüros eröffnet, nicht nur in muslimischen Ländern, sondern auch im Westen und nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten, und zwar gefördert von der CIA, die zudem Azzams Rundreise durch das Land zu islamischen Verbindungen organisierte. Er schuf ein Servicebüro (Maktab al-Chidamat, MAK), das die Anwerbung, die Beschaffung von Geld und die Beförderung der ausländischen Dschihadisten an den Kriegsschauplatz organisierte. Der amerikanische Hauptsitz in Brooklyn bekam später regelmäßig Besuch vom blinden ägyptischen Scheich Umar Abd ar-Rahman, der für das erste Attentat auf das World Trade Center 1993 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, sowie von einer Reihe weiterer Aktivisten. Das MAK wurde nach der Ermordung Azzams im November 1989 von Osama bin Laden übernommen und in die Strukturen von al-Qaida eingegliedert.
In den zehn Jahren, in denen die CIA den afghanischen Dschihad finanzierte, wurden von amerikanischer Seite geschätzt vier Milliarden US-Dollar gezahlt, zu denen noch einmal die gleiche Summe (matching funds) in saudischen Petrodollars hinzukam. Betrachtet man dieses Geld als Summe, mit der man das Ende der UdSSR herbeiführte, ist der Betrag lächerlich. Im Rückblick jedoch war dies der Preis für den Pakt mit dem Teufel, und berücksichtigt man noch den zweiten Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001, wird der Preis unkalkulierbar.
Den Großteil der Operationen vor Ort führten Afghanen aus, die man als »Mudschaheddin« bezeichnet – die arabische Bezeichnung für »Kämpfer des Dschihad« im Partizip II aktiv. Der Autor dieses Buches und einige Kollegen schufen den Neologismus »Dschihadisten«, indem sie ein griechisch-lateinisches Suffix an einen arabischen Wortstamm hängten, um die einheimischen Kämpfer von den ausländischen zu unterscheiden, von denen rund 40.000 sich dem Kampf angeschlossen hatten. Sie kamen aus Nordafrika, dort vor allem aus Algerien, Libyen und Ägypten, von der arabischen Halbinsel, aus Pakistan und aus dem asiatischen Raum zwischen Malaysia und den Südphilippinen, zudem trafen muslimische Migranten aus den Vereinigten Staaten und bereits damals einige Dutzend aus den europäischen Vorstädten ein. Sie erhielten von der CIA eine Militärausbildung, waren jedoch kaum an den Kämpfen selbst beteiligt. Sie nutzten ihre Ausbildung im darauffolgenden Jahrzehnt, nachdem sie in ihre Länder zurückgekehrt waren, vor allem für den Dschihad in Algerien und Ägypten oder im Dienste der nebulösen al-Qaida. In den beiden zuletzt genannten Ländern war es zu starken Unruhen gekommen – Sadat war am 6. Oktober 1981 ermordet worden –, und die Führer dieser Länder erleichterten die Ausreise der einheimischen Aktivisten, die sie nicht hinter Schloss und Riegel halten konnten, in der Hoffnung, sie dadurch loszuwerden. So etwa die rechte Hand und der spätere Nachfolger bin Ladens, der ägyptische Arzt Aiman az-Zawahiri: Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Kairo reiste er über Saudi-Arabien nach Peschawar. Heute wissen wir, dass diese kurzsichtige Strategie sich wenige Jahre später gegen ihre Erfinder wandte, als die Dschihadisten in ihre Heimat zurückkehrten, um sie zu verwüsten. Doch während der 1980er-Jahre vermittelte sie die Illusion, man könne den militanten Islamismus unter saudischer Führung im Kampf gegen die Sowjetunion kanalisieren und die möglicherweise dabei auftretenden Ausschweifungen seien nur Lappalien.
Diese Weltsicht wurde getragen vom nationalen Sicherheitsberater von Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. Der wichtigste Architekt der amerikanischen Unterstützung des afghanischen Dschihad verteidigte sie in einem Interview mit der Zeitschrift Le Nouvel Observateur am 15. Januar 1998:
Le Nouvel Observateur: Sie bedauern heute also nichts?
Zbigniew Brzezinski: Was sollte ich bedauern? Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie sorgte dafür, dass die Russen in der afghanischen Falle saßen, und Sie wollen, dass ich das bedauere? An dem Tag, an dem die Sowjets offiziell die Grenze überschritten haben, schrieb ich Präsident Carter sinngemäß: »Jetzt haben wir die Gelegenheit, der UdSSR ihren eigenen Vietnamkrieg zu bescheren.« Und wirklich musste Moskau fast zehn Jahre lang einen für das Regime untragbaren Krieg führen, einen Konflikt, der zur Zermürbung und schließlich zum Zusammenbruch des Sowjetimperiums führte.
Sie bedauern also nicht, damit den islamistischen Fundamentalismus gefördert, zukünftige Terroristen mit Waffen ausgestattet und beraten zu haben?
Was ist für die Weltgeschichte wichtiger? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Ein paar islamistische Aufpeitscher oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Kriegs?
Welche Aufpeitscher? Es heißt doch immer wieder: Der islamische Fundamentalismus stellt heute eine weltweite Bedrohung dar.
Das ist Schwachsinn. Es heißt auch, der Westen müsse eine globale Politik im Hinblick auf den Islamismus entwickeln. Das ist dumm: Es gibt keinen globalen Islamismus.
Auch wenn man gut verstehen kann, dass die Befreiung Polens vom russischen Joch für einen in Warschau geborenen Junker ungemein wichtig war, so belegt das fehlende Vermögen, sich sogar 1998 noch keinen »globalen Islamismus« vorstellen zu können, jedoch die Defizite der amerikanischen Politikelite. Zu Beginn der 1980er-Jahre erkannte sie weder die Bedeutung der sunnitischen Islamisierung der Politik, die das saudische Königshaus anstrebte, noch deren Modalitäten – und noch viel weniger jene der iranischen Antwort auf diese Strategie –, war die amerikanische Politik doch intellektuell gefangen im Erbe des Kalten Kriegs.
Mit dem Abzug der Sowjets aus Kabul am 15. Februar 1989, ausgelöst auch vom Druck der Mudschaheddin, die mit ihren von der CIA gelieferten Boden-Luft-Raketen des Typs Stinger die russischen Luftstreitkräfte in die Knie gezwungen hatten, war der Weg frei für den Fall der Berliner Mauer am 9. November. Dieser wiederum ging der Auflösung des Kommunismus insgesamt voraus. Die damals anwesenden internationalen Dschihadisten, die die Weltgeschichte im Licht der Offenbarung und Errungenschaften des Islam (futuhat) lasen, waren überzeugt, dass sie die Heldentaten des Propheten, seiner Anhänger und unmittelbaren Nachfolger wiederholt hatten, jene »neue koranische Generation« (jil qurani jadid), die Sayyid Qutb heraufbeschworen hatte, um die Dschahiliya zu zerstören – die heutige gottlose »Barbarei«. So wie die Reiter unter dem Banner des Propheten mit der Schlacht von al-Qadisiya 636 das Sassanidenreich besiegten – eine der beiden »Supermächte« der damaligen Zeit –, so hatten die Dschihadisten nun in Kabul die Sowjets geschlagen. (Saddam Hussein nannte seine Offensive 1980 gegen den Iran ebenfalls »Qadisiya«.) Dem Beispiel der Araber und später des Osmanischen Reichs folgend, die ihren Sturm auf die andere Supermacht der Zeit, Byzanz, vervielfachten, bis sie 1453 besiegt war, verstärkten auch bin Laden und seine Verbündeten die antiamerikanischen Attacken, unter denen der »gesegnete zweifache Angriff« vom 11. September nur die Spitze war. In der Numerologie, die die islamistische Bewegung eifrig betreibt, kommt es zu einem die Geschichte überschreitenden Zusammenprall: Der 9/11 (9. November 1989, eleven nine auf Englisch), das Datum des Mauerfalls und Symbol für das Ende des Kommunismus und der Ost-West-Konfrontation, wie sie die Welt lange prägte, ist Vorbote seiner Umkehrung, dem 11/9 (11. September 2001, nine eleven auf Englisch), zu Beginn des neuen christlichen Jahrtausends. In den Augen der Dschihadisten erschien dieses Datum wie die Dämmerung eines triumphalen und heilbringenden islamistischen Millenniums, die über dem Schutt des gottlosen Westens aufsteigt.
Dem Moment des sowjetischen Rückzugs aus Kabul am 15. Februar 1989 schenkte kaum jemand wirklich Aufmerksamkeit. Dies frustrierte die sunnitische Achse, die ihre Krönung zum universellen Herrscher des Islam durch einen mit Petrodollars von der arabischen Halbinsel möglich gemachten, siegreichen Dschihad gewürdigt wissen wollte. Denn am Vorabend des Abzugs hatte Chomeini Salman Rushdie zum Tode verurteilt, da dieser mit seinem Roman Die satanischen Verse den Propheten beleidigt habe. Mit diesem meisterhaften Schachzug überdeckte der Ajatollah den reellen geopolitischen Sieg seines Rivalen, übertrug den Kampf auf das Schlachtfeld der Medien und sicherte sich dort den Sieg. Der Iran gab Milliarden Gläubigen auf der Welt zu verstehen, dass er ihr bester Verteidiger war, indem er gegen die »Demütigung Mohammeds« durch den indisch-britischen Schriftsteller vorging und eine weltweite Fatwa gegen ihn aussprach. Dieser Vorgang war auf mehreren Ebenen ein wirkungsvoller und semantischer Bruch. Die Bestürzung und der Skandal, den er im Westen verursachte, zogen alle Aufmerksamkeit der Journalisten auf sich, weshalb sie am folgenden Tag den Rückzug der Roten Armee nur als Nebensächlichkeit behandelten. Der Feldzug gegen den Roman hatte bereits sechs Monate zuvor im sunnitisch-islamistischen Milieu der indisch- und pakistanischstämmigen Briten begonnen und war unter den Muslimen des Subkontinents auf großes Echo gestoßen. Dies ging so weit, dass die Regierung in Neu-Delhi, obwohl säkular, das Buch zensierte. In London kam es zu Demonstrationen, die im Namen eines Gesetzes gegen Blasphemie ähnliche Maßnahmen forderten (das inzwischen aufgehobene Gesetz war bis dahin nur in Bezug auf die anglikanische Kirche angewandt worden). Im Januar war es in der wirtschaftlich stark gebeutelten Stadt Bradford, in den Midlands, in der zahlreiche arbeitslose Migrantinnen (mit ähnlichen ethnisch-konfessionellen Ursprüngen wie Rushdie) lebten, zu einer Bücherverbrennung gekommen. Mullahs und Führer muslimischer Verbände banden ein Exemplar des Buches an einen Pfahl auf einem Scheiterhaufen und zündeten diesen in Anwesenheit einer Menge von erregten Gläubigen direkt vor dem großen Rathaus an, das mit seinem gotisch-venezianischen Stil vom verloren gegangenen Reichtum aus Zeiten der Industrialisierung zeugte. Das im afghanischen Dschihad mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten verbündete Saudi-Arabien wollte die Angelegenheit nicht hochspielen, um die von dem Vorfall verunsicherte Regierung von Margaret Thatcher nicht zu brüskieren. Teheran jedoch erkannte die außergewöhnliche politische Chance, die sich hier auftat, und nutzte sie, indem es sich auch bei den muslimischen Sunniten und im Gegensatz zur Schwäche Riads als »Verteidiger des Propheten« positionierte. Chomeini löste einen noch nie da gewesenen Skandal im Westen aus, indem er dessen Prinzipien der freien Meinungsäußerung verspottete. Er fokussierte alle Aufmerksamkeit auf sich und verdeckte den amerikanisch-saudischen Erfolg in Kabul.
Im Rückblick gesehen schuf die Fatwa gegen Rushdie gleich mehrere Präzedenzfälle. Zuallererst machte sie aus dem gesamten Planeten eine »Domäne des Islam« – ein Territorium, in dem die Scharia gilt. Wenn ein britischer Staatsbürger, der in Großbritannien lebt, durch die Scharia zum Tode verurteilt wird, beansprucht sie folglich Gültigkeit auch im Vereinigten Königreich und dem Rest der Welt. Chomeinis Gewaltstreich hob die traditionellen Grenzen der muslimischen Weltbeschreibung auf und annektierte die gesamte Erde für sein eigenes juristisch-religiöses Unternehmen. Die beachtliche Symbolik dieser Verschiebung im Rahmen der Islamisierung der weltweiten Normen und Werte wurde damals mangels Bereitschaft zum Perspektivwechsel nicht erkannt und wird auch heute noch, drei Jahrzehnte später, unterschätzt. Dabei schuf sie eine neue Rechtsprechung, die auf identische Art und Weise bei weiteren Fällen von »Blasphemie« erneut eingesetzt wurde. Beispiele hierfür sind der Mord am Filmemacher Theo van Gogh, der am 2. November 2004 in Amsterdam von einem marokkanischstämmigen Niederländer wegen seines Films Submission erstochen wurde, die Kampagne gegen die Veröffent lichung von Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten am 30. September 2005 und das Massaker in der Redaktion von Charlie Hebdo am 7. Januar 2015 durch die Brüder Kouachi, die dabei riefen: »Wir haben den Propheten Mohammed gerächt!« Auch wenn die Initiative von Schiiten ausging, so schuf sie doch eine Norm, die bald die konfessionellen Grenzen überschritt, denn auch Sunniten übernahmen sie in der Folge für eigene Maßnahmen.
Die Fatwa hatte noch eine weitere Konsequenz: Sie überzeugte die sunnitischen Dschihadisten von der Wichtigkeit der Medienöffentlichkeit, die sie bis dahin bei ihrem Kampf in Afghanistan vernachlässigt hatten. Aiman az-Zawahiri unterstrich deren Bedeutung in seinem Ende der 1990er online veröffentlichten strategischen al-Qaida-Manifest Ritter unter dem Banner des Propheten und zog selbst eine zwiespältige Bilanz des Dschihad in Bosnien, Algerien und Ägypten. Da sie zu eng gedacht waren, lösten sie nicht jene weltweite Resonanz aus, die ihnen Auftrieb gegeben und sie zum Sieg geführt hätte. In diesem Sinne hatten die Lektionen der Fatwa vom 14. Februar 1989 entscheidenden Einfluss auf die hollywoodreife Inszenierung des 11. September – im Satellitenfernsehen und vor allem auf Al Jazeera – wie auch auf die fast schon pornografisch wirkende Hinrichtung von Geiseln durch den sogenannten »Islamischen Staat« – in den sozialen Medien.
Neben dem Dschihad in Afghanistan belegen drei weitere Konflikte in den 1980er-Jahren einerseits den Einfluss des politischen Islam auf die internationalen Beziehungen und andererseits den Überbietungswettbewerb zwischen Schiiten und Sunniten in der Frage der Hegemonie über den Islam. Vor allem unter diesem Gesichtspunkt sollen die Konflikte hier betrachtet werden.
Saddam Hussein, der aus der im »arabisch-sunnitischen Dreieck« gelegenen irakischen Stadt Tikrit stammte, begann im September 1980 den Ersten Golfkrieg. Damit wurde die Baath-Partei gezwungen, mit dem Laizismus eines ihrer Gründungsprinzipien über Bord zu werfen und die ideologischen Regeln der Islamisierung der Region anzuerkennen. Sie ersetzte nun den säkularen arabischen Nationalismus, der am Ende seiner Kräfte war. Auf der irakischen Flagge erschien 1990 der Ausdruck Allah Akbar, Saddam ließ sich überall beim Beten filmen, und seinen Anhängerinnen, die bis dahin stolz ihren von jeglichem Aberglauben emanzipierten Kurzhaarschnitt zeigten, wurde auferlegt, sich streng zu verhüllen. Wie schon erwähnt, trug die Offensive gegen den Iran den Namen »Saddams Qadisiya« und erinnerte damit an die Entscheidungsschlacht, bei der Kalif Umar, der zweite Nachfolger des Propheten, 636 das Perserreich besiegte und dessen Gebiete besetzte. Saddam wollte auf diese Weise den religiösen Referenzrahmen selbst festlegen und seinen Gegner auf dessen sassanidische und zoroastrische Ursprünge reduzieren, was dessen Anspruch, den weltweiten Islam zu repräsentieren, unterwanderte. Teheran reagierte – und verurteilte urbi et orbi den Laizismus der Baathisten, da sie den Glauben als Täuschungsmanöver einsetzten. Um die Soldaten entsprechend der von Chomeini aktualisierten schiitischen Ideologie zu mobilisieren, nannte man im eigenen Sprachgebrauch die iranischen Militäroffensiven »Kerbela«: So sollte Saddam als Wiedergeburt des Umayyaden-Kalifen Yazid erscheinen, dem Mörder von Imam Hussein in Kerbela im Jahr 680. Und um die Gesamtheit der Muslime zu erreichen, bezeichnete man einige Feldzüge als »Badr«, eine Bezugnahme auf die erste siegreiche Schlacht des Propheten 624 an diesem Ort gegen die Kafir (»Gottlosen«) des Quraisch-Stamms – womit die »ungläubigen« Baathisten gemeint waren.
Saddams Motive zielten in zwei Richtungen, nach innen und nach außen. Auf nationaler Ebene wurde seine blutige Diktatur durch den Ölpreisanstieg ungemein reich, schließlich war der Irak nach Saudi-Arabien der weltweit zweitgrößte Erdölexporteur. Saddams Machtbasis war die arabisch-sunnitische Minderheit des Landes, die Bevölkerungsmehrheit aber ist schiitisch (und ihre bedeutendsten Heiligen Stätten, Kerbela und Nadschaf, liegen im Irak). Außerdem lebten Kurden und irredentistische Bevölkerungsschichten in den Bergen im Norden, von wo aus sie sporadisch Guerillaaktionen starteten. Saddam wollte gleichzeitig der möglichen Anziehungskraft der politischen Schia auf die große Mehrheit von Irakern begegnen und die revolutionäre Unordnung im Nachbarland ausnutzen. Der Irak sollte gen Osten ausgedehnt werden, und da das Land nur wenig Küste am Persischen Golf besaß (58 Kilometer), strebte Saddam auch die Annexion der arabischsprachigen iranischen Küstenregion Chuzestan an.
Auf regionaler wie internationaler Ebene wurde der Irak zum weltlichen Arm all derer, die die Ausdehnung und den Bekehrungseifer Chomeinis aufhalten wollten: die sunnitischen Ölmonarchien der Halbinsel – die sich im Mai 1981 gegen den Iran zum Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes (GKR) zusammenschlossen – und die Westmächte, darunter vor allem die Vereinigten Staaten und Frankreich. Alle Bedenken gegenüber Saddams unablässigen Verletzungen der Menschenrechte wurden beiseitegewischt, als er nun in den politischen Kreisen und von den Ölfreunden dieser beiden Länder hofiert wurde. Er pflegte gute Beziehungen zu Jacques Chirac und einem Gutteil der laizistischen Linken Frankreichs. Saddam kam in seinem Krieg gegen den Iran die Lieferung modernster Kriegstechnik zugute, vor allem die Leihgabe der französischen Marine-Kampfbomber Super-Étendard. Diese militärische Unterstützung war einer der Gründe für die Entführung westlicher Geiseln durch Teheran-freundliche Gruppen im Libanon, sorgte aber auch für den Umschlag des Kriegsgeschehens zuungunsten der Islamischen Republik.
Um ein Chaos zu vermeiden, war Ajatollah Chomeini gezwungen, den »bitteren Kelch bis zur Neige zu leeren« – also das Angebot eines Waffenstillstandsabkommens zwischen den beiden ausgebluteten Ländern zu akzeptieren, das am 20. August 1988 die Kämpfe beendete. Diese Niederlage wollte er verschleiern und die »Oberhand zurückgewinnen«, als er am 14. Februar 1989 die Fatwa gegen Rushdie erneuerte. Chomeini starb am 3. Juni 1989 im Alter von 87 Jahren. Der Tod des charismatischen Imam war die notwendige Bedingung für die langsame Rückkehr der Islamischen Republik in die internationale Gemeinschaft. Saddam Hussein hingegen konnte sich durch seinen Sieg an der Spitze des verwüsteten, ruinierten Landes behaupten. Da er sich jedoch bei den Ölmonarchien tief verschuldet hatte, stürzte er sich im August 1990 in das Abenteuer der Invasion seines Gläubigers Kuwait und damit in den Zweiten Golfkrieg. Sowohl im Irak als auch im Iran hatten die enormen Reichtümer aus dem Ölverkauf für eine gesteigerte Kriegslust der politischen Führung gesorgt und die militärische Aufrüstung begünstigt, in Saddams Fall vor allem durch die Westmächte. Der Ölreichtum hatte zudem den Bruch zwischen Schiiten und Sunniten zu einem Höhepunkt geführt, weit über den militärischen Konflikt zwischen Persern und Arabern hinaus.
Um den Druck auf ihre Grenzen und den Luftraum zu reduzieren, trug die Islamische Republik zur gleichen Zeit den Konflikt über Stellvertreter in den Libanon. Der Iran nutzte die Schwachstellen, die der fortdauernde libanesische Bürgerkrieg und der immer gewalttätiger werdende israelisch-palästinensische Konflikt boten. Die 1980er-Jahre wurden tatsächlich sowohl durch die zunehmende Islamisierung des Vokabulars in beiden Konflikten als auch durch das Vordringen iranischer Interessen geprägt, was im Libanon deutlich, in Palästina etwas schwächer wahrzunehmen war. Teheran hatte damit einen bis dahin unbekannten, aber beachtlichen Hebel in der Hand, um Druck auf den Westen auszuüben. Im Libanon zeigte sich dies zunächst durch Entführungen. Außerdem wurde die schiitische Gemeinschaft mobilisiert, die im Land zwar die Mehrheit bildete, politisch aber an den Rand gedrängt worden war. So entwickelte sich die Hisbollah zur dominanten Kraft im Zedernstaat, und es gelang ihr in den folgenden drei Jahrzehnten, alle konstitutiven Minderheiten des levantinischen Mosaiks hinter sich zu vereinen, darunter auch die orientalischen Christen. Gerade für die Christen schwang in der Ausbreitung des dschihadistischen Salafismus immer die drohende Auslöschung mit, die der IS schließlich auf die Spitze trieb. Aus den schiitischen Zonen im Südlibanon heraus ersetzte die Hisbollah de facto mit ihrem »Widerstand« (Mouqawama) gegen Israel den eigentlichen palästinensischen Widerstand, und unterstützte in diesem Zuge auch die Hamas – Letztere eines der wenigen Beispiele für eine sunnitisch islamistische Gruppierung, die in Verbindung mit der Muslimbruderschaft steht und an Teheran ausgerichtet ist.
Im Süden des übel zugerichteten und geteilten Libanon, auf den seit dem syrischen Einmarsch im Juni 1976 Damaskus großen Einfluss ausübte, hatten Palästinenser Raketenwerfer aufgebaut und feuerten damit auf das israelische Galiläa. Die Folge war, dass Israel im Juni 1982, im Rahmen der Operation »Frieden für Galiläa«, in das Gebiet einmarschierte. Die bis in die Vororte von Beirut vorrückenden Israelis vertrieben die palästinensischen Gruppen zunächst in den Nordlibanon und schließlich ganz aus dem Land. Die Palästinenser flohen auf französischen Schiffen nach Tunis (um später ins nordlibanesische Tripolis zurückzukehren, von wo die Syrer sie im Dezember 1983 erneut verjagten). Zunächst begrüßte die schiitische Bevölkerung den israelischen Einmarsch, der sie von den palästinensischen Fedajin befreite. Doch die israelische Militärpräsenz, die eine Verbindung mit prowestlichen christlichen Kämpfern schuf, verschlechterte das Verhältnis der lokalen Kräfte mit Damaskus und dessen iranischen Verbündeten. Die Ermordung des libanesischen Präsidenten Bachir Gemayel führte im September 1982 zu einem Rachemassaker in den palästinensischen Lagern Sabra und Schatila, das phalangistische Milizen unter den Augen der israelischen Armee verübten. Bachirs Bruder, Amine Gemayel, übernahm die Amtsgeschäfte und unterzeichnete eine Vereinbarung mit Israel, in der der Abzug der Armee aus dem Libanon und ein Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern vorgesehen war, was allerdings ein gemeinsames Vorgehen Syriens und des Iran verhindern konnte. Die Islamische Republik entsandte mehrere Hundert Revolutionsgarden (Pasdaran) in die Bekaa-Ebene mit ihrer schiitischen Bevölkerungsmehrheit und griff damit direkt auf libanesischem Boden ein. Wenig später erfolgte die Gründung der »Partei Gottes« oder Hisbollah, die Chomeini als Führer und Mentor ansah. Der Libanon kann seit dem 15. Dezember 1981 als Echokammer des schiitisch-sunnitischen Konflikts im Ersten Golfkrieg gelten, als mit einem Anschlag gegen die irakische Botschaft das erste Selbstmordattentat begangen wurde. Nach Ankunft einer multinationalen Eingreiftruppe aus US-Amerikanern, Franzosen und Italienern im September 1982, die die Kämpfer auseinandertreiben sollte, wurde im April 1983 ein weiterer Anschlag dieses Typs gegen die diplomatische Vertretung der Vereinigten Staaten verübt, dem 63 Menschen zum Opfer fielen. Am 23. August folgten zwei weitere Attentate auf amerikanische und französische Kasernen des Expeditionskorps (die 256 beziehungsweise 58 Menschenleben kosteten). Auch wenn niemand sich zu dieser Politik des Terrors bekannte, so passt sie zu den iranischen Selbstmordanschlägen an der irakischen Front. Aus diesem Einsatz eines asymmetrischen Kriegs gegen konventionelle Truppen der Großmächte zog der neueste Dschihadismus seine Inspiration, im Libanon führte er 1984 zum Abzug der internationalen Eingreiftruppe. Die syrisch-iranische Achse entwickelte sich – durch unzählige zweitrangige Wechselfälle während eines dreißigjährigen Konflikts – im Libanon nach und nach zur tonangebenden Macht.
Zur zweiten Ebene dieser Strategie gehört die Geiselnahme vom 22. März 1985, bei der zwölf Franzosen, acht US-Amerikaner und sieben Bürger anderer, dem Iran feindlich gesonnener Nationen entführt wurden. Zu der Entführung von Jean-Paul Kauffmann und Michel Seurat zwei Monate später bekannte sich eine schiitische »Organisation des islamischen Dschihad«. Sie forderte ein Ende der französischen Hilfe für den Irak – just in dem Moment, in dem Paris die Super-Étendard-Kampfflugzeuge geliefert hatte – und muss im Zusammenhang mit der iranischen Forderung verstanden werden, die in die nukleare Wiederaufbereitungsanlage Eurodif investierten Geldmittel zurückzuerhalten, was Frankreich blockierte. Paris empfand die Geiselnahme als nationale Tragödie, zumal ein Fernsehteam, das über die Vorfälle informierte, ebenfalls entführt und getötet wurde. Die Geiselnahme Michel Seurats und sein anschließender Tod in Gefangenschaft hatten 1989 ein Nachspiel in Form des Besuchs des Außenministers Roland Dumas in Teheran. Im Anschluss wurden einige in Frankreich inhaftierte Terroristen freigelassen und ausgewiesen, darunter ein libanesischer Schiit, der im Juli 1980 in einem Pariser Vorort versucht hatte, den ehemaligen Chef der letzten Schah-Regierung und Gegner der Islamischen Republik, Schapur Bachtiar, zu töten.
Neben der Nutzung des libanesischen Staatsgebietes als Schaltstelle der antiwestlichen Aktivitäten des Iran, wurde im Südlibanon, der nach und nach vollständig unter die Kontrolle der Hisbollah geriet, eine Hochburg des Widerstands gegen Israel errichtet. Das schärfste Schwert war nun die »Partei Gottes« und nicht mehr die PLO: Die Hisbollah ersetzte den arabischen Nationalismus, für den die PLO stand, und entwickelte sich zum stärksten Kämpfer in der Auseinandersetzung mit der »zionistischen Einheit«. Dadurch erhöhte sie ihre Popularität im Iran, aber auch in der arabischen Welt insgesamt – obwohl diese mehrheitlich sunnitisch geprägt ist. Dieser Prozess kulminierte im »33-Tage-Krieg« (Libanonkrieg) zwischen Israel und der Hisbollah vom 12. Juli bis 14. August 2006. Dieser endete mit einer Niederlage der israelischen Armee und machte aus Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, den arabischen Helden schlechthin. Sogar in den Satelliten-TV-Programmen auf der arabischen Halbinsel wurde er gefeiert, eine Premiere für einen Schiiten, der dem Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Chamenei, die Treue geschworen hat.
Im Libanon selbst stellte sich die Hisbollah als Inbegriff des »Widerstands« dar, dessen arabische Bezeichnung Mouqawama als Namensgeber für ihre Maßnahmen diente. Daraus leitete sie das Recht ab, ihre Waffen zu behalten, als alle anderen Milizen entwaffnet wurden, und erhielt eine Legitimität jenseits der eigenen Gemeinschaft. Sie konnte ab Ende der 1980er-Jahre ihren Einfluss immer weiter auf das gesamte Land ausdehnen und so das am 22. Oktober 1989 in der saudischen Stadt Taif unterzeichnete Abkommen ermöglichen, mit dem der 15 Jahre andauernde Bürgerkrieg beendet und die Niederlage der Christen festgeschrieben wurde. Tatsächlich verlor der maronitische Präsident der Republik dabei einen Großteil seiner Machtbefugnisse zugunsten des sunnitischen Ministerpräsidenten. Der durch Petrodollar ermöglichte Sieg Saudi-Arabiens zeigte sich nicht zuletzt symbolisch auch in der Person des libanesisch-saudischen Milliardärs und Politikers Rafiq Hariri. In Wirklichkeit waren die Vereinbarungen jedoch rasch überholt, da sich im Laufe der vorangegangenen Jahre die Kräfteverhältnisse vor Ort verändert hatten: Die sunnitische Gemeinschaft wurde zunehmend von der Hisbollah marginalisiert – was dies in den 2000er-Jahren mit sich brachte, soll im Folgenden erläutert werden.
Die Islamisierung des Palästina-Konflikts und dessen Eingliederung in die Rivalität zwischen Schiiten und Sunniten war eine der bedeutenden Veränderungen im Nahen und Mittleren Osten während der 1980er-Jahre. Kurz nach dem Triumph der iranischen Revolution veröffentlichte Fathi Schakaki, ein von den Muslimbrüdern inspirierter und nach Ägypten exilierter palästinensischer Arzt, 1979 ein erfolgreiches Buch mit dem Titel Chomeini: die alternative islamische Lösung. Das sowohl dem Titelgeber und »revolutionären Imam« als auch dem Gründer der Muslimbruderschaft Hassan al-Banna (dem »Märtyrer-Imam«) gewidmete Buch betont die intellektuelle Nähe der radikalsten Muslimbrüder, der Anhänger von Sayyid Qutb, zu den militanten Schiiten, jenseits der Treuepflicht der Sekte. Schakaki gründete damit den »Islamischen Dschihad in Palästina«, eine bewaffnete Gruppe, die ab 1983 die ersten blutigen Angriffe gegen Israel in den besetzten Palästinensergebieten durchführte. Damit wollte er belegen, dass der jüdische Staat nicht unverwundbar war, derweil die PLO in ihrem libanesischen Exil ausharrte und die moderaten palästinensischen Muslimbrüder sich auf karitative Maßnahmen beschränkten. In diesen Jahren wurden die geheimnisvollen palästinensischen Ausbildungslager, die derzeit im Libanon aufgelöst werden, durch jene der Dschihadisten – der »Qaida« – zwischen Peschawar und der afghanischen Grenze ersetzt. Der wichtigste Ideologe des Dschihad, Abdallah Azzam, verstand sich trotz allem immer als palästinensischer Muslimbruder und Anhänger Qutbs und erinnerte in seinen Schriften stets daran, dass die Befreiung und Islamisierung seines Heimatlands sein oberstes Ziel seien, auch wenn die Umstände in Afghanistan derzeit die beste Möglichkeit für einen bewaffneten Dschihad böten.
Die Kombination aus Schakakis und Azzams Einfluss verstärkte die Radikalisierung der palästinensischen Muslimbrüder und führte schließlich zur ersten Intifada (»Aufstand«) oder dem »Krieg der Steine« im Dezember 1987. Diese Phase des Widerstands gegen Israel, während der folgenden zehn Jahre zunächst von außen ins Innere Palästinas, ins Westjordanland, nach Jerusalem und in den Gazastreifen, dann auf das israelische Staatsgebiet selbst getragen, wurde von der Entstehung der Islamischen Widerstandsbewegung begleitet, dessen arabisches Akronym das Wort Hamas bildet. Je länger sich die Intifada hinzog, umso mehr machte die Hamas Arafats PLO die Führungsrolle im palästinensischen Kampf streitig. Sie veröffentlichte beispielsweise einen eigenen Kalender mit verpflichtenden Streiktagen. Als die Hamas am 18. August 1988 ihre Charta verabschiedete, setzte sie sich damit deutlich von jener der PLO ab, die bisher als exklusive Referenz gedient hatte. In der Charta betonte die Hamas, der Dschihad für die Befreiung Palästinas sei eine »individuelle Verpflichtung« (fard ayn) jedes Einzelnen. Mit diesen Worten hatte Azzam bereits den Dschihad in Afghanistan begründet, der kurz davorstand, der Roten Armee eine Niederlage zu bereiten. Auch wenn die PLO Ende der 1980er noch ihre politische Bewegungsfreiheit besaß, so war sie doch von der Islamisierung der Palästina-Frage stark getroffen, zumal diese in den folgenden Jahren noch zunahm und von den Petrodollars der arabischen Halbinsel finanziert wurde: 1990 überwies Kuwait 60 Millionen US-Dollar an die Hamas und nur 27 Millionen US-Dollar an die PLO. Im August desselben Jahres drängte Arafat Saddam Husseins Irak zur Invasion des Emirats.