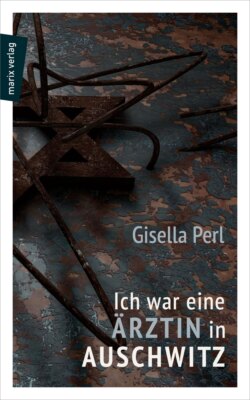Читать книгу Ich war eine Ärztin in Auschwitz - Gisella Perl - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weibliche Erfahrungen während Verfolgung und Lagerhaft und die Situation von deportierten Jüdinnen in Auschwitz im Frühsommer 1944
ОглавлениеDie spezifischen Erfahrungen jüdischer Frauen im nationalsozialistischen Lagersystem sind in den 1980er-Jahren vor allem in den USA auf die wissenschaftliche Agenda geholt worden.12 Schwerpunkt der Diskussionen war – neben der Klärung der Legitimität der Kategorie Gender in der Untersuchung der Judenverfolgung und -vernichtung – die Frage nach geschlechtsspezifischen Überlebensbedingungen und -strategien. Joan Ringelheim stellte fest, dass jüdische Frauen in fast allen Etappen der Verfolgung einer höheren Todesgefahr ausgesetzt waren als jüdische Männer: Einmal aufgrund der gesellschaftlichen Rollenverteilungen, die dazu führten, dass zum Beispiel die kostenintensive Emigration ins Ausland eher männlichen Familienmitgliedern ermöglicht wurde, aber auch aufgrund der NS-Vernichtungspolitik, die vorsah, dass jüdische Frauen, wie Himmler in seiner Posener Rede am 6. Oktober 1943 klar benannte, als Keimzelle des jüdischen Volks möglichst ausnahmslos umzubringen seien.13
Seit den 1990er-Jahren entstanden vor allem im deutschen Sprachraum Arbeiten, die sich mit den spezifischen Bedingungen von weiblichen Häftlingen in einzelnen Lagerkomplexen befassten.14 Dabei fiel auf, dass sowohl jüdische als auch nichtjüdische Frauen in den KZ-Außenlagern der letzten Kriegsphase eine deutlich höhere Überlebensrate als Männer aufwiesen.15 Dies konnte einerseits auf ihre zunehmende Bedeutung als Arbeitskräfte in der NS-Kriegswirtschaft zurückgeführt werden – warf aber gleichzeitig die Frage auf, ob Frauen über sozialisationsbedingte Fähigkeiten verfügten, die ihre Überlebenschancen positiv beeinflussten.
Für die Situation der weiblichen Häftlinge in Auschwitz-Birkenau sind die Forschungen von Irena Strzelecka und Helena Kubica wegweisend.16 Angesichts der verschiedenen Phasen der Lagerentwicklung, der disparaten Funktionen der einzelnen Lagerbereiche und der unterschiedlichen Politik gegenüber einzelnen Häftlingsgruppen muss die Situation weiblicher Häftlinge stark differenziert und in Abhängigkeit von Herkunft, Status, Deportationszeitpunkt und Lagerbereich unterschieden werden. Zu einzelnen Lagerbereichen, wie unter anderem zu der Abteilung B II c, in der Gisella Perl untergebracht war, besteht noch großer Forschungsbedarf.
Gisella Perl wurde 1907 in Máramarossziget (heute Sighetu Marmației in Rumänien) geboren, einer Stadt in Siebenbürgen, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt zum Königreich Ungarn, nach dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien und nach dem Zweiten Wiener Schiedsspruch 1940 wiederum zu Ungarn gehörte. Nachdem die Deutschen im März 1944 Ungarn besetzt hatten, waren die annektierten Gebiete die ersten, aus denen die jüdische Bevölkerung deportiert wurde. Die Juden von Máramarossziget wurden nach kurzem Aufenthalt in einem ghettoähnlichen Sammellager Ende Mai 1944 nach Auschwitz deportiert. Gisella Perl, die zu diesem Zeitpunkt eine 36-jährige angesehene Gynäkologin und Geburtshelferin war, wurde zusammen mit ihrem Mann, ihrem Sohn, ihren Geschwistern und Eltern nach Auschwitz-Birkenau deportiert. An der Rampe wurde sie von ihnen getrennt. Eltern und Sohn wurden sofort nach Ankunft in der Gaskammer ermordet. Ihr Mann, ihr Bruder und ihre Schwägerin wurden ins Lager aufgenommen, starben aber noch vor der Befreiung. Ihre Tochter Gabriella, die sie in den Memoiren nicht erwähnt, lebte zu diesem Zeitpunkt versteckt bei einer nichtjüdischen Familie.17
Nie waren mehr Menschen in Birkenau eingetroffen als in den Monaten Mai und Juni 1944. Bis Reichsverweser Miklós Horthy im Juli 1944 die Einstellung der Deportationen verfügte, waren rund 438 000 Juden aus Ungarn nach Auschwitz deportiert worden.18 Die eintreffenden Menschen wurden an der Rampe von der Lager-SS unter Aufsicht der Lagerärzte selektiert. Arbeitsfähige Männer und Frauen sollten zum Arbeitseinsatz in die deutsche Rüstungsindustrie gebracht werden, da sich im Laufe des Jahres 1944 der Arbeitskräftemangel dramatisch zugespitzt hatte. In einem ersten Schritt trennte die SS die Deportierten nach Geschlechtern. Kinder wurden der Gruppe der Frauen zugewiesen. In einer weiteren Selektion trennte die SS die beiden Gruppen erneut: Wer alt, krank oder arbeitsunfähig erschien, kam auf eine Seite, wer gesund und kräftig wirkte, auf die andere. Gisella Perl wurde der Gruppe der arbeitsfähigen Frauen zugewiesen. Die Zahl der zur Arbeit selektierten Juden aus den Ungarn-Transporten wird auf 110 000, etwa zum gleichen Anteil Männer und Frauen, geschätzt.
Die zum Arbeitseinsatz ausgewählten Frauen wurden nach der Selektion als sogenannte »Durchgangsjuden« notdürftig in den Abschnitten B II c sowie im noch nicht fertiggestellten Abschnitt B III (genannt »Mexiko«) untergebracht. Gisella Perl wurde dem Lagerbereich B II c zugewiesen. Er diente von Ende Mai bis November 1944 als Quarantäne- und Durchgangslager für bis zu 32 000 weibliche jüdische Deportierte, die zum großen Teil aus Ungarn und den ungarisch besetzten Gebieten stammten und dort Wochen oder Monate verbrachten, bis die SS über ihr weiteres Schicksal entschied. Sie wurden, bis auf Hilfsarbeiten zur Lagerorganisation, nicht zur Arbeit eingesetzt und hatten stattdessen täglich qualvolle, stundenlange Zählappelle zu absolvieren. Die Monate, die Gisella Perl in Birkenau verbrachte, waren eine Zeit, in der sich Birkenau zum größten Umschlagplatz für Häftlingsarbeiterinnen entwickelte, die in das expandierende Außenlagersystem auf Reichsgebiet geschickt wurden. Rüstungsbetriebe, die einen Bedarf an Arbeitskräften anmeldeten, bekamen Gruppen von meist mehreren Hundert Frauen zugewiesen und brachten diese in Fabriknähe in einem Lager unter, das von SS-Wachmannschaften bewacht wurde und als Außenlager vom KZ-System verwaltet wurde. Vom Sommer bis in den späten Herbst 1944 hinein verließen Hunderttausende Häftlinge Birkenau zum Arbeitseinsatz in Richtung Reichsgebiet. Diese Verschickungen ins Reich spielen in Perls Bericht immer wieder eine Rolle. Für die Häftlinge in B II c selbst war nicht immer klar, ob ein Abtransport ihre Situation verbessern oder eher verschlimmern würde. Nach und nach wurde aber immer deutlicher, dass jeder Tag, jede Woche unter den Bedingungen von Birkenau die Gefahr erhöhte, zu erkranken und letztendlich den regelmäßig stattfindenden Selektionen durch die SS-Ärzte zum Opfer zu fallen. Diese dienten dem Ziel, diejenigen auszusortieren und zu ermorden, deren Heilung als nicht erwartbar erschien und die nicht unnötig Platz und Ressourcen verbrauchen sollten. Sie wurden auf Lkws geladen und in die nahegelegenen Gaskammern abtransportiert. De facto waren die Überlebenschancen in einem Außenlager der Rüstungsindustrie insbesondere für Frauen höher als in Birkenau. Auch Perls eigene Überstellung in das Neuengammer Außenlager Hamburg-Wandsbek im Januar 1945 erfolgte in diesem Zusammenhang. Dort hatte die Firma Dräger im Juni 1944 ein Außenlager für 500 Frauen errichtet, die in der Gasmaskenproduktion eingesetzt waren.19 Wenn in einem Außenlager Bedarf nach medizinischem Personal entstand, war es durchaus üblich, dass Häftlingsärztinnen in Einzeltransporten über weite Strecken von Lager zu Lager überstellt wurden, wie es Gisella Perl widerfuhr.