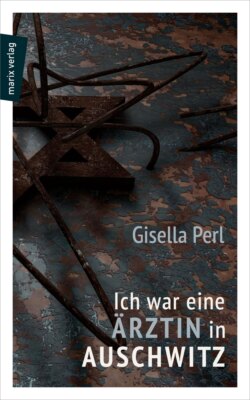Читать книгу Ich war eine Ärztin in Auschwitz - Gisella Perl - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Perspektivität in Perls Memoiren
ОглавлениеDie Krematorien von Birkenau und ihre brennenden Schornsteine waren für alle in Birkenau Gefangenen stets präsent. Spätestens einige Tage nach Ankunft war klar, was sie zu bedeuten hatten. Da alle Häftlinge jedoch nur in dem abgegrenzten Gebiet, in dem sie untergebracht bzw. zur Arbeit eingesetzt waren, Erfahrungen sammeln konnten, hatten nur sehr wenige Überlebende die Vorgänge bei der Ermordung der Juden in den vier Krematorien in Birkenau selbst beobachten können. Im verständlichen Wunsch, trotz des unvollständigen Wissens dieses zentrale Geschehen von Birkenau zu dokumentieren und besser ungesichertes Wissen weiterzugeben als gar keins, beschreiben gerade die Autorinnen und Autoren früher Berichte den Massenmord auf Grundlage ihrer damaligen Kenntnisse, die sich oftmals aus dem Hörensagen speisten. Kaum ein Autor, eine Autorin, war in der Lage, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Hermann Langbein, selbst Überlebender von Auschwitz, wies darauf hin, wie viele Gerüchte im Lager kursierten, die dem Wunsch entsprangen, Unerklärliches zu erklären, aber auch durch die Ausschmückung von Dingen den monotonen Alltag zu bereichern.33 Die Darstellungen werden damit gleichsam selbst zu historischen Quellen über den damaligen Kenntnisstand der Gefangenen.
Heute, nach jahrzehntelanger Forschung und vielen gesicherten Kenntnissen zum Mordgeschehen in Birkenau, ist es nötig, sie mit dem aktuellen Wissenstand abzugleichen und offensichtliche Ungenauigkeiten zu korrigieren und einzuordnen. Dies stellt keineswegs die Glaubwürdigkeit der Berichte in Frage. Vielmehr hätten die Autorinnen und Autoren diese Fehler, die nicht aus Verfälschungsabsichten entstanden, sondern weil es schlichtweg keine Möglichkeit gab, sie durch Recherche zu verifizieren, vermutlich selbst richtiggestellt, wenn sie die Chance dazu gehabt hätten.
Auch in Gisella Perls Bericht gibt es einige Ungenauigkeiten über den Mordprozess in den Krematorien. Während ihrer Zeit in Birkenau wurden die meisten eintreffenden Menschen direkt nach ihrer Ankunft von der Ende Mai 1944 eröffneten Rampe im Lager Birkenau in die nahegelegenen Krematorien getrieben.34 Es handelte sich nicht um Holzhäuser, wie sie berichtet, sondern um massive Neubauten, die über eigens zu Mordzwecken eingebaute Gaskammern verfügten. Besonders grausam war es, wenn Kinder durch Launen der SS-Männer aus der Menschengruppe ausgesondert und lebendig auf Scheiterhaufen geworfen wurden, die sich in der Nähe der Krematorien befanden. Es ist jedoch nicht richtig, dass dies mit allen Kindern so geschah, wie Perl mehrfach angibt. Ein Großteil von ihnen starb in den Gaskammern. Auch erwähnt sie, dass aus den Körperfetten der ermordeten Juden Seife hergestellt worden sei. Zwar fand in Birkenau eine systematische Leichenfledderei statt: So wurden die Körper der Ermordeten nach Zahngold und Schmuck abgesucht, die Haare in der Industrie weiterverwertet sowie Asche und Knochenschrot in der Landwirtschaft und im Straßen- und Wegebau verwendet. Dass Seife aus den Körperfetten hergestellt wurde, ist nicht belegt.35
Auch der verständliche Versuch Perls, die Leserinnen und Leser über die strukturgeschichtlichen Hintergründe ihrer Lagerodyssee, den Aufbau des Lagersystems im Deutschen Reich und die Funktion der verschiedenen Lagertypen aufzuklären, konnte nur ungenau enden. Dies lag nicht allein daran, dass den Häftlingen viele Fakten über das Lagersystem, in dem sie sich befanden, von vornherein verschlossen waren, sondern auch am Umstand, dass dieses verflochtene System zu diesem Zeitpunkt wohl kaum jemand überblickte. Erst in den letzten Jahrzehnten ist über das expandierende Außenlagersystem detailliert geforscht worden.36 Perl erklärt: »Die größeren und kleineren Konzentrationslager in Deutschland waren in zwei Kategorien unterteilt. Die erste bestand aus den mit der deutschen Kriegsindustrie verbundenen Arbeitslagern. Bei den Zwangsarbeitern handelte es sich größtenteils um Nichtjuden. In die zweite fielen die Vernichtungslager – Auschwitz, Dachau, Groß-Rosen, Dora, Buchenwald, Ravensbrück und eine Zahl anderer, wo der organisierte Mord die einzige Aktivität war.« Grundsätzlich ist es richtig, dass die Außenlager der Kriegsindustrie, die vor allem in der zweiten Jahreshälfte 1944 überall entstanden, keinen Vernichtungszwecken dienten, obwohl auch dort die Sterblichkeit zum Teil sehr hoch war. Bis Sommer 1943 hatte die SS abgelehnt, Juden als Arbeitskräfte in das Reich zu überstellen. Danach und besonders seit dem Sommer 1944 wurden Juden und Nichtjuden gleichermaßen in die Außenlager geschickt. Die Rolle der erwähnten Stammlager war weitaus komplexer als von Perl dargestellt. Sie vereinten die verschiedenen Funktionen als Arbeitslager, Krankenlager und Umschlagplatz für Häftlingsarbeitskräfte und waren nicht nur reine Tötungsstätten, obwohl an allen diesen Orten auch systematische Mordaktionen stattfanden.
Diese Korrekturen vorzunehmen, ist nicht nur wichtig, damit sich keine falschen Informationen weiterverbreiten, sondern auch, weil Holocaustleugner jegliche Ungenauigkeiten nutzen, um die gesamte Glaubwürdigkeit der Berichtenden durch Verweis auf solche Fehler in Frage zu stellen. Olga Lengyels und Gisella Perls Berichte wurden bereits von Holocaustleugnern gut zugänglich im Internet in Frage gestellt.37 Auch wenn eine ernsthafte Beschäftigung mit revisionistischen Texten nicht ergiebig ist, da sie nicht auf einen auf Argumenten beruhenden Austausch zielen, lohnt es sich zu schauen, welche Punkte dem Autor in diesem Fall als Rechtfertigung dienten, Lengyel und Perl als Lügnerinnen darzustellen. Er beruft sich auf kleinliche Divergenzen eines von beiden beschriebenen Ereignisses – der Abtreibung, die Gisella Perl auf Wunsch der Aufseherin Irma Grese bei dieser vornahm. Gisella Perl beschrieb, dass sie dabei mit Irma Grese allein war, Olga Lengyel hingegen erklärte, sie sei als Krankenschwester hinzugebeten worden. Beide gaben unterschiedliche Uhrzeiten und Orte an sowie einen unterschiedlichen Wortlaut wieder. All diese Erinnerungsdivergenzen liegen völlig im Rahmen dessen, was die Wissenschaft als Verformungsprozesse bezeichnet, denen Erinnerungen auf natürliche Weise unterliegen. Es ist selbstverständlich, dass Erinnerungen kein Abbild einer wie auch immer vorgestellten historischen Wirklichkeit sind, sondern von vielerlei Faktoren geprägte und veränderte Erfahrungssynthesen darstellen, die sozial konstruiert werden. Eine breite Forschung zu diesen Prozessen und dem Umgang mit Überlebendenberichten in der historischen Forschung liegt inzwischen vor.38 Gerade bei der Beschreibung von persönlichem Erleben im Lager, von Erfahrungen, die sich nicht durch zeitgenössische Quellen prüfen lassen können wie Begegnungen und Gespräche, sind etwaige Ungenauigkeiten für die eigentliche Mitteilung völlig irrelevant: Ob Perl bei der Abtreibung allein zugegen war und Lengyel davon berichtet hat, die es als persönliche Erfahrung abspeicherte, oder ob Lengyel tatsächlich mit anwesend war und Perl davon nicht erzählte, weil sie es vergessen hatte oder als unwichtig erachtete, ist für die eigentliche Aussage nicht von Bedeutung. Wesentlich ist die Information, die mit der Geschichte transportiert werden soll: die Beschreibung einer kurzzeitigen Rollenumkehr im Lager, das Gefühl der Genugtuung, dass die ihre Macht rücksichtslos und grausam ausübende Grese nun plötzlich vom Können und Wohlwollen einer Gefangenen abhängig war, und die Erkenntnis, dass gerade dieser Umstand eine Gefahr darstellte, da die Aufseherin solch eine Situation eigentlich nicht zulassen konnte.
Das für uns Wertvolle an den Ereignis- und Alltagsbeschreibungen in den Berichten ist, dass wir etwas erfahren, was uns keine andere Quelle nahebringen kann: die Perspektive der Häftlinge, ihre Wissensstände, Entscheidungsnöte, Erwartungen und Ängste. Nur sie können diese Einblicke in die Lagerwirklichkeit geben und das Zusammenleben der Häftlinge sowie die Interaktionen mit den Aufseherinnen und der SS beschreiben.
Neben der Verformung durch lebensgeschichtliche Sinnkonstruktionen unterliegen Berichte, ohne bewusstes Zutun, auch dem Einfluss von zwischenzeitlich produzierten »master narratives« des Holocaust. Schon in den direkten Nachkriegsjahren wurden Diskurse über das Geschehen geprägt, die sich in Inhalt und Duktus in Perls Memoiren niederschlagen. So hatte Perl aufmerksam die Berichterstattung über den Bergen-Belsen-Prozess verfolgt, insbesondere das Verfahren gegen Irma Grese. Diese war im März 1943 aus Ravensbrück nach Auschwitz versetzt worden, dort im Mai 1944 Rapportführerin im Lager B II c geworden und als solche für die Arbeits- und Zählappelle der Häftlinge zuständig und an Selektionen beteiligt. Den Frauen in B II c ist sie durch ihre gewaltsame und dominante Machtausübung stark in Erinnerung geblieben. Nach der Räumung von Auschwitz gelangte sie nach Bergen-Belsen, wurde dort nach Eintreffen der britischen Armee im April 1945 festgenommen und als eine der Angeklagten im Bergen-Belsen-Prozess im November 1945 zum Tode verurteilt und im Dezember 1945 hingerichtet. Die Literaturwissenschaftlerin Constanze Jaiser hat darauf aufmerksam gemacht, wie problematisch die Darstellung von Irma Grese in dieser Prozessberichterstattung war.39 Hier entstand ein Klischee von Grese als »beautiful beast«, das einen engen Zusammenhang zwischen einer unterstellten sexuellen Perversion und der von ihr entwickelten sadistischen Gewalttätigkeit suggeriert. Dies führte dazu, dass gewalttätiges Verhalten von NS-Täterinnen lange Zeit nur noch mit einer triebhaften Sexualität erklärt wurde und eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Verbrechen und den Strukturen, in denen sie möglich wurden, in den Hintergrund trat. Perl (und auch Lengyel) folgen dieser Legendenbildung, die bestimmte Funktionen im Nachkriegsdiskurs bediente, da sie eine scheinbare Erklärung für die unerklärlich erscheinende und nicht ins Rollenklischee passende Brutalität einer Frau lieferte. Auch Perl und Lengyel sexualisieren die Gewalttätigkeit Greses und verschenken damit die Chance auf eine tiefergehende Beschäftigung mit der Frage, welche sozialen und strukturellen Verhältnisse dazu beitrugen, dass Grese diese Aggressivität entwickelte.
Aus dem Diskurs der damaligen Zeit stammt auch Perls starke Betonung der Schönheit und Begabung der Opfer als Beweis für den großen Verlust, bei gleichzeitiger Emotionslosigkeit bis hin zu spürbarem Sarkasmus, wenn sie das Schicksal von »hässlichen« und »streitsüchtigen« Menschen wie Jeanette oder den kleinwüchsigen Opfern von Mengeles Experimenten beschreibt. Diese Wertungen werden bei heutiger Lektüre als irritierend empfunden. Ebenfalls befremdlich wirkt die hin und wieder auftauchende Überschätzung ihres Einflusses auf das Lagergeschehen, die möglicherweise Teil ihrer Coping-Strategie in Birkenau war. So sei beispielsweise allein dank ihrer Idee, Margarine als Mittel gegen Hautentzündungen einzusetzen, Margarine zum teuersten Artikel in ganz Auschwitz geworden, und immer wieder habe sie bildlich vor Augen gehabt, wie es sein würde, wenn sie ihre Leidensgenossinnen singend in die Freiheit führen würde – ein Erlebnis, das ihr durch die vorzeitige Überstellung nach Hamburg-Wandsbek genommen wurde. Der Eindruck wird bestätigt durch die Beschreibungen von Olga Lengyel, die über die in ihrem Buch unschwer als Gisella Perl zu erkennende »Dr. G.« in freundschaftlichem Spott schreibt, sie hätte sich in einem »geradezu ungesunden Ausmaß« geweigert, sich mit dem Umstand abzufinden, dass sie nicht mehr ihr altes Leben führte. Sie hätte in einer Traumwelt gelebt und alles getan, um die Illusion eines gepflegten Luxus’ aufrecht zu erhalten, sogar Brot dafür gegeben, um sich und den anderen Reviermitarbeiterinnen das Haar richten zu lassen und stets mehrere »Garderoben« parat gehabt. Aus dem wenigen, was wir über Gisella Perl wissen: Hier wird deutlich, dass es sich um einen starken Charakter handelt. Schon als junges Mädchen hatte sie sich gegen viele Schwierigkeiten und Bedenken durchgesetzt und war Ärztin geworden. Mit ähnlicher Beharrlichkeit schaffte sie es, die grausame Realität in Birkenau für sich und auch für andere zum Positiven zu beeinflussen. Eine der stärksten Szenen im Buch ist daher auch die Beschreibung des Abends, an dem sie beschließt, gegen die in den ersten Wochen alles beherrschende Apathie anzukämpfen und Menschlichkeit in die kleine Gemeinschaft einziehen zu lassen, die sich eine Pritschenkoje zu teilen hatte: »Anstatt wie gewohnt wortlos einzuschlafen, sprach ich leise mit den Frauen, die in meiner Nähe lagen. Ich erzählte ihnen von meinem alten Leben in Máramarossziget, von meiner Arbeit, meinem Mann, meinem Sohn, den Dingen, die wir für gewöhnlich taten, den Büchern, die wir lasen, der Musik, die wir hörten … Zu meiner Überraschung lauschten sie mit andächtiger Aufmerksamkeit, was zeigte, dass auch ihre Seele, ihr Geist nach Austausch hungerte, nach Gemeinschaft, nach Ausdruck ihrer selbst. Eine nach der anderen öffneten sie nun ihre Herzen.«