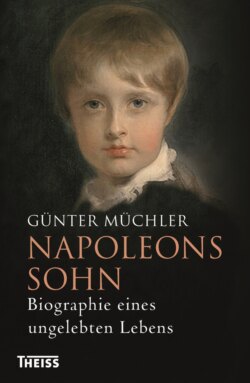Читать книгу Napoleons Sohn - Günter Müchler - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schwere Geburt
ОглавлениеDie Kanonen vor dem Invalidendom sind die Schicksalsboten von Paris. In all den Kriegsjahren haben die Hauptstädter bangen Herzens auf ihren Spruch gewartet. Feuerte die Batterie ihre Salven, wusste man, die Armee hat neue Ruhmestaten vollbracht. So war es nach Austerlitz, nach Jena, nach Friedland oder nach Wagram.
Auch am 20. März 1811 wartet die Hauptstadt auf den Spruch der Kanonen. Nur geht es diesmal nicht um Kriegsruhm. Es geht um das Glück des Hauses Bonaparte. Verstummen die Geschütze nach dem einundzwanzigsten Böller, hat die Kaiserin Marie Louise eine Tochter geboren. Geht die Kanonade weiter, ist der Thronfolger da, und Frankreich besitzt eine neue Dynastie. Denn, zum Teufel mit der Égalité!, für den Sohn sind einhundertundein Schuss bestimmt.
Am Vorabend haben bei der jungen Kaiserin die Wehen eingesetzt, etwas früher, als von den Ärzten berechnet. Im Erdgeschoss des Tuilerien-Schlosses halten sich zu diesem Zeitpunkt an die 200 Personen auf, es ist die Crème de la Crème des Reiches. Die Einladung war für eine Theatervorstellung zu Ehren des Großherzogs Ferdinand von Würzburg ergangen; der Onkel der Kaiserin ist seit der Verheiratung Dauergast in Paris. Ein Raunen geht durch die Reihen, als man plötzlich der Herzogin von Montebello gewahr wird, die, unzulänglich gekleidet, aufgeregt durch die Flure hastet. Der stürmische Auftritt der Gouvernante der Impératrice lässt eine Programmänderung erahnen. Wirklich wird die Theateraufführung abgeblasen, doch der Kaiser fordert die Gäste auf zu bleiben. Unter ihnen befinden sich Madame Mère, die Mutter Napoleons, Pauline, die Prinzessin Borghese, Napoleons sündhaft schöne Schwester, Hortense, die Adoptivtochter und Königin von Holland, sowie die Großwürdenträger des Reiches, angeführt vom Erzkanzler Cambacérès. Die Unterhaltung fällt jetzt in einen gedämpften Ton. Man steht in Gruppen beieinander. Die Herren tauschen das letzte politisch-geschäftliche Ondit aus, die Damen ihre Erfahrungen vom ersten Wochenbett. Hier und da gähnt jemand. Beim Grafen Krawinski von der Leichten Gardekavallerie kann man Wetten anlegen. Sie lauten zehn zu eins für einen Sohn.
Napoleon hält sich abseits. Er ist unruhig. Die vergangenen Tage hat er behauptet, es sei ihm gleich, ob es ein Mädchen oder ein Junge werde. Wer ihn so gut kennt wie Hortense, lässt sich von derlei Beteuerungen nicht irreführen. In ihren Erinnerungen schreibt sie: „Er wagte nicht, sich dem Glauben an einen Sohn hinzugeben. Man sah, wie er sich bemühte, auf den gegenteiligen Fall vorbereitet zu sein. Währenddessen tat er alles um herauszubringen, ob man vor der Geburt Anzeichen auf das Geschlecht feststellen könne. Mit dieser Frage verriet er seine ganze Unruhe“.1
Die folgenden Stunden weicht Napoleon nicht von der Seite der Gebärenden. Schwer tut sich die Kaiserin. Sie ist ja erst 19 Jahre alt! Napoleon sitzt auf dem Bettrand; er hält ihr die Hand und spricht ihr Mut zu. Werden die Wehen schwächer, lässt er sie durch das Zimmer gehen und stützt sie. Gegen Mitternacht schläft Marie Louise ein. In den Salons serviert man kalte Fleischspeisen, dazu werden Wein und Punsch ausgeschenkt. Zweifellos würden die meisten Gäste lieber daheim im warmen Bett liegen. Aber keiner traut sich zu gehen. Die Glücklichen dämmern in irgendeinem Fauteuil vor sich hin. Wer keinen Schlaf findet, vertritt sich im Hof die Füße. Um 6 Uhr wird ein Communiqué verbreitet, in dem es heißt, dass die Wehen am Abend eingesetzt und gegen Morgen fast ganz aufgehört haben. Endlich ist man frei zu gehen. Der Kaiser zieht sich in seine Räume zurück und nimmt ein heißes Bad, wie er es in Augenblicken hoher Anspannung zu tun pflegt.
Napoleon hat es sich in der Wanne bequem gemacht, als ihm um 7 Uhr der Docteur Dubois gemeldet wird. Antoine Dubois ist Professor an der medizinischen Fakultät von Paris. Er war einer der 108 Chirurgen, die den General Bonaparte auf der legendären Ägypten-Expedition begleiteten. Dubois verbirgt seine Unruhe nicht. Das Kind liege schwierig, erklärt er. Man werde Eisen nehmen müssen, vielleicht. Am liebsten würde er sich vorher mit dem Kollegen Corvisart besprechen. Doch der kaiserliche Leibarzt ist nicht da. Er hat sich zu Hause aufs Ohr gelegt. Was es bedeute, die Eisen zu nehmen, will Napoleon wissen. Ob das Leben von Mutter und Kind gefährdet sei. Dubois räuspert sich. Es könne, jedenfalls dürfe man nicht völlig ausschließen, dass es auf ein Entweder-oder zulaufe, und wie für diese Eventualität des Kaisers Befehl laute. Napoleon besinnt sich eine Weile und fragt dann, was Dubois tun würde, handelte es sich um eine einfache Bürgersfrau. „Ich würde von meinen Instrumenten Gebrauch machen.“ „Nun, so tun Sie, als befänden Sie sich im Hause eines Kaufmanns an der Straße von Saint-Denis; kümmern Sie sich um Mutter und Kind, und wenn Sie nicht beide retten können, so erhalten Sie mir die Mutter!“ Hastig zieht er sich an und eilt hinüber zu Marie Louise, die beim Anblick der Geburtszange erschrocken aufschreit: „Also weil ich Kaiserin bin, muß ich mich opfern lassen!“ Als der Eingriff beginnt, ist es mit Napoleons Mut vorbei; er verlässt das Zimmer.
Um 9.20 Uhr kommt das Kind. Es kommt mit den Füßen voraus. Es ist ein Junge, scheinbar leblos. Man bettet das Kind auf den Boden. Unbeachtet liegt es da, während die Ärzte sich um die Mutter kümmern. Als feststeht, dass sie das Schlimmste hinter sich hat, stürzt Napoleon ins Zimmer und schließt Marie Louise in die Arme. Erst jetzt wendet sich Corvisart, der inzwischen eingetroffen ist, dem Neugeborenen zu. Er hebt es auf, flößt ihm ein paar Tropfen Alkohol ein und wickelt es in warme Tücher. Es dauert noch mehr als fünf Minuten, ehe das Kind ein erstes Lebenszeichen von sich gibt.
So schildern die Beteiligten das Ereignis vom 20. März 1811. Die Berichte mögen hier und da etwas ausgeschmückt sein. Fest steht, dass das Leben von Mutter und Kind gefährdet war, wovon die Mitteilung des „Moniteur“ natürlich nichts erwähnt: „Am heutigen 20. März hat sich die Hoffnung Frankreichs erfüllt“, verlautbart das Staatsorgan. „Ihre Majestät die Kaiserin ist von einem Prinzen entbunden worden. Der König von Rom und seine erhabene Mutter befinden sich bei bester Gesundheit“.2
Was weiß man über das Befinden des Vaters? „Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Sie gehört mir!“, lässt ihn Victor Hugo in seinem Poem „Napoleon II.“ emphatisch ausrufen. Tatsächlich ist dem Kaiser die Zukunft in diesem Augenblick ausnahmsweise gleichgültig. Der Herrscher ist suspendiert, Napoleon empfindet wie ein normaler Mann, was zählt, ist seine Frau. Hortense hält fest, die ersten von Napoleon herausgejubelten Worte seien gewesen: „Es ist vorbei, sie ist gerettet!“ Auf die Frage, ob es ein Sohn sei, habe er genickt, aber vollkommen niedergeschlagen gewirkt: „Ich kann das Glück nicht genießen. Die arme Frau hat so viel leiden müssen!“ Nur langsam überwindet er den Gefühlsaufruhr. Die Lockerheit ist gespielt, als er wenig später – Cambacérès hat wie vorgeschrieben die Geburt des „Kindes von Frankreich“ beurkundet – den Umstehenden erklärt: „Nun denn, ich denke, es ist ein ganz tüchtiger und ein ganz schöner Knabe, den wir jetzt haben. Er hat sich ein wenig bitten lassen, um anzukommen, aber am Ende ist er da!“
Draußen hat das Orakel vor dem Invalidendom zu sprechen begonnen. Beim zweiundzwanzigsten Kanonenschuss hält ganz Paris den Atem an, auch Marie-Henri Beyle, den wir besser unter dem Namen Stendhal kennen. Im Lotterbett neben seiner Freundin Angéline, zählt er mit. Der dreiundzwanzigste Schuss! „Wir hörten es unten auf der Straße applaudieren“.3 Also ist es ein Sohn! Man umarmt sich, man freut sich mit dem Vater, man fühlt seine Erleichterung nach, kombiniert aber auch politisch. Wurde mit dem Sohn der Frieden geboren, den man sich so sehr wünscht? Der Comte de Lavalette, Direktor des Postwesens, war aufgrund seines geringen Ranges nicht in die Tuilerien eingeladen, hatte sich aber trotzdem Eintritt verschafft. Später erinnert er sich an das, was ihm zuerst durch den Kopf schoss: „Es kam mir damals so vor, als sollte der Kaiser jetzt den Säbel einmotten und sich ganz der Verwaltung seines großen Reiches hingeben, als sollte Frankreich glücklich und die Erinnerung an die Bourbonen für immer begraben sein“.4 Die Zukunft wollte es anders, sehr zum Schaden Lavalettes. Nach der zweiten Rückkehr der Bourbonen wurde der Postdirektor, der sich im Abenteuer der Hundert Tage Napoleon zur Verfügung gestellt hatte, angeklagt und zum Tode verurteilt. Der Vollstreckung konnte er sich nur dadurch entziehen, dass er aus dem Gefängnis floh, in den Kleidern seiner Frau.
Wie Lavalette denken viele, sogar die Generäle sind Friedensapostel geworden. Ginge es nach ihnen, wäre das Kapitel Eroberungen abgeschlossen. Sie sind dem Kaiser durch dick und dünn gefolgt und haben von seinen Siegen profitiert. Mit Fürstentiteln, Geld oder hohen Ämtern beschenkt, hoffen sie jetzt auf einen Politikwechsel, damit sie endlich die Früchte des Ruhms genießen können. Auch Goethe möchte hoffen. In einem Auftragsgedicht für die Bürgerschaft von Karlsbad verknotet er die Topoi Geburt und Frieden: „Nun steht das Reich gesichert wie geründet/Nun fühlt er froh im Sohne sich gegründet.“ Die Schlusszeilen lauten: „Uns sei durch Sie das letzte Glück beschieden/Der alles wollen kann – will auch den Frieden.“ Goethes Stoßseufzer kommt zu spät. Im Juni 1812, als er die „Karlsbader stanzen“ verfasst, befindet sich Napoleon bereits im Anmarsch auf Rußland. Das Gedicht war der Kaiserin Marie Louise gewidmet.5 Goethe, der seit seiner Erfurter Begegnung mit dem Kaiser vollends zu seinem Bewunderer geworden ist, hat schon bessere Verse geschrieben als diese. Aber sie treffen das große Aufatmen, das die Geburt grenz überschreitend unter den Anhängern des Empereur auslöst: Man ist saturiert. Der Kaiser hat, was er will. Die Bahn ist frei für eine Friedensära!