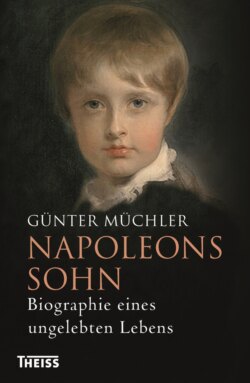Читать книгу Napoleons Sohn - Günter Müchler - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Marie Louise
ОглавлениеFranz ist 34, als ihn der überraschende Tod seines Vaters Leopold 1792 auf den Kaiserthron befördert, der zu diesem Zeitpunkt noch der römisch-deutsche ist.13 Er ist von kleinem Wuchs, ein dürrer Mann, der mit seinem länglichen Gesicht und der nach Habsburger Art herunterhängenden Unterlippe selbst unter dem Pinsel pietätvoller Porträtisten nicht zur Schönheit wird. Man kennt ihn als knausrig; in Bewegung gerate er immer nur dann, wenn er bar bezahlen müsse, spottet Friedrich von Gentz. Zum tüchtigen Herrscher fehlt es ihm an Fantasie. Dabei ist er zutiefst von seinen durch Geburt verliehenen Vorrechten überzeugt. Der Gedanke, sich durch eine Verfassung zu binden oder dem Volk Mitsprache bei der Ausübung der Macht einzuräumen, liegt jenseits seines Vorstellungsvermögens. „Alles für das Volk. Nichts durch das Volk.“ Das war die Devise seines Onkels, des 1790 gestorbenen Kaisers Joseph II. An diese Devise hält sich Franz. Er will ein absoluter Herrscher sein. Selbst Metternich, den er nach der Niederlage von 1809 zum Minister beruft und der ihm das Regieren weitgehend abnimmt, muss stets auf das stolze Selbstverständnis seines Souveräns Rücksicht nehmen. De facto bestimmt er Österreichs Politik. Seine Meisterschaft besteht darin, es den Kaiser nicht merken zu lassen.
„Apathisch, kalt, von langsamem, aber ziemlich richtigen Urteil.“ So charakterisierte Joseph II. seinen Neffen, als dieser ihm als „Kaiserlehrling“ diente.31 Und doch mögen die Untertanen ihren Kaiser. Er macht nicht so viel von sich her wie andere gekrönte Häupter. Er treibt keine Mätressenwirtschaft und wirkt väterlich. Das Volk liebt Monarchen mit bürgerlichem Habitus. „Gott erhalte Franz den Kaiser/Unsern guten Kaiser Franz!“ Der von Lorenz Leopold Haschka getextete und von Joseph Haydn komponierte Weihegesang wird 1807 uraufgeführt und bleibt Österreichs Kaiserhymne bis 1918.
Die zweite Strophe der Hymne beginnt mit einer Bitte an den lieben Gott: „Laß von seiner Fahne Spitzen/Strahlen Sieg und Fruchtbarkeit.“ Die Bitte um Fruchtbarkeit wird überreich erfüllt. Franz wird dreizehnmal Vater. Ganz anders steht es mit den Siegen. Vier Kriege, vier Niederlagen, gewaltige Einbußen an Territorium und „Seelen“ – die Bilanz der ersten 18 Regierungsjahre Franz des Kaisers ist nicht eben glanzvoll. Wenigstens hat Österreich seine Existenz behauptet. Ringsumher sind ganze Königreiche verschwunden, Monarchen wurden vertrieben und durch Emporkömmlinge ersetzt. Preußen, der deutsche Rivale Habsburgs, stand knapp vor dem Abgang aus der Geschichte. Aber der Hohenzollernstaat hat nach dem Verhängnis von 1806/07 mit beachtlichen Reformen begonnen. Österreich dagegen macht nach seinen Niederschlägen weiter wie zuvor. Es bewegt sich nicht. Es ist einfach da und mit ihm sein Kaiser, dessen größte Qualität wohl seine Nehmerqualität ist. Damit beeindruckt er sogar Napoleon. „Eure Majestäten, die auf dem Thron geboren sind, halten es aus, zwanzigmal geschlagen zu werden. Jedesmal kehren sie zurück in ihre Hauptstadt.“ Als Napoleon vier Jahre später, 1813, Metternich im Dresdner Palais Marcolini diese zornigen Sätze entgegenschleudert, denkt er zuallererst an Kaiser Franz.32
Der Kaiser bleibt – Franz bringt es bis zu seinem Tod auf 43 Regierungsjahre –, die Kaiserinnen wechseln. Sie sterben der Reihe nach. Franz’ erste Frau Elisabeth Wilhelmine von Württemberg verscheidet 1790, zwei Jahre nach der Hochzeit. Die Nachfolgerin Maria Theresia von Neapel-Sizilien ist wie ihre Vorgängerin eine Cousine ersten Grades. Das verwandte Blut ist der Nachkommenschaft nicht günstig. Mehrere Kinder erleben das Jugendalter nicht. Ferdinand, der den Thron von seinem Vater erben wird, ist geistig stark eingeschränkt. Auf Maria Theresia, die 1807 stirbt, folgt Maria Ludovica von Modena. Als auch sie nicht mehr ist, heiratet Franz 1818 zum vierten Mal. Karoline Augusta von Bayern überlebt ihren Mann um viele Jahre. Man hat Franz einen starken Sexualtrieb nachgesagt und den Beweis darin gesehen, dass er nach dem Tod seiner ersten und seiner zweiten Frau jeweils nur ein Jahr verstreichen ließ, bis er sich eine neue Partnerin nahm. Nach dem Tod von Maria Ludovica beträgt die Zeitspanne immerhin zwei Jahre. Das Alleinsein ist Franz’ Sache nicht.
Als Franz zum Kaiser gewählt wird, ist die am 12. Dezember 1791 geborene Marie Louise noch keine zwei Jahre alt. Der Hof hat einen Knaben erwartet, aber gefeiert wird auch die Tochter. Zur Geburt läuten in Wien die Glocken, und auf den Wällen donnern die Kanonen. Getauft wird Marie Louise mit Jordanwasser. Maria Theresia kümmert sich nach der Niederkunft nur sporadisch um ihre Älteste. Sie hat sie zur Welt gebracht, für die Aufzucht ist das Personal zuständig. Die lebenslustige Kaiserin ist gern in Gesellschaft, sie tanzt leidenschaftlich, und bei Maskenbällen im Fasching, die sie besonders liebt, kann es sein, dass sie sich sehr ausgelassen benimmt, was bei Hofe nicht gut ankommt. Wie sie ihre Extrovertiertheit auslebt angesichts der Tatsache, dass sie beinahe ununterbrochen schwanger ist, bleibt ein Rätsel. Jedenfalls kann Marie Louises Mutter als das Gegenbild des Vaters gelten. Der ist in sich gekehrt, er trägt am liebsten seinen grauen Rock, Tanzvergnügen sind ihm zuwider, öffentliche Zuschaustellungen lässt er über sich ergehen. Franz geht die Häuslichkeit über alles. Seinen Kindern ist er zugetan. Mit Marie Louise geht er gern spazieren. Er macht ihr kleine Geschenke, wofür sie dem „lieben Papa“ auf rührende Weise dankt. Es wundert nicht, dass Marie Louises Verhältnis zum Vater von Beginn an inniger ist als das zur Mutter. Bei der Mutter findet sie weder Zärtlichkeit noch Wärme. „Wenn sie mich doch nur in ihre Arme nähme!“, klagt Marie Louise einmal.
In einem Punkt ziehen die Eltern an einem Strang: Erstes Erziehungsziel ist Gehorsam. „Ihre unterthänigste gehorsamste Tochter Louise“, unterzeichnet die Kleine, wenn sie dem Vater schreibt. Gehorsam ist sie auch der Kirche schuldig. Vor allem der Kaiser ist kirchenstreng. In dieser Hinsicht hat seine Lehrzeit beim Onkel Joseph II., der Klöster aufgehoben und Kirchengut säkularisiert hatte wie ein Jakobiner, keine Spuren hinterlassen. Zu den Haltungen, die Marie Louise einstudiert, gehört auch die Bescheidenheit. Mögen andernorts Prinzessinnen im Glauben aufwachsen, Luxus und Verschwendung seien standesgemäß, werden die Töchter des Hauses Habsburg kurz gehalten. Marie Louise ist kein verwöhntes Kind. Lernen muss sie eine Menge. Weil Österreich ein Vielvölkerstaat und die Dynastie mit halb Europa verwandt ist, steht der Spracherwerb im Curriculum obenan. Mit ihren Privatlehrern paukt Marie Louise Englisch und Spanisch, Tschechisch und Italienisch. Sogar ein paar Brocken Türkisch kennt sie, und Französisch beherrscht sie bald besser als Deutsch, jedenfalls im Schriftlichen. Ihrer Freundin Victoire nennt sie im Scherz neun Sprachen, die sie beherrsche, darunter auch Kurzschrift, das Einmaleins und das Rückwärtslesen.33
Dazu wird sie in die Anfangsgründe der Geografie, der Statistik und der Geschichte eingeführt. Sie liest den „Plutarch für die Jugend“, eine Galerie großer Männer, die mit Homer beginnt und mit Napoleon endet, was ihr missfällt. Lieber hätte sie als krönenden Abschluss ihren Vater, wo doch der andere, so äußert sie gegenüber ihrer Freundin Victoire Putet,34 „nichts als Ungerechtigkeiten begangen und einigen von uns die Länder weggenommen hat“. Sie lernt ganz passabel Klavier spielen. Mit der Kenntnis der klassischen Literatur ist es dagegen nicht weit her. Bei der Auswahl ihrer Lektüre scheinen die Lehrer hauptsächlich darauf bedacht gewesen zu sein, dass die Schülerin nicht allzu früh vom Baum der Erkenntnis nascht. Gewisse Stellen sind in den Büchern, die man ihr zu lesen gibt, geschwärzt. Aus nämlichem Grund achtet man genau darauf, dass ihre Haustiere ausschließlich weiblichen Geschlechts sind – wie sie später ihrem Sekretär, dem Grafen Menéval, gesteht.35
Nur ganz selten betritt Marie Louise die dunkle Hofburg. Die meiste Zeit verbringt sie in Laxenburg und in Schönbrunn, Schlössern außerhalb der Stadt. Sie ist ein fröhliches Kind. Wenn sie an etwas leidet, dann ist es der fehlende Umgang mit Gleichaltrigen, die Mangelkrankheit vieler Königskinder. Einziger Lichtblick ist Victoire de Putet. Victoire ist als Spielkameradin geduldet, denn ihre Mutter, die Gräfin Colloredo, Ehefrau des leitenden Ministers, hat als „Aja“ der Erzherzogin eine wichtige Stellung inne.14 Mit Victoire kann sie herumtollen, mit ihr kann sie ihre kleinen Geheimnisse teilen. Die „liebe Colloredo“ schließt Marie Louise ins Herz. Sie führt ein mildes Regiment und gibt dem Kind, was es bei der richtigen Mutter vermisst. „Du bist so gut“, schreibt die Kleine der Gouvernante, „daß ich Dich gern Mama nennen würde, denn ich möchte Deine Tochter sein wie Victoire“.36 Aber dann kommt das böse Jahr 1805. Österreich, das zusammen mit Russland Frankreichs lästige Übermacht brechen will, wird bei Austerlitz vernichtend aufs Haupt geschlagen. Und weil Kaiser Franz einen Sündenbock braucht, fällt der Minister Colloredo in Ungnade und Madame Colloredo gleich mit. Österreich hat den Krieg verloren, Marie Louise verliert ihre Aja. Zwei Jahre später verliert sie auch die leibliche Mutter. Maria Theresia stirbt 1807 bei der Geburt ihres 13. Kindes.