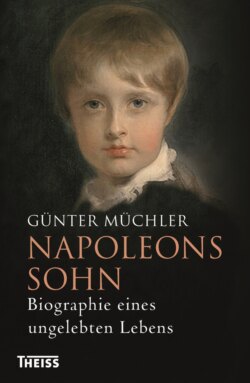Читать книгу Napoleons Sohn - Günter Müchler - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stammbaum und Stabilität
ОглавлениеUm innezuhalten, eignet sich das Jahr 1811 – das zwölfte, seit Napoleon die Geschicke Frankreichs lenkt, das zweiundzwanzigste nach Ausbruch der Revolution – wirklich nicht schlecht. Die beiden letzten Jahre hat Napoleon dazu genutzt, die Verwaltung des planlos ins Unermessliche gewachsenen Reiches zu straffen und zugleich den Wirtschaftskrieg gegen England zu forcieren. Wer eine See- und Handelsmacht in die Knie zwingen will, muss die Küsten beherrschen. Die Annexionswelle, die über den Kontinent geschwappt ist, hat Paris gleichsam zur zentralen Hafenmeisterei Europas gemacht. Holland und die Staaten des Papstes gehören mittlerweile zum Bestand Frankreichs, französisch sind auch die Mündungsgebiete von Elbe, Weser und Ems. Istrien, Dalmatien und Ragusa figurieren als „Provinz Illyrien“. Frankreich besteht jetzt aus 130 Departements. Es hat eine Ausdehnung, die das Reich Ludwigs XIV. weit in den Schatten stellt. Kann der Kaiser noch mehr wollen? Die Dynastie ist etabliert, die vierte nach Merowingern, Karolingern und Capetingern. Was hindert ihn, seine unermüdliche Energie darauf zu richten, sichere Bündnisse zu schließen und die Herzen der botmäßig gemachten Völker zu gewinnen, kurz: das Reich zu konsolidieren?
Keine Frage, Napoleon will den Frieden. Er will ihn instinktiv, wie jeder, der etwas geschaffen hat, das Erreichte zu sichern trachtet. Dass sein Friedenswille bezweifelt wird, ärgert ihn. Man hält ihn für einen blindwütigen Eroberer, er weiß es. Sogar die meisten Marschälle glauben, er könne nicht genug bekommen. Sie begreifen nicht, was auch er erst begreifen musste: Es ist weniger anstrengend, eine Schlacht zu gewinnen, als einen guten Frieden zu schließen. Zumal dieser Krieg ein Krieg neuen Typs ist. Die Kriege, die das Ancien Régime kannte, wurden von absolut herrschenden Königen um begrenzter Ziele vom Zaun gebrochen und beendet, wenn entweder die Ziele erreicht oder die Kassen leer waren. Dieser Krieg ist anders; auch deshalb dauert er schon an die zwanzig Jahre. Von Anfang an ging es um letzte Ziele. Um die neue Ordnung, die das revolutionäre Frankreich mit Zähnen und Klauen verteidigte, und gegen die die verbliebenen Monarchen Europas Sturm laufen mussten, wollten sie nicht auf dem Schafott enden wie Ludwig XVI. Vergleichbar ist er mit dem Dreißigjährigen Krieg. Dieser fand ein Ende erst dann, als alle Beteiligten ausreichend erschöpft waren. Im aktuellen Konflikt fühlt sich jede Partei noch stark genug, der anderen den finalen Schlag zu versetzen. Deshalb kann er jederzeit wieder aufflammen. So geschehen 1809, als Österreich plötzlich über das mit Frankreich verbündete Bayern herfiel und in Tirol die Bauern unter Andreas Hofer aufstanden. Auch in Deutschland gärt es, wie die desperaten Aktionen des Majors von Schill oder des Herzogs von Braunschweig bezeugen.1 In Spanien trotzen Bauern und Priester den sieggewohnten französischen Armeen. Dieser kleine Krieg, die guerilla, ist auch eine Frucht der Revolution: Die Leidenschaften der Völker haben sich verselbstständigt. Sie tragen dazu bei, dass dem Krieg die Energie nicht ausgeht. Eine andere Triebkraft ist Englands unerschöpflicher Tresor. Englands Geld hat bisher noch immer gereicht, wenn es galt, Aufstände gegen das Empire zu finanzieren.
Nein, Napoleon ist keineswegs der Allmächtige, wie Goethe meint. Er kann nicht so einfach aus diesem Dauerkrieg aussteigen, den er geerbt hat. Gewiss, an ihm hängt viel. Er könnte Zeichen der Friedensbereitschaft setzen. Er hat bewiesen, hierin vielleicht nur dem großen Alexander und Cäsar vergleichbar, wie viel ein Einzelner vermag. Doch wirklich unumschränkt herrschten auch sie „nur in den Verhältnissen, nicht über die Verhältnisse“.6 Und Cäsar berief sich auf göttliche Vorfahren! Alexander war Königssohn! Napoleon dagegen ist aus dem Nichts aufgestiegen. Auf der Schule in Brienne hänselten ihn die Mitschüler, weil er aus dem zurückgebliebenen Korsika kam und so bettelarm war, dass er an ihren kindlichen Vergnügungen nicht teilhaben konnte. Viel hat er inzwischen erreicht, aber man gönnt es ihm nicht. Der faulste, verderbteste dieser Erbkönige genießt mehr Respekt als er, der sich alles erarbeiten musste. Der Emporkömmling kann seines Besitzes niemals sicher sein. Auch deshalb ist „Frieden machen“ leichter gesagt als getan.
Nicht dass Napoleon selbst unter dem fehlenden Stammbaum litte! Sein Ego ist stark genug. Er hat den Stolz des Parvenüs. Als nach der Eheschließung mit Marie Louise Wohlmeinende versuchen, seine Abstammung künstlich zu veredeln, lässt er kühl im Staatsanzeiger festhalten: „Auf alle Fragen, von wann das Haus Bonaparte datiert, ist die Antwort sehr leicht: vom 18. Brumaire.2 Wie kann man so wenig Takt und Gefühl für das haben, was man dem Kaiser schuldet, um der Frage Bedeutung zu geben, wer seine Vorfahren waren?“.7 Aber die stolze Erwiderung ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Napoleon macht sich nichts vor. Der fehlende Stammbaum ist ein ernstes Thema. Es hat zu tun mit der Stabilität des Reiches.
Die Frage nach der Stabilität ist nicht neu und sie wird auch keineswegs bloß von Napoleon gestellt. Im Grunde befindet sich Frankreich immer noch in dem seit 1789 herrschenden Ausnahmezustand. Die europäischen Rivalen denken nicht daran, die durch die Revolution und Napoleon errungene Vormachtstellung anzuerkennen – daher der dauernde Krieg. Im Innern hängt alles an der Person des Kaisers. Keiner weiß, was werden soll, wenn Napoleon einmal nicht mehr ist. Das beunruhigt niemanden mehr als die, die sich in den Turbulenzen der Revolution die Finger schmutzig gemacht oder die in der großen Umschaffung ihren Reibach gemacht haben. Es lohnt sich, einen Blick auf diese beiden Gruppen zu werfen. Sie sind es, die den Mann, der zum Staunen der Welt geworden ist, in den Sattel gesetzt haben und die ihm bis jetzt den Rücken stärken.
Die erste Gruppe bilden die Notabeln, das heißt die Besitzenden, die zum Beispiel als Bankiers oder Fabrikanten ihren Reichtum angehäuft haben. Den Geldadel gab es schon vor dem Wendejahr 1789. Peu à peu hatte er sich an den Geburtsadel herangearbeitet, vom Ehrgeiz zerfressen, dessen Umgangsformen zu übernehmen. Molière hat den Aufsteigern im „Le bourgeois gentilhomme“ ein spöttisches Denkmal gesetzt. Es gehört zu den ironischen, faktisch jedoch außerordentlich bedeutsamen Ergebnissen der Revolution, dass die Schicht der Notabeln unter der Ägide der Gleichheit aufgegangen ist wie ein Hefeteig. Nur wenige Monate nach dem Sturm auf die Bastille fasste die Nationalversammlung den Beschluss, Kirchen und Klöster entschädigungslos zu enteignen. Bis dahin hatte die Kirche nicht weniger als ein Fünftel des französischen Bodens besessen. Die gewaltige Masse des Raubguts, das durch die gleichfalls eingezogenen Güter emigrierter Aristokraten noch einmal an Tonnage zunahm, wurde zum Nationaleigentum („bien national“) erklärt und teilweise zu Spottpreisen auf den Markt geworfen. Es waren vor allem Bauern, die zulangten. Aber auch Bürger, Beamte oder Intellektuelle warfen sich auf die Bodenspekulation und nutzten die einmalige Gelegenheit, zu „bourgeois campagnards“ zu werden. Soziologisch betrachtet, handelte es sich um einen Erdrutsch sondergleichen, denn es wurde ja keine Kleinigkeit umverteilt. Innerhalb eines Jahrzehnts wechselte ein Zehntel des französischen Bodens den Besitzer.8 Die Zahl der Erwerber von „biens nationaux“ ging in die Hunderttausende, ja in die Millionen.3 Diese Revolution in der Revolution wirkt sich unmittelbar auf die Politik aus. Denn weil die Neureichen immer in der Angst leben, bei einer siegreichen Konterrevolution ihren prekären Besitz zu verlieren, sind sie in existenzieller Weise an der Haltbarkeit der neuen Verhältnisse interessiert. Und wer kann Stabilität besser garantieren als Napoleon, der starke Mann?
Genauso stabilitätsorientiert sind die alten Revolutionäre. Viele von ihnen sind unter Napoleon in Führungspositionen eingerückt. So verfügen die meisten Spitzenmilitärs über eine revolutionäre Vergangenheit. Auch in der Regierung sitzen nicht wenige, die sich in den Jahren der Umwälzung einen Namen gemacht haben. Fouché ist Polizeiminister, Cambacérès wird zuerst Mit-Konsul, dann Erzkanzler. Sie haben bei der Aburteilung Ludwigs XVI. mit Ja gestimmt – in der Sprache der Emigranten sind sie „Königsmörder“ (régicides) – oder sie haben sich wie Talleyrand, der als Bischof in der Nationalversammlung den Anstoß zur Enteignung des Kirchenguts gab, in ähnlich riskanter Weise exponiert. Sie brauchen nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was ihnen blüht, sollte eines Tages die bourbonische Verwandtschaft des gemordeten Königs nach Frankreich zurückkehren.
Beide Gruppen – die neuen Besitzer und die alten Revolutionäre – sind die natürlichen Verbündeten Napoleons. Sie treten erstmals beim Putsch des 18. und 19. Brumaire (9. und 10. November 1799) in Erscheinung. Selten ist ein Putsch so einhellig begrüßt worden wie dieser. Das ganze Volk hat die Revolution satt. Es will zwar nicht zurück in die Zeit der Kniehosen und Perücken. Es will nur endlich Ruhe haben und Rechtsfrieden. Das seit dem Thermidor, dem Sturz Robespierres regierende Direktorium hat seinen Kredit verspielt. Es ist korrupt, unfähig und unpopulär. Lässt man es gewähren, wird Frankreich den Bourbonen und ihrem emigrierten Anhang in den Schoß fallen wie eine überreife Frucht. Das ist der Albtraum aller, die etwas zu verlieren haben. Und sie präsentieren einen „Sauveur“. Der Retter ist der junge General Bonaparte, dessen Stern in Italien aufgegangen war, wo er mit einer zunächst verlotterten und undisziplinierten Armee Österreicher und Piemonteser aus dem Feld kartätschte, und der gerade als Held aus dem Märchenland der Pharaonen zurückgekehrt ist.4
„Frankreich wird nicht vergewaltigt; es gibt sich hin“.9 Wohl ahnen die Weitblickenden, dass die Unterwerfung mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet sein könnte. Christine Reimarus, deren Mann, der Schwabe Karl Friedrich Reinhard, als Platzhalter Talleyrands für einen kurzen Augenblick das Außenministerium der Republik leitet, entgeht der autokratische Zug Bonapartes nicht. „Er reicht dem Volk, das an ihn glaubt, eine Schale voll goldener Hoffnungsfrüchte. Die Hand, die sie hält, zittert nicht“, notiert sie in ihrem Tagebuch. Christine Reimarus sieht voraus, dass nicht alle Früchte süß sein werden, trotzdem werde man sie essen müssen. „Der Denker, der in seinen Träumen lebt, mag diese Notwendigkeit beklagen; aber der aufgeklärte Zuschauer wird erkennen, daß das Wohl des Landes diesen Preis kostet“.10
Dass der „Bürger General“ vielleicht nicht dem Idealbild des Freiheitshelden entspricht, von dem die Revolution in ihren unbedarften Anfängen geträumt hat, würden viele zugeben. Napoleons Bruder Lucien beurteilt den Charakter des Älteren illusionslos: „Er scheint mir einen ausgeprägten Hang zum Tyrannen zu haben“.11 Aber so genau möchte man das gar nicht wissen. Hauptsache, der „Sauveur“ hält, was man sich von einem Retter verspricht. Und das tut Napoleon. Im Eiltempo lässt er eine Verfassung beschließen, deren Quintessenz lautet: „Die Macht kommt von oben, das Vertrauen von unten.“5 Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten, wirft er sich zunächst auf das Feld der inneren Sicherheit. Die Pest des verbreiteten Straßenräuberwesens wird ausgeräuchert. Die königstreue Vendée, in der es immer brodelt, wird ruhiggestellt. Parallel zur Beendigung des Bürgerkriegs schlägt er bei Marengo Österreich aufs Haupt und gewinnt für Frankreich die inzwischen wieder verloren gegangene Vorherrschaft in Oberitalien zurück. Ein Konkordat mit dem Papst zieht den Schlussstrich unter den Kirchenkampf. Das Land erlebt einen enormen Modernisierungsschub. Die Bank von Frankreich wird gegründet, der „franc germinal“ eingeführt. Das bürgerliche Recht wird im „code civil“ reformiert. Die Departements-Verwaltung wird durch die Einführung von Präfekten, die die Regierung ernennt, in eine effiziente Maschine umgewandelt. Der Straßenbau wird vorangetrieben. Wahrhaftig: Die Hand des Retters zittert nicht.