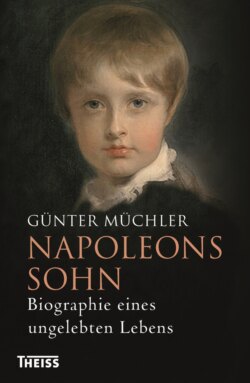Читать книгу Napoleons Sohn - Günter Müchler - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine schöne Färse für den Minotaurus
ОглавлениеMarie Louise steht jetzt in ihrem 16. Lebensjahr. Eine Schönheit verspricht sie nicht zu werden, doch immerhin ist sie blond, hat blaue Augen, rosige Wangen, vor allem ist sie gut gebaut, und für die wulstige Unterlippe kann sie nichts. Für die Hauptaufgabe der Töchter Habsburgs, vorteilhaft zu heiraten, ist sie nicht schlecht gerüstet. Heiratspolitik ist die Paradedisziplin des österreichischen Kaiserhauses. „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ („Kriege führen mögen andere, du, glückliches Österreich, heirate“). An Kindern mangelt es selten. Die große Maria Theresia hatte 16, davon neun Töchter. Zwei ihrer Söhne, die beide Kaiser wurden, Joseph II. und Leopold II., nannten acht bzw. 16 Kinder ihr eigen. Mit seinen 13 Kindern nimmt Franz, der Enkel der Kaiserin, einen guten Mittelplatz ein.
Zweckheiraten waren zu allen Zeiten in Monarchien üblich. Die Habsburger sind aufgrund ihrer zahlreichen Nachkommenschaft bloß besonders wettbewerbsfähig. Übrigens beteiligt sich auch der Kaiser Napoleon an der waffenlosen Variante der Eroberungspolitik. Als sein jüngster Bruder Jérôme aus Amerika eine bürgerliche Frau mitbringt, zwingt ihn Napoleon, sich von ihr zu trennen und eine württembergische Prinzessin zu ehelichen. Eugène Beauharnais erhält eine Wittelsbacherin zur Frau. Hortense muss Napoleons Bruder Lucien heiraten, obwohl sie ihn verabscheut. Ehen werden geschlossen, um Macht und Ansehen der Dynastie zu mehren, Liebesheiraten werden nur dann toleriert, wenn sie nicht gegen diesen Grundsatz verstoßen. Maria-Karolina, eine der neun Töchter Maria Theresias und selbst Mutter von 13 Kindern, fasst die heiratspolitischen Erfahrungen ihres Hauses in folgender Erziehungsanweisung zusammen: „Ich denke, daß, wenn wir unsere Prinzessinnen streng und ohne Bekanntschaft mit Männern halten, sie keine Vergleiche anstellen können, und darum jene liebeswürdig finden und sich an sie anschließen werden, die Gott ihnen beschieden haben wird“.37
So gesehen, ist die Nonchalance, mit welcher Marie Louise dem Kaiser der Franzosen versprochen wird, ohne dass man die Neigung der Braut auch nur mit einem Sterbenswörtchen erkundet hat, schon nicht mehr ganz so erstaunlich. Dass sich die Erzherzogin nicht fügen könne, stellt für Metternich nur eine theoretische Möglichkeit dar, weil, so erklärt er, „unsere Prinzessinnen wenig gewöhnt sind, ihre Gatten nach ihrem Herzen zu wählen. Der Respekt, den eine so gut erzogene Tochter wie die Erzherzogin vor dem Willen ihres Vaters hat, läßt mich hoffen, daß von ihrer Seite keine Schwierigkeiten zu erwarten sind“.38 Indessen gilt es, den Fall mit besonderer Umsicht zu traktieren. Der für Marie Louise ausgesuchte Bräutigam ist nun einmal kein unbeschriebenes Blatt, sondern die Fleisch gewordene Revolution.
In der Vorstellungswelt der 18-jährigen Kaisertochter gehört Napoleon ohne Wenn und Aber ins Reich des Bösen. Das Einzige, was man zu seinen Gunsten anführen kann, ist, dass er vielleicht als Werkzeug Gottes handelt, so wie Gott von Zeit zu Zeit die Pest auf die Erde schickt, um dem sündigen Volk die Augen zu öffnen. „Monster“, „Menschenfresser“ und „Antichrist“ sind am Wiener Hof gängige Beinamen für den Emporkömmling mit der selbst fabrizierten Kaiserkrone. Wer sich auf Französisch auszudrückt, spricht vom „ogre corse“, dem „korsischen Ungeheuer“. Die unglaublichsten Geschichten hat das Kind gehört: Dass Napoleon in Ägypten „Türke“ geworden sei und dass er seine Minister regelmäßig prügle.39 Mit ihren Geschwistern, so erzählt Marie Louise später, als sie schon Kaiserin ist, habe sie oft Krieg gegen Frankreich gespielt. Der feindliche Feldherr sei dann immer die Wachsfigur mit dem schwärzesten und hässlichsten Gesicht gewesen, mit Nadelstichen habe man sie gepeinigt, gesteht sie Napoleons Privatsekretär Méneval.40
Marie Louises Höllenangst wird durch ihre Stiefmutter noch verstärkt. Maria Ludovika, die zierliche, hochintelligente dritte Frau von Kaiser Franz, hat gute Gründe, Napoleon zu hassen. 1796 wurde ihre Familie vom damaligen General Bonaparte aus Mailand vertrieben, um dann in der Wiener Neustadt ein ganz und gar nicht standesgemäßes Leben führen zu müssen. Als Kaiserin behält sie ihr Ressentiment bei. 1809, als Franz’ damaliger Minister Graf von Stadion Österreich in den Krieg treibt, weil er glaubt, Napoleon sei durch den alles andere als glatt verlaufenden Feldzug in Spanien abgelenkt, unterstützt Maria Ludovika ihn leidenschaftlich. Am Anfang des Krieges ist sie voller Hoffnung. Sie jubelt bei der Nachricht, die österreichischen Waffen seien bei Eggmühl erfolgreich gewesen.15 Auch Marie Louise jubelt. Sie setzt sich an den Schreibtisch und lässt ihre Freundin an ihrer Genugtuung teilhaben: „Mit vielem Vergnügen haben wir vernommen, daß Kaiser Napoleon (in Eggmühl) selbst zugegen war, wenn er noch so eine Schlacht verliert, hoffe ich daß er den Kopf ganz verlieren wird. Die Leute hier machen schon sehr viel Prophezeiungen über sein Ende und unter andern will jemand aus der Apokalipse erklären daß er 1809 in Köln im Gasthofe beym rothen Krebs sterben wird, obwohl man keinen Glauben darauf setzen kann, so wünsche ich herzlich daß es wahr wird“.41 Der Jubel stellt sich übrigens als voreilig heraus. Es war Napoleon, der bei Eggmühl siegte.
Die kaiserliche Familie hat Wien bei Ausbruch des Krieges verlassen. Als der Krieg zu Ende ist, bleibt Marie Louise mit ihren Geschwistern und der Stiefmutter noch eine Weile im ungarischen Ofen. Maria Ludovika, die an Tbc leidet und sehr schwach ist, soll geschont werden. In Ofen ist man weit vom Schuss. Aber es gibt Zeitungen, und die aufregendste Neuigkeit, die man nach dem Jahreswechsel zu lesen bekommt, ist die von der Scheidung Napoleons. Auf wen mag der Blick des „Monsters“ fallen? Marie Louise ist unruhig. Die Stiefmutter drängt sie, an den Vater zu appellieren. Der Brief vom 5. Januar, an dem Maria Ludovika zweifellos mitgewirkt hat, ist der rührend-naive Versuch, Kaiser Franz durch ein wahrscheinlich ausgedachtes Liebesgeständnis wehrlos zu machen. „Der Gedanke“, schreibt sie, „daß es nicht in die Reihe der Unmöglichkeiten gehört, daß ich in der Zahl derjenigen seyn könnte, die man vielleicht zu seiner zukünftigen Gemahlin vorschlagen würde, bewog mich, Ihnen ein Geständnis zu machen, welches ich in Ihr väterliches Herz lege“.42 Sodann offenbart sie eine Neigung zu Erzherzog Franz von Modena-Este. Zufällig handelte es sich bei diesem um einen Bruder Maria Ludovikas. Wie nicht anders zu erwarten, bleibt das „väterliche Herz“ ungerührt. Denn natürlich durchschaut der Kaiser die Absicht. Einer Verlobung mit Franz von Este zuzustimmen, wäre nach Lage der Dinge ein Affront gegen Napoleon und würde Österreich schlecht bekommen. Der Kaiser lässt den Brief Marie Louises einfach unbeantwortet. Man kann sich die Verzweiflung der jungen Frau vorstellen. Der Vater stellt sich taub. Also ist an den Gerüchten doch etwas dran? Die Redereien hören nicht auf. Ihr Klavierlehrer vertraut ihr an, die Wahl Napoleons sei auf sie gefallen. Das habe er gehört. „Aber darin irrt er sich“, macht sich Marie Louise gegenüber Madame Colloredo, mit der sie in Briefkontakt steht, Mut. „Denn Napoleon hat zu große Angst vor einer Absage und zu große Lust, uns noch weiter Böses anzutun, um einen solchen Antrag zu stellen, und der Papa ist zu gut, um mir in einem so wichtigen Punkt Zwang anzutun.“ Die arme Prinzessin, die es treffen werde, tue ihr schon jetzt leid, fügt sie hinzu. „Denn ich bin sicher, daß ich es nicht sein werde, welche dieses Opfer der Politik sein wird“.43
Der Brief an die Colloredo ist nichts anderes als Pfeifen im Walde. In Wahrheit ist Marie Louise voller Angst und Vorahnung, dass ihr Vater sie im Stich gelassen haben könnte. Liebt er sie denn nicht? In seiner Art liebt Kaiser Franz seine Älteste wohl schon. Aber Vorrang hat nun einmal das politisch Nützliche. Nebenbei ist der Kaiser ein Feigling. Er weicht Marie Louise aus, und als er sich schließlich zu einem Gespräch bereitfindet, schiebt er die Verantwortung von sich. Metternich und Schwarzenberg hätten ihn vor vollendete Tatsachen gestellt, behauptet er. So schildert Marie Louise das Vater-Tochter-Gespräch viele Jahre später der eigenen Tochter, der Gräfin Albertine Sanvitale. Diese Schilderung ist vollkommen glaubwürdig. In seinen Memoiren bestätigt Metternich, ihn habe das Los getroffen, Marie Louise mit der Realität vertraut zu machen. Der Kaiser habe ihn vorgeschickt, erst dann habe er mit seiner Tochter gesprochen. Es lohnt sich, die entsprechende Passage aus Metternichs Memoiren zu zitieren, weil sie die tiefe Heuchelei des Vorgehens offenbart. Der Ausschnitt beginnt mit der Aufforderung des Kaisers an seinen Minister, der Erzherzogin den Spruch des Orakels mitzuteilen:
„,Suchen Sie die Erzherzogin auf und berichten Sie mir, was sie Ihnen sagen wird. Ich selbst will sie nicht von der Sache benachrichtigen, damit es nicht den Anschein gewinne, als wollte ich auf ihre Entschließung Einfluß nehmen.‘
Ich begab mich auf der Stelle zur Erzherzogin Marie Louise und legte ihr einfach den Fall vor, ohne Umschweife und Phrasen, weder für noch gegen den Vorschlag. Die Erzherzogin hörte mich mit ihrer gewohnten Ruhe an, und nach einem Augenblicke der Überlegung fragte sie mich: ‚Was will mein Vater?‘
,Der Kaiser‘, entgegnete ich, ‚hat mich beauftragt, Eure kaiserliche Hoheit zu befragen, was Sie in einem für das Schicksal Ihres Lebens so wichtigen Falle zu entscheiden gedenken. Fragen Sie nicht, was der Kaiser will, sagen Sie mir, was Sie wollen.‘
,Ich will nur, was zu wollen meine Pflicht ist‘, erwiderte die Erzherzogin. ‚Wo es sich um das Interesse des Reiches handelt, ist dies Interesse zu Rathe zu ziehen, und nicht mein Wille. Bitten Sie meinen Vater, seine Herrscherpflichten zu befragen und dieselben keinen an meine Person geknüpften Interessen unterzuordnen.‘“44
Sogar für Metternichs kritiklosesten Bewunderer muss dieses fromme Bildnis der Marie Louise selbdritt eine Zumutung sein: Hier der Kaiser, dem die Willensfreiheit der Tochter über alles geht, dort die gefasste, verantwortungsbewusste Prinzessin, dazwischen der Minister, der untertänigst aufschreibt, was die Prinzessin ihm nach innerer Prüfung diktiert. In Wirklichkeit war die Unterredung wohl ein tränenreiches Drama. An seine in Paris weilende Frau Eleonore schreibt Metternich: „Wenn ich jemals eine schwierige Unterhaltung zu führen hatte, so ist es wohl diese gewesen – aber Gott sei Dank ist sie voll gelungen, und ich glaube versichern zu können, daß sie nur mir allein gelungen wäre und dazu die gesamte Kraft meiner Haltung notwendig war“.
Mitgefühl für die bedauernswerte Erzherzogin, die eigentlich noch ein Mädchen ist, geben diese Zeilen nicht zu erkennen. Kühl erledigt Metternich seinen Auftrag, dessen besondere Schwierigkeit darin liegt, dass der Minister die Feigheit seines Souveräns decken muss. Für Franz und Metternich markiert die Heiratsangelegenheit die erste Bewährungsprobe der Zusammenarbeit. Metternich besteht sie summa cum laude und legt auf diese Weise den Grundstein für seine Dauerdominanz in der österreichischen Politik, die erst mit der Revolution von 1848 enden wird. Beide, der Kaiser und sein Minister, sind überzeugt von der Vorteilhaftigkeit der Heirat. Beschert sie Österreich auch nicht den ewigen Frieden, so wird sie doch wenigstens dafür sorgen, dass der nächste Eroberungszug des Franzosenkaisers einen Umweg um das schwer angeschlagene Habsburgerreich macht. So zu denken, ist nicht abwegig. Österreich muss, wie Schwarzenberg kurz und bündig formuliert, „zwischen dem Ruin der Monarchie und dem Unglück einer Prinzessin“ wählen.45 Das heißt, Österreich hat keine Wahl.
Und die Prinzessin? Hat sie eine Wahl? Sie stemmt sich nicht gegen den Strom, und am Ende würde es wohl auch zwecklos sein. Trotzdem ist auffällig, wie rasch nach dem ersten Erschrecken sie zu der Haltung findet, die man von ihr erwartet. Gewiss, es fließen Tränen. Aber Marie Louise rebelliert nicht. Sie macht keine Szene. Sie nimmt es hin, dass der „liebe Papa“ sich hinter Metternich versteckt, einem Mann, den sie kaum kennt. Hier kommt ein Wesenszug der Prinzessin und künftigen Kaiserin erstmalig zum Vorschein. Marie Louise ist fügsam, Auflehnung liegt nicht in ihrer Natur. Sie braucht immer eine starke Schulter. Die Autorität ist in diesem Fall der Vater. Bald wird es Napoleon sein.
Am 24. Februar macht die „Wiener Zeitung“ die Öffentlichkeit mit dem Eheverlöbnis bekannt. „Nach nun erloschenen Kämpfen“ sähen die Völker Europas in der Heirat „das Unterpfand des Friedens“ und „die Segnungen der Zukunft“, beteuert das Regierungsblatt. Den Lesern verschlägt es die Sprache. Steht die Welt auf dem Kopf? An der Börse purzeln die Kurse. Aller Augen richten sich auf Metternich. Die besser Informierten wissen, dass er ein Jahr vorher, damals noch Botschafter in Paris, zum Krieg gegen Napoleon geraten hat. Wie ist dieser abrupte Seitenwechsel möglich? Gelten Grundsätze nichts mehr? „Der Verrat ist eine Frage des Zeitpunkts.“ Das Bonmot stammt zwar von Talleyrand. Aber in puncto Geschmeidigkeit steht Metternich dem ehemaligen französischen Außenminister in nichts nach. Es mag seinerzeit ein Fehler gewesen sein, Napoleon die Stirn zu bieten. Umso wichtiger ist es, „nach nun erloschenen Kämpfen“ den Kurs neu zu justieren. Metternichs Problem besteht darin, dass die realpolitische Konsequenz, die er zieht, viele Zeitgenossen überfordert. Selbst für den Obrigkeitsstaat ist es keine Kleinigkeit, die antirevolutionäre Rhetorik zweier Jahrzehnte vergessen zu machen. War das Habsburgerreich nicht 1792 und dann immer wieder gegen Frankreich zu Felde gezogen, weil man die Mörder Marie-Antoinettes bestrafen wollte? Jetzt schickt man das Patenkind der Marie-Antoinette ins Bett jenes Mannes, der diese Mörder mit hohen Regierungsposten ausgestattet hat!
„Feu d’artifice à l’arc de Triomphe de l’Etoile“: Zu Ehren des Einzugs der neuen Kaiserin wurde 1810 ein Feuerwerk am Arc de Triomphe abgebrannt, der zu dieser Zeit allerdings nur als Provisorium aus bemalter Leinwand über einem Holzgerüst existierte (zeitgenössische Aquatinta).
Am größten ist die Empörung in Teilen des Hochadels und in gewissen Wiener Salons, die man die „russischen“ nennt. Eine Schmach ist dieser Heiratsplan, eine weitere für das unglückliche Österreich! Metternichs eigener Vater, der selbst Diplomat gewesen ist, versteht den Sohn nicht mehr. Friedrich von Gentz, Metternichs Vertrauter und beste Bürokraft, vergießt Tränen der Verzweiflung. Wer Metternich nicht offen zu kritisieren wagt – damit würde man ja den Kaiser kritisieren –, zündet Kerzen für die „arme Prinzessin“ an. Man opfere dem Minotaurus eine schöne Färse, lässt sich der alte Fürst von Ligne vernehmen. Lady Castlereagh, die Frau des britischen Geschäftsträgers, findet das Bild so treffend, dass sie es gleich weitertransportiert: „Man mußte dem Dinosaurus eine österreichische Jungfrau opfern, um ihn zu sättigen“.46 Maria Karolina, Königin von Sizilien, die nie aus ihrem Herzen eine Mördergrube macht, bekreuzigt sich, als sie erfährt, dass sie nunmehr über ihre Enkelin in ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Mann treten werde, der ihr Neapel geraubt hat: „Das hat mir gerade noch gefehlt, daß ich jetzt auch noch des Teufels Großmutter werde“.47 In Prag, wo zahlreiche Gegner Napoleons aus ganz Europa Zuflucht gefunden haben, will man die Nachricht zuerst nicht glauben. „Der plötzliche Ausbruch eines ungeahnten Vulkans hätte nicht wunderbarer überraschen können, aller Sinn war betäubt, alle bisherigen Vorstellungen lagen umgestürzt, die verwirrten Begriffe rangen nach neuer Fassung und Folge … Noch gab es die Wunden von Wagram und Znaym, die nicht völlig geheilt waren, es schien jetzt ein Spott, dort geblutet zu haben“, berichtet Varnhagen von Ense in seinen „Denkwürdigkeiten“.48
Das Volk nimmt die Sache lockerer. Normalerweise schert sich Metternich wenig um das, was die kleinen Leute denken. In diesem Fall verschafft ihm die vox populi Luft. Die Wiener zerbrechen sich nicht lange den Kopf über die Wechselfälle der hohen Politik. Der Kaiser wird schon wissen, weshalb er seine Tochter dem Napoleon gibt. Ohnehin befindet man sich in Faschingslaune, die Hochzeit verspricht rauschende Feste, und ist die Politik nicht auch so etwas wie ein großer Maskenball? Der schwäbische Dichter Justinus Kerner findet den Leichtsinn des Volkes verächtlich: „Die Wiener sind toll wegen der Heirat; Napoleon ist nun ein Gott. Man betet für ihn in den Kirchen; die Besiegung ist Gewinn; sie betrachten jetzt mit Entzücken die Ruinen von Wien (nach dem Frieden von Schönbrunn musste der innere Wall der Hauptstadt geschleift werden, G.M.), die zerriebenen Steine der Festungswerke streuen die Kaufleute zum süßen Angedenken an den göttlichen Mann in ihre Zimmer als Bodensand“.49 Auch die Börsenkurse steigen wieder. Metternich kann hoffen, mit seinem riskanten Manöver zu reüssieren.
Auch in Frankreich gehen die Meinungen auseinander. Napoleons Trennung von Joséphine ist erwartungsgemäß nicht besonders gut angekommen. Fouchés Polizeiberichte bezeugen das. Allerdings war Fouché gegen die Österreich-Lösung, und bei ihm weiß man nie, ob seine Berichte gefälscht sind. Groß ist die Bestürzung in den Adelspalästen des Faubourg Saint-Germain. Niemals hätte der Habsburger Ja sagen dürfen zu dieser Heirat, in der man doch nichts anderes sehen kann als eine Kapitulation vor der Revolution. Der älteste Bruder Ludwig XVI., der im englischen Exil lebt, gesteht, bei der furchtbaren Nachricht sei sein „Blut erstarrt“.50 Wie soll jemals sein Traum, König von Frankreich zu werden, in Erfüllung gehen, wenn die monarchischen Vettern so grundsatzlos handeln? Joseph de Maistre, ein kompromissloser und brillanter Verteidiger der bourbonischen Sache, klagt, man werde Napoleon künftig nicht mehr als Parvenü abtun dürfen, sondern ihn „wie die anderen Souveräne behandeln“ müssen. Der Legitimismus habe eine Schlacht verloren. Zugleich zollt de Maistre, wenn auch widerwillig, Napoleon Respekt. Vor diesem „Zauberer“ („l’homme miraculeux“) verblasse selbst Cäsars Glück.51
A1 Major Schill wie auch der Herzog von Braunschweig versuchten 1809, mit Freikorpsaktionen in Deutschland eine Volkserhebung gegen die Franzosen zu entfesseln. Beide scheiterten, beide wurden posthum zu Volkshelden.
A2 Der Putsch des 18./19. Brumaire stürzte das regierende Direktorium. Napoleon wurde zu einem von drei Konsuln der Republik.
A3 Der große Revolutionshistoriker Michelet schätzte sie auf 1 Million (Bd. I, 234); neuere Schätzungen sprechen sogar von 10 Millionen, vgl. Waresquiel, 250. Frankreich hatte zu dieser Zeit etwa 30 Millionen Einwohner.
A4 Napoleon landete nach einem abenteuerlichen Slalom durch das Mittelmeer, immer auf der Flucht vor den Schiffen des britischen Admirals Nelson, am 9. Oktober bei Fréjus in Südfrankreich. In Wahrheit war die Ägypten-Expedition ein Schlag ins Wasser. Aber es gelang Napoleon, diese Tatsache zu überdecken. Als die von ihm zurückgelassene Armee 1801 kapitulierte, war die französische Öffentlichkeit schon mit anderen Dingen beschäftigt.
A5 Das Zitat stammt vom Abbé Sieyès. Er gehörte zu den geistigen Wegbereitern der Revolution. Während der Terrorherrschaft tauchte er unter, um beim Brumaire-Putsch wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Der Theoretiker hatte sich in der Zwischenzeit zum Anhänger eines starken Staates gewandelt.
A6 Maria Walewska 1786–1817. Die Beziehung mit der reizvollen polnischen Gräfin war keiner der zahlreichen flüchtigen Seitensprünge Napoleons, die meist das Morgengrauen nicht überdauerten. 1809 gebar ihm die Gräfin einen Sohn. Als Napoleon als Verbannter isoliert auf Elba lebte, besuchte sie ihn heimlich. Auch auf Sankt-Helena wollte sie ihn besuchen. Dazu kam es nicht mehr. Maria Walewska starb 1817 mit 31 Jahren.
A7 Charles Léon Denuelle 1806–1881. Léon entwickelt sich zu einem Taugenichts. Er ist arbeitsscheu und lebt über seine Verhältnisse.
A8 Marie Josephe Rose de Tascher de la Margerie wurde auf Martinique geboren, und zwar wahrscheinlich 1763. Sie selbst gab 1768 als ihr Geburtsjahr an. Ihr erster Ehemann, der General Beauharnais, wurde im Großen Terror hingerichtet. Joséphine, die eine Zeitlang im Gefängnis festgehalten wurde, kam vermutlich nur durch den Sturz Robespierres im Thermidor mit dem Leben davon. Nach dem Thermidor bewegte sich die attraktive und lebenslustige Joséphine in den politisch und gesellschaftlich einflussreichsten Kreisen von Paris. Als Napoleon sie kennenlernte, hatte sie gerade eine Affäre mit Paul de Barras hinter sich, dem starken Mann des Direktoriums.
A9 Am 4. Mai 1810 kommt der Sohn Alexandre zur Welt. Alexandre Colonna-Walewski (1810 bis 1869) wird es unter seinem Cousin Napoleon III. zum Außenminister Frankreichs bringen.
A10 Hortense nennt in ihren Erinnerungen Fouché einen der energischsten Anhänger der Scheidung, spekuliert aber nicht über seine Motive; Beauharnais, Bd. 2, 13.
A11 Fouché wurde vom Konvent in das aufständische Lyon geschickt. Nach der Niederschlagung des Aufstands veranlasste er ein Rachegemetzel, das selbst in Jakobinerkreisen als maßlos wahrgenommen wurde.
A12 Bausset merkt in seinen Memoiren augenzwinkernd an, Joséphine habe gut geschauspielert. Beim Heraustragen habe sie ihm zugeflüstert: „Sie drücken mich zu fest!“; Helfert, 394.
A13 1806, nach Gründung des Rheinbundes, wurde das Heilige Römische Reich deutscher Nation aufgelöst. Im Vorgriff hatte sich Franz – bis dahin Franz II. – als Franz I. zum Kaiser von Österreich erklärt.
A14 Die Bezeichnung stammt aus dem spanischen Hofzeremoniell. „Aja“ ist so viel wie Erzieherin, Gouvernante.
A15 Die Schlacht von Eggmühl bei Regensburg fand am 22. April 1809 statt.