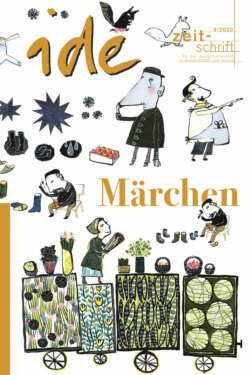Читать книгу Märchen - Группа авторов - Страница 11
Viktoria Walter Das Kunstmärchen um 1800 Beispiele, Ausprägungen, Entwicklungstendenzen
ОглавлениеDer Aufsatz vertritt die These, dass die »Kunstmärchen« im Gefolge Ludwig Tiecks ein Produktder Frühromantik sind. Auf Abgrenzungsmerkmale hinsichtlich der Grimm’schen Sammlung von »Volksmärchen« wird ebenso eingegangen wie auch auf erste Beispiele im Ausgang der Spätaufklärung. Im Zentrum der Analyse stehen vier prominente Texte, die unterschiedlichen Gattungen entstammen: Tiecks »Novellenmärchen« Der blonde Eckbert, das sogenannte »Kindermärchen« Der gestiefelte Kater, das mit dem Untertitel versehene »Ammenmärchen« Ritter Blaubart sowie de la Motte Fouqués bekanntes Märchen Undine. Als wesentliches Merkmal von »Kunstmärchen« lassen sie neben der allegorischen Motivbildung wesentliche romantische Gestaltungsprinzipien wie perspektivische Rahmung, die Subversion von faktualem und fiktionalem Erzählen und – ganz wichtig – ironische Stilisierung erkennen. Das abschließende Beispiel vom »Antimärchen« in Büchners Woyzeck zeigt, dass die Subgattung mit der Hochromantik zwar ihren Zenit erreicht, aber noch nicht ausgedient hat.
______________________________
1797 war nicht nur Goethes und Schillers »Balladenjahr«, sondern auch das »Märchenjahr« der Frühromantik. Neben Goethes Zauberlehrling und Schillers Der Taucher sowie Der Handschuh werden im selben Zeitraum das »Kindermärchen« Der gestiefelte Kater, das »Ammenmärchen« Ritter Blaubart und das »Novellenmärchen« Der blonde Eckbert verfasst. So können die Kunstmärchen in ihrer deutschsprachigen Ausprägung als eine Erfindung der Frühromantik betrachtet werden, allen voran des Dichters Ludwig Tieck. Zwar hatte Goethe mit Schiller bereits 1795 im Rahmen des gemeinsamen »Horen«-Projekts über die Integration seines Märchens in die »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« verhandelt. Auch nimmt das Kunstmärchen als »eine Gattung von Märchenerzählungen« nach heutigem Forschungsstand – trotz aller definitorischen Abgrenzungsprobleme, wie u. a. Mathias Mayer und Jens Tismar (Mayer/Tismar 2003, S. 1) befinden1 – streng genommen bereits in der Spätaufklärung seinen Anfang, als Christoph Martin Wieland die europäische Tradition der contes de fées (Feenmärchen) in Don Sylvio (1764) adaptierte – ein Roman, der in seiner Anlage »offen das Muster »Don Quijote« nach[ahmte]« (ebd., S. 35): »Schwärmerei als fehlender Wirklichkeitssinn wird exemplifiziert an der unvernünftigen Weltansicht des Helden, insofern er literarische Fiktionen schlicht für wahr hält.« (Ebd.)2 Im Deutschen Wörterbuch der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm wird das Märchen denn auch als eine »fabula«, eine »kleine Erzählung« bezeichnet, die »im gegensatz zur wahren geschichte« stehe und als bloße »kunde, nachricht, die der genauen beglaubigung entbehrt, ein bloszes weiter getragenes gerücht« (DWB, Bd. 12, Sp. 1619) angenommen werden könne. Trotz der darin anklingenden Abwertung sollte jenes »Wunderbare«, das sich in der schillernden Wirklichkeit der Fiktion als etwas »Sagenhaftes« ereignete, gerade das imaginäre Potential einer Literatur steigern, die sich mit dem romantischen Kunstideal wesentlich vorwagte in eine durch Ironie und Witz gebrochene, sich selbst reflektierende Poesie.
In diesem Beitrag möchte ich ein paar der markantesten Kunstmärchen um 1800 in ihrer Anlage und Ausformung einander gegenüberstellen. Eine Analyse der die Subgattung prägenden Konventionen muss sich dabei grundlegend von jener der Volksmärchen unterscheiden, insofern die Kunstmärchen als originelle, »individuelle Erfindung eines bestimmten, namentlich bekannten Autors« (Hasselblatt 1956, S. 134 f.) schriftlich fixiert und veröffentlicht wurden, bevor sie weitere Verbreitung fanden. In der neueren Märchenforschung wird denn auch vor einer »Fixierung auf die Volksmärchentradition« (Zeller 1993, S. 56) gewarnt.3 Manfred Grätz kritisierte schon in den 1980er Jahren, dass gemeinhin die »Angaben über die mündliche Vermittlung der Erzählungen so spärlich und zugleich so klischeehaft« seien, »daß sie nur mit größter Vorsicht übernommen werden sollten« (Grätz 1988, S. 29). Dennoch gestaltet sich der Versuch einer kontrastiven Abgrenzung von den Volksmärchen auch deshalb als schwierig, da die Kunstmärchen nicht zuletzt aus einem ähnlichen Fundus an Topoi und Stoffen schöpften – bzw. sich ihrer Motive bedienten. Insofern wird die Grimm’sche Märchen-Definition im Deutschen Wörterbuch sinnvollerweise um jene der Volksmärchen ergänzt, die in Anlehnung an Joachim Heinrich Campes Wörterbuch der deutschen Sprache gefasst wurden als »1) »ein mährchen fürs volk, für die menge zur unterhaltung und auch wohl zur belehrung«« und »2) »mährchen, welche einem volke eigenthümlich sind, welche unter demselben erzählt werden«« (DWB, Bd. 26, Sp. 492).