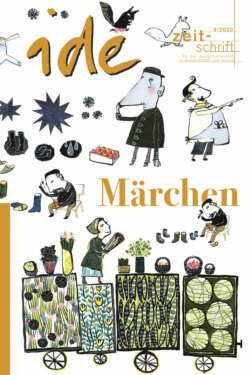Читать книгу Märchen - Группа авторов - Страница 14
1.2 Der gestiefelte Kater (Ludwig Tieck, 1797)
ОглавлениеIn Der gestiefelte Kater spielt die Gattung mit ihrer eigenen Erscheinungsform, indem sie als dramatischer Stoff inszeniert wird, der die Möglichkeiten seiner Produktion und Rezeption bereits im Prolog reflektiert. So treffen im Publikum Zuschauer aus sowohl handwerklichen als auch bildungsbürgerlichen Kreisen zusammen und tauschen sich neugierig über das zu erwartende Schauspiel aus:
Fischer: […] Herr Müller, was sagen Sie zu dem heutigen Stücke?
Müller: […] Ein wunderlicher Titel ist es: »der gestiefelte Kater«. – Ich hoffe doch nimmermehr, dass man die Kinderpossen wird aufs Theater bringen.
Schlosser: Ist es denn eine Oper?
Fischer: Nichts weniger, auf dem Komödienzettel steht: »ein Kindermärchen«. (Tieck 2019, S. 5)
Tatsächlich gelangt mit dem Gestiefelten Kater ein humoriges Schauspiel zur Aufführung, das jedoch entgegen den Konventionen keinerlei Identifikation mit dem Inhalt oder dem Protagonisten zulässt, sondern auf ironisierende Weise ein Panorama der literarischen Topoi entwickelt, die das Märchen gemeinhin prägen: Ein schrulliger, alternder König, der seine Tochter zu verheiraten gedenkt, gehört ebenso dazu wie ein exotischer Prinz, ein Hofgelehrter und Hofnarr sowie der arme Bauernsohn namens Gottlieb, der einen sprechenden Kater erbt. Dieser soll ihm zum Glück verhelfen und erbittet sich darum jene Stiefel, die ihn bei seiner abenteuerlichen Reise begleiten – diese sind im Übrigen nichts anderes als der allumspannende Katalysator einer Nicht-Handlung von gebrochenen Szenen, in die Kater Hinze, »das Publikum« sowie die LeserInnen geworfen werden. Allein, das Publikum wie die autofiktionale Figur des Dichters stellen dabei selbst weite Teile des Dramentextes und sind in ihm ständig präsent; auf diese Weise wird die vierte Wand bereits hier, innerhalb der Frühromantik und vor aller moderner Dramaturgie à la Brecht, durchbrochen. In seinem Nachwort zur Textausgabe hat Helmut Kreuzer daher zutreffend formuliert, das Theaterstück sei als »eine zu seiner Zeit hochaktuelle Satire« konzipiert, deren »einziger Inhalt ein missglückter Theaterabend ist, der halb scheiternde Versuch einer fiktiven Theatertruppe, das Märchenstück eines fiktiven Autors vor einem fiktiven Publikum aufzuführen« (Kreuzer 2019, S. 75). Das Scheitern des Dichters, die Erwartungen von Zuschauern und Kritikern zu erfüllen, wird denn auch als grundsätzliches Problem und Vorbedingung der dramatischen Gattung veranschaulicht. Illustriert werden diese Realitätseffekte u. a. wiederholt in der Person des Fischers, der bereits mit der Sprachfertigkeit des Katers hadert und einfach nicht in das Stück hineinfinden will:
Die Kunstrichter (im Parterre): Der Kater spricht? – Was ist denn das?
Fischer: Unmöglich kann ich da in eine vernünftige Illusion hineinkommen. (Tieck 2019, S. 11)
Dabei lässt sich der sprechende Kater (mehr noch als die Figur des Dichters) als ironische Metapher für den vermeintlich schöpferischen Prozess von Literatur verstehen. So gerät der Broterwerb zu einer eigentlichen Odyssee, in der Kater Hinze mal in die Szene zweier Liebenden geworfen wird, die sich schwülstig ewige Treue schwören, mal am königlichen Gastmahl teilhat, nachdem er ein Kaninchen gefangen hat und schließlich doch noch alle Umstände – die Reise des Königs mit seiner Tochter, das Auftreten Gottliebs als »Graf von Carabas« und die Entthronung des mächtigen »Popanz« – so einzurichten weiß, dass Gottlieb den tyrannischen Herrscher ablösen kann und die Prinzessin zur Braut zugesprochen bekommt. Dass das Publikum dabei zeittypische, in den Theaterkritiken bezeugte Reaktionsmuster spiegelt, zeigt sich am Ende sowohl an der Rolle »Böttichers«, der als Karikatur auf den Weimarer Literaten Böttiger verfasst ist (Kreuzer 2019, S. 80), ebenso wie am Schlosser, der die Zensur wittert. Deshalb will er um keinen Preis an der lautstarken Zustimmung des Publikums teilhaben:
Schlosser: Doch also ein Revolutionsstück? – So sollte man doch um des Himmels willen nicht pochen. (Das Pochen dauert fort, Wiesener und manche andre klatschen, Hinze verkriecht sich in einen Winkel und geht endlich gar ab. – Der Dichter zankt sich hinter der Szene und tritt dann hervor.) (Tieck 2019, S.58)
Dass das Illusionstheater gar nicht gelingen will und auch nicht soll, ist in der Textstruktur angelegt: Diese setzt vielfach auf Distanzierung durch die subversive Reflexion des literarischen Mediums. Derlei Passagen lassen sich im Drama viele finden. Sie betreffen aber auch die Konventionen des Märchens selbst, insbesondere dessen Integration des »Wunderbaren« und – wie Zeller festgehalten hat, die »ständige[] Konfrontation von realer und wunderbarer Welt« (Zeller 1993, S. 72). Beispielsweise bezweifelt Gottlieb im Dritten Akt, dass sich sein Glück noch rechtzeitig vor dem Ende der Komödie einstellen werde (»Bald, sehr bald muss es kommen, sonst ist es zu spät, es ist schon halb acht und um acht ist die Komödie aus«; Tieck 2019, S.45). Auch fällt er aus der Rolle, wenn er den »verdammte[n] Souffleur« kritisiert, dieser spreche »so undeutlich, und wenn man dann manchmal extemporieren will, geht’s immer schief« (ebd.).
Dass der »wunderbare« Gehalt schließlich von Kater Hinze selbst bekräftigt und veranschaulicht werden muss, rückt die Gattung selbst in den Fokus, wenn er die gelaufene Strecke als unwahrscheinliche zu bedenken gibt:
Hinze: Wer etwas Wunderbares hören will, der höre mir jetzt zu. – Wie ich gelaufen bin! – Erstlich von dem königlichen Palast zu Gottlieb, zweitens mit Gottlieb nach dem Palast des Popanzes, wo ich ihn gelassen habe, drittens von da wieder zum König, viertens lauf ich nun vor dem Wagen des Königs wie ein Laufer her und zeige ihm den Weg. (Tieck 2019, S. 51)
Noch ein anderer Aspekt des unterschätzten »Kindermärchens« rückt mit dem ständigen Standortwechsel von intradiegetischer zu extra- bzw. metadiegetischer Handlung – sofern man die Ironie und Selbstreferentialität als weitere Rahmung begreift – in den Blick: das Nichtvorhandensein einer stringenten Positionierung Tiecks. »[D]ass Tieck keinen festen Standort im Stück bezieht, sondern ihn von Punkt zu Punkt wechselt, punktuell den ›Dichter‹ oder das ›Publikum‹ (oder Hanswurst, König usw.) für sich sprechen« lasse, wurde Kreuzer zufolge von der Forschun g zeitweise gar zum »Vorwurf der politischen ›Affirmation‹ zugespitzt« (Kreuzer 2019, S. 85). Tieck erschien in dieser Deutung als einer der von ihm selbst parodierten Zuschauer, der in der kleingeistigen Idylle seiner bürgerlichen Verhältnisse verharrt. Tatsächlich aber fördert die vielschichtige Anlage des Dramas die Erkenntnis zutage, dass dieses Kunstmärchen, gerade weil es im Modus der beständigen Selbst-Bezugnahme verfasst ist, höchst kritisch und auf unterhaltsame Weise seine Entstehungs- als auch Rezeptionsbedingungen stets mitreflektiert. Es muss LeserInnen und ZuschauerInnen der Gegenwart daher überraschend modern erscheinen.