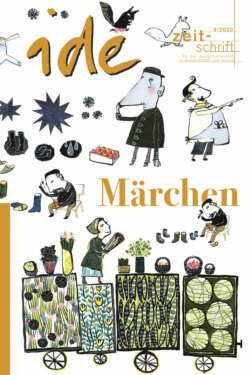Читать книгу Märchen - Группа авторов - Страница 17
2. Ausblick und Schluss: Gegentendenzen in Büchners »Antimärchen« (Woyzeck, 1837)
ОглавлениеDie Undine stand erst zu Beginn der Hochromantik, die mit den 1810er Jahren eingeleitet wurde. Die phantastische Erzähltradition beförderte nachhaltig insbesondere E.T.A. Hoffmann in seinen u.a. als Kunstmärchen konzipierten Erzählungen Der goldne Topf (1814)8, Der Sandmann (1816) und Klein Zaches genannt Zinnober (1819). Soweit man epochalen Modellen folgen will, stellt sich zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin eine spätromantische Phase ein, die auch die Subgattung des Kunstmärchens betrifft. Die Überformung, und das heißt eben auch: Konterkarierung des Märchenschemas, das bereits seinen Zenit überschritten hat, lässt sich besonders eindrücklich an Georg Büchners bekanntem »Antimärchen« im Woyzeck (1836) veranschaulichen. Zwar grenzt sich Büchners soziales Drama stark von der Romantik ab, es bleibt aber, wie Meagan Tripp betont, »der Struktur und der Sprache des Volksmärchens relativ treu« (Tripp 2010, S. 66). Im Dramenfragment steht das Antimärchen unmittelbar im Kontext von Woyzecks Mord an seiner Geliebten Marie. Die Großmutter erzählt es den Kindern, in Anwesenheit Maries und wohl auch deren gemeinsamen Kindes mit Woyzeck:
Grossmutter: »[…] Es war einmal ein arm Kind und hatt kein Vater und keine Mutter, war alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehen, und der Mond guckt’ es so freundlich an; und wie es endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz. Und da ist es zur Sonn gegangen, und wie es zur Sonn kam, war’s ein verwelkt Sonneblum. Und wie’s zu den Sternen kam, waren’s kleine goldne Mücken, die waren angesteck, wie der Neuntöter sie auf die Schlehe steckt. Und wie’s wieder auf die Erde wollt’, war die Erde ein umgstürzter Hafen. Und es war ganz allein, und da hat sich’s hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und is ganz allein. (Büchner 2006, S. 23)
Trotz der Eingangsformel »Es war einmal…« und bekannten Narrativen, die nicht zuletzt dem Märchen Die Sterntaler entnommen sind, bricht Büchners Antimärchen vor allem inhaltlich mit den Konventionen des Volksmärchens. Verglichen mit der intertextuellen Parallele und entgegen der eingeübten Rezeptionshaltung, sieht das »arm Kind« keiner Verbesserung, keiner glücklichen Fügung entgegen. Dabei strahlt die Erzählung auf das Drama aus: Wie das Kind im verzerrten Märchen der Großmutter, steht dem gemeinsamen Kind von Woyzeck und Marie ein Waisenschicksal bevor. Der Kontrast zwischen den aufgerufenen romantischen Topoi – Himmel, Mond, Sonne – und der ausweglosen Situation des Kindes lässt zudem die Prekarität einer sozialen Klasse hindurchscheinen, die keine ernsthaften Absichten auf den gesellschaftlichen Aufstieg hegen darf. Tripp hat es daher als »das Märchen der Moderne« bezeichnet: »ein verzerrtes Märchen, in dem das Subjekt entfremdet und ohne jene Zuflucht außer dem Tod ist« (Tripp 2010, S. 73). Es lässt sich in diesem Sinne als Endpunkt einer Entwicklung verstehen, die mit den aufwändig disponierten, selbstreferentiellen Kunstmärchen Ludwig Tiecks begonnen hatte, durch viele seiner Schriftstellerkollegen – unter ihnen Goethe (Märchen, Der neue Paris, Die neue Melusine), de la Motte Fouqué und Novalis – aufgegriffen und befördert worden war. Als poetische Form kam das Kunstmärchen der Realisierung des romantischen Programms einer »progressiven Universalpoesie« wohl am nächsten, deren »Bestimmung« Friedrich Schlegel darin sah, »alle getrennte[n] Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen«:
Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren, und die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfaßt alles, was nur poetisch ist, vom größten wieder mehre Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosen Gesang. (Schlegel 1988, S.114)