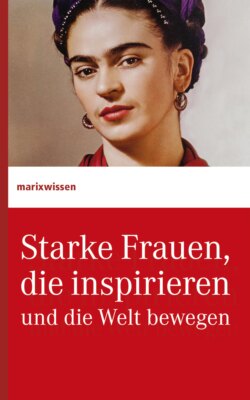Читать книгу Starke Frauen, die inspirieren und die Welt bewegen - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMARIA I. TUDOR, DIE KATHOLISCHE ODER DIE BLUTIGE
* 1516 in Greenwich
† 1558 in London
Königin von England und Irland 1553–1558
Das geschichtliche Nachleben der Tudorkönigin Maria steht ganz im Schatten der von ihr mit harten Mitteln betriebenen Rekatholisierung, obwohl derartige Aktionen im 16. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches darstellten. Das Scheitern ihrer Politik trug zu ihrem negativen Image bei, da die Historie üblicherweise mit Siegern gnädiger verfährt.
Die am 18. Februar 1516 geborene Maria war das einzige überlebende Kind des englischen Königs Heinrich VIII. und seiner ersten Gemahlin Katharina von Aragón. Maria war noch ein Kleinkind, als ihr Vater bereits erste heiratspolitische Erwägungen zu treffen begann. Letztendlich wurde aus keinem der prestigeträchtigen Heiratsprojekte etwas. Unter der Aufsicht ihrer Mutter bekam sie eine gute Ausbildung. Neben dem Unterricht in Sprachen, Religion, Musik und weiblichen Handarbeiten erhielt sie auch eine Einweisung in Geographie, Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaften.
1533 brach über Maria eine wahre Katastrophe herein, als ihr Vater, der unbedingt einen männlichen Erben haben wollte, seine erste Ehe für ungültig erklären ließ und Anna Boleyn heiratete. Die Prinzessin wurde zum königlichen Bastard gestempelt und von der Thronfolge ausgeschlossen. Da sich Königin Katharina hartnäckig geweigert hatte, der Annullierung ihrer Ehe zuzustimmen, wurden Mutter und Tochter voneinander getrennt und konnten sich bloß heimlich Briefe schreiben. Selbst an der Beerdigung ihrer Mutter 1536 durfte Maria nicht teilnehmen. Durch die Aufhebung der ersten Ehe Heinrichs VIII. kam es zum Bruch mit dem Papst und zur Entstehung der anglikanischen Staatskirche.
Wegen ihrer Weigerung, den Suprematseid auf die Oberhoheit des Königs über die Kirche zu leisten und sich selbst als illegitim anzuerkennen, fiel Maria in Ungnade. Sie wurde zur Ehrendame ihrer jüngeren Halbschwester Elisabeth degradiert. Diese Erniedrigung vergaß sie zeitlebens nicht, obwohl ihr die schlechte Behandlung Sympathien in der Bevölkerung und bei Teilen des Adels einbrachte, die in ihr weiterhin die einzig legitime Thronfolgerin sahen. Letztendlich konnte sich Maria nur durch ihre Unterwerfung unter den königlichen Willen der Todesstrafe entziehen, die ihr bei weiterem Widerstand als Hochverräterin drohte. Im Juni 1536 unterzeichnete sie unter großen Gewissensqualen das Schriftstück, mit dem sie die von ihrem Vater geforderten Bedingungen akzeptierte. Maria, die bisher immer betont hatte, dem König »in allem zu gehorchen, das Gewissen ausgenommen«, kapitulierte vor den realen Machtverhältnissen. Die tiefgläubige Katholikin verzieh sich diesen Verrat nie. Nachdem sie sich gebeugt hatte, wurde sie von ihrem Vater wieder empfangen und erhielt erneut einen eigenen Hofstaat. Vor allem der sechsten und letzten Ehefrau von Heinrich VIII., Katharina Parr, gelang es, das Vater-Tochter-Verhältnis zu normalisieren. Im Februar 1544 wurde Maria von Heinrich VIII. wie ihre Halbschwester Elisabeth per Parlamentsakte wieder in die Thronfolge aufgenommen.
Mit der Nachfolge ihres jungen Halbbruders Eduard VI. im Januar 1547 war Maria widerspruchslos einverstanden. Von ihrem Vater mit einer reichen Erbschaft versehen, zog sie es vor, den von Protestanten beherrschten Königshof zu meiden. Nach Eduards frühem Tod im Juli 1553 brachte sie sich vor dem Lordprotektor John Dudley, Herzog von Northumberland, der ihre protestantische Cousine Jane Grey staatsstreichartig zur Nachfolgerin auf dem Thron proklamieren ließ, vorsorglich nach Norfolk in Sicherheit. Innerhalb kürzester Zeit setzte sich Maria als die nach dem letzten Willen Heinrichs VIII. einzig rechtmäßige Thronerbin mit Waffengewalt durch. Jane Grey wurde gefangen gesetzt und schließlich 1554 hingerichtet. Am 1. Oktober 1553 wurde Maria in der Westminster Abtei zur ersten Königin Englands aus eigenem Recht gekrönt.
Um eine mögliche protestantische Nachfolge durch ihre Halbschwester Elisabeth zu verhindern, suchte Königin Maria für sich einen geeigneten katholischen Ehemann. Die Frage ihrer Heirat sorgte für Unruhe, da man in England befürchtete, dass ein fremder Fürst als königlicher Gemahl die englische Politik im ausländischen Sinn beeinflussen könnte. Maria war jedoch nicht bereit, einen Untertan zu heiraten, weshalb für sie eine Ehe mit einem englischen Adeligen nicht infrage kam. Obwohl sie sich mit ihrer Entscheidung für den spanischen Kronprinzen Philipp in den Bahnen der traditionellen, auf eine Annäherung an Spanien gegen Frankreich gerichteten Tudorpolitik bewegte, stieß dies bei ihren Untertanen und der politischen Elite auf außerordentliches Missfallen. Die Besorgnis, in die regelmäßigen Konflikte zwischen Spanien und Frankreich verwickelt zu werden, war groß. Die Einsprüche des Parlaments schmetterte Maria mit dem Hinweis ab, dass »das Parlament üblicherweise keine solche Sprache gegenüber den Königen von England gebrauche«. Im Sommer 1557 wurde England dann wirklich in den Krieg Spaniens gegen Frankreich hineingezogen. Trotz einiger Siege über die Franzosen kostete dies das Königreich nicht nur finanzielle und menschliche Opfer, sondern es verlor mit der Stadt Calais 1558 auch noch seinen letzten Stützpunkt auf dem europäischen Festland, was als nationale Katastrophe empfunden wurde.
Am 25. Juli 1554 fand Marias Hochzeit mit dem elf Jahre jüngeren Philipp statt, in den sie sich auf der Stelle verliebt hatte. Zwar erhielt der Habsburger den Titel eines Königs von England, seine tatsächliche Position entsprach aber nur der eines Prinzgemahls, da sich Maria entgegen anders lautender Befürchtungen von Philipp die Macht nicht aus der Hand nehmen ließ. Ihre Ehe entwickelte sich für sie zu einer Enttäuschung, weil ihr Philipp distanziert gegenüberstand. Er fand die Königin alt und wenig attraktiv. Zu ihrem Kummer hielt er sich vergleichsweise selten in England auf. Die heiß ersehnte Schwangerschaft stellte sich nicht ein.
Die Wiedereinführung des Katholizismus als Staatsreligion betrachtete Maria als Hauptaufgabe ihrer Herrschaft, wobei sie zunächst die Protestanten tolerierte. Das Parlament zeigte sich nicht bereit, die Wiederherstellung der päpstlichen Autorität und die Rückgabe der einstigen Kirchenländereien zu akzeptieren, von deren Erwerb einst viele Engländer profitiert hatten. Nachdem England die päpstliche Absolution erhalten hatte, begann 1555 die Ketzerverfolgung. Fast dreihundert Protestanten verbrannten auf den Scheiterhaufen. Königin Maria brachte dies später die Beinamen »die Katholische« bzw. »die Blutige« ein. Während in England die Rückkehr zum Katholizismus nur schleppend voranging, machte die Rekatholisierung in Irland bessere Fortschritte. Unter Elisabeth I. wurde die anglikanische Staatskirche wiederhergestellt. Auf wirtschaftspolitischem Gebiet griff Elisabeth dagegen die von Maria begonnenen Reformen und Maßnahmen zur Sanierung des Staatshaushalts und zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise auf und führte sie fort.
Erst am 6. November 1558 hatte die todkranke Maria ihre Halbschwester Elisabeth zu ihrer Erbin bestimmt, bevor sie am 17. November wohl an einer Tumorerkrankung verstarb. Ihr abwesender Ehemann König Philipp II. von Spanien bemerkte lediglich, dass er um ihren Tod »angemessenen Schmerz« empfunden habe.
Barbara Beck