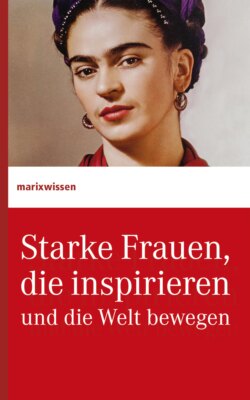Читать книгу Starke Frauen, die inspirieren und die Welt bewegen - Группа авторов - Страница 15
ОглавлениеMARIA SIBYLLA MERIAN
* 1647 in Frankfurt am Main
† 1717 in Amsterdam
Entomologin und Künstlerin
Die »Merian«, die zu den Pionierinnen der exakten Naturwissenschaften gehört, lebte in einem Umfeld, das der Förderung ihrer Talente besonders entgegenkam. Abstammend von der jüngeren Frankfurter Linie der Basler Merians, die alle als Künstler und Kunsthändler tätig waren, war sie von klein auf mit allen künstlerischen Belangen vertraut. Schon durch die weit verzweigte Verwandtschaft und den Handel mit Kupferstichen und Aquarellen wurde ihr eine gewisse Weltläufigkeit in die Wiege gelegt. Ihr Vater Matthäus Merian der Ältere starb früh, ihre Mutter Johanna Catharina Sibylla Heim vermählte sich ein zweites Mal mit Jacob Marrel, einem Schüler des Stilllebenmalers Georg Flegel. Matthäus Merian war als Verleger und Kupferstecher in ganz Europa bekannt, er gab das »Theatrum Europaeum« heraus und sehr beliebte topographische Ansichten aus ganz Europa. Sein Verlagshaus wurde von zwei Söhnen aus seiner ersten Ehe weitergeführt.
Maria Sibylla Merians Stiefvater Marrel arbeitete in einem Frankfurter Atelier, betrieb aber gleichzeitig einen Kunsthandel in Utrecht, was zu häufiger Abwesenheit führte. Bei Maria Sibylla war schon als kleines Kind ihr Talent zu bemerken, doch die Mutter, die eher kleinbürgerlich und allem Artistischen völlig abgeneigt war, verhinderte eine künstlerische Ausbildung. Heimlich kopierte das Mädchen Kunstblätter und eignete sich so Basiskenntnisse an. Ihr Stiefvater, der Maria Sibyllas Talent entdeckte, förderte ihre künstlerische Ausbildung. Wegen seiner häufigen Abwesenheiten beauftragte er seinen Schüler, Abraham Mignon, ihr Unterricht zu geben. Schon mit elf Jahren konnte das Mädchen Kupferstiche von bester Qualität herstellen. Es waren vor allem Blumenbilder nach dem Vorbild der Utrechter Malerschule, denen sie aber eigenständig Details hinzufügte, nämlich kleine Insekten und Schmetterlinge.
Ihr naturwissenschaftliches Interesse zeigte sich ebenfalls früh. Sie züchtete Seidenraupen, eine durchaus akzeptierte, weil wirtschaftlich ertragreiche Tätigkeit. Mit der Zeit konzentrierte sie sich auch auf andere Raupen und beobachtete deren Entwicklungsphasen. »Ich habe mich von Jugend an mit der Erforschung der Insekten beschäftigt. Zunächst begann ich mit Seidenraupen in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Danach stellte ich fest, dass sich aus anderen Raupenarten viel schönere Tag- und Eulenfalter entwickelten als aus Seidenraupen. Das veranlasste mich, alle Raupenarten zu sammeln, die ich finden konnte, um ihre Verwandlung zu beobachten.« So beschrieb sie selbst ihren Weg zur wissenschaftlichen Beobachtung. Mit Eulenfaltern bezeichnete man damals Nachtfalter.
Ihrer Mutter gefiel dies ganz und gar nicht, auch weil ihr dieses Kleingetier, das keinen wirtschaftlichen Nutzen brachte, abstoßend und hässlich erschien. Maria Sibylla hingegen war fasziniert. In diesen kleinen Naturwundern entdeckte sie Gottes Schöpfung in ihrer ganzen Pracht. Die Ehrfurcht vor der Schöpfung blieb immer ein Teil von Merians künstlerischem Schaffen. Dass Merians Mutter den Interessen und Begabungen ihrer Tochter mit Misstrauen begegnete, beweist die Tatsache, dass sie sie bereits 1865, wenige Wochen nach ihrem 18. Geburtstag, mit Andreas Graff, einem Schüler von Marrel, vermählte.
Graff war für Zeichnungen und Kupferstiche von Kirchen und anderen Bauwerken bekannt. Er unterrichtete als Zeichenlehrer, so war etwa der Barockbaumeister Johann Jacob Schübler ein Schüler Graffs. Nach drei Jahren Ehe wurde die Tochter Helena geboren, zwei Jahre später übersiedelte die Familie nach Nürnberg, in Graffs Geburtsstadt. Eine zweite Tochter Dorothea folgte 1678. Wirtschaftlich dürfte es um das Auskommen der kleinen Familie nicht besonders gut bestellt gewesen sein, denn Maria Sibylla musste zum Haushaltseinkommen beitragen. Offiziell durfte sie als Frau laut strenger Handwerksordnung nicht malen und nur auf Papier und Pergament zeichnen. Haupteinnahmequelle wurde daher der Handel mit Farben und allem Malerzubehör, den Maria Sibylla im Grunde allein führte. Außerdem nahm sie Aufträge für Seidenmalereien und bemalte Tafeltücher. Sie unterrichtete junge Frauen in Blumenmalerei und -stickerei, wofür sie kleine Musterbücher mit Kupferstichen entwarf. Vielfache Anregungen erhielt sie durch die »Hesperidengärten« der Nürnberger Patrizierfamilie Imhoff. Dies waren parkähnliche große Gartenanlagen, in denen sogar Zitrusfrüchte gediehen. Da sie eine Tochter der Imhoffs in Malerei unterrichtete, erhielt sie Zugang zu diesen Gärten. Aus dieser Beschäftigung entstand auch ihre erste Veröffentlichung, das »Neue Blumenbuch«, das als Musterbuch gedacht, ihre Kupferstiche zu Blumen enthielt. Der erste Band erschien 1675, zwei weitere folgten 1677 und 1680. Leider erfolgte der Druck des Werks auf eher schlechtem Papier und das war ohnehin für den oftmaligen Gebrauch bestimmt, so dass sich nur wenige Exemplare dieser wunderbar kolorierten Naturstudien erhalten haben.
Offenbar waren diese Kupfersticheditionen finanziell ein Erfolg, jedenfalls veröffentlichte die Merian rasch – nämlich 1679 und 1683 – zwei weitere Bände mit dem Titel »Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung«, worin sie ihre jahrelangen Naturbeobachtungen verarbeitete. In diesen beiden Bänden hatte sie ihre typische Darstellungsweise bereits gefunden, die darin bestand, dass sie die verschiedenen Entwicklungsphasen von der Raupe bis zum Schmetterling auf einem Blatt darstellte, zusätzlich zum für die einzelnen Schmetterlinge typischen pflanzlichen Umfeld. Dieses Raupenbuch erschien in einem kleinen Oktavformat, wohl relativ preisgünstig und daher leicht verkäuflich. Auch von diesem Werk haben sich nur wenige Exemplare erhalten. Naturwissenschaftler mögen diese beiden Bände als Forschungsbeitrag zur Entomologie betrachten. Sie selbst wollte ihre Beiträge eher als Andachtsbücher für die Großartigkeit von Gottes Schöpfung verstehen, womit sie sich ganz in der Tradition der Naturfrömmigkeit ihrer Zeit befand, die das Wirken Gottes auch in den kleinsten Kreaturen sah. Sie schrieb im Vorwort: »Suche demnach hierinnen nicht meine sondern allein Gottes Ehre Ihn als einen Schöpfer auch dieser Kleinsten und geringsten Würmlein zu preisen.« Für die Frauen dieser Zeit war diese Verknüpfung von Handwerk und Wissenschaft zweifellos der einzige Weg, sich wissenschaftlich betätigen zu können.
1685 entschloss sich Maria Sibylla, ihren Mann mit den beiden Töchtern zu verlassen und sich mit diesen einer Labadistengemeinde, einer frommen pietistischen Gemeinschaft, in Wieuwerd im niederländischen Friesland anzuschließen. Das Zentrum der Gemeinde, Schloss Waltha, gehörte der Familie des Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk, damals Gouverneur von Suriname, Niederländisch-Guyana in Südamerika, und auch zu einem Drittel quasi Eigentümer der Kolonie. In dieser Kolonie, die auch einen Außenstützpunkt in Suriname hatte, lebten die Mitglieder in einer urchristlichen, naturverbundenen Gemeinschaft, fern der orthodoxen Amtskirche. Sie verdienten ihren Unterhalt mit verschiedenen Handwerken und lebten äußerst bescheiden. Maria Sibylla übernahm die künstlerische Ausbildung ihrer Töchter, eignete sich selbst für ihre naturwissenschaftlichen Studien bessere Lateinkenntnisse an und beschäftigte sich mit der in Schloss Waltha befindlichen Schmetterlingssammlung aus Suriname, was ihren Wunsch, dieses Land zu besuchen, beflügelte. 1691 verließ sie die Gemeinde, die unter dem Einfluss des Predigers Yvon immer rigider geworden war und übersiedelte mit ihren Töchtern nach Amsterdam, wo sie wieder Kontakt mit Künstlern und Naturwissenschaftlern aufnahm. Sie nahm größere Aufträge für Zeichnungen und Kupferstiche an, etwa für einen Verwaltungsbeamten der Ostindien-Kompanie, dessen aus Indonesien mitgebrachte Sammlung sie in einem Werk festhielt. Auch die Sammlung des Amsterdamer Bürgermeisters dokumentierte sie mit ihren prachtvoll kolorierten Kupferstichen. Da sie sich 1692 von ihrem Mann hatte scheiden lassen, war ihre gesellschaftliche Position etwas schwierig, aber dank ihrer Kunst konnte sie sich behaupten.
In diesen Amsterdamer Jahren schuf sie die finanzielle Grundlage für eine Reise nach Suriname. 1699 verkaufte sie fast alle ihre Bilder und ihre naturkundlichen Sammlungen, hinterlegte ein Testament bei einem Amsterdamer Notar zu Gunsten ihrer Töchter und brach mit der jüngeren Tochter Dorothea auf dem Kauffahrtssegler »Willem de Ruyter« nach Suriname auf. Man hatte sie vor den Strapazen der Reise, vor dem mörderischen Klima vor Ort und generell vor den Unbilden, die zwei allein reisenden Frauen drohten, gewarnt, doch sie blieb standhaft. Mit großem Gepäck, vor allem Utensilien zur Aufzucht und Konservierung von Insekten und natürlich Pergament und Pinsel und Farben, überstand sie die Seereise zur Küstenstadt Paramaribo. Sie mietete für sich und ihre Tochter ein kleines Haus und machte sich sofort auf die Suche nach exotischen Pflanzen, Käfern, Larven und Raupen. Im Garten des Hauses setzte sie die Pflanzen ein, für die Raupen hatte sie kleine Behälter, um die Metamorphosen dieser Tiere zu beobachten. Beim Einsammeln der verschiedenen Objekte bediente sie sich der Hilfe der eingeborenen Kariben und schwarzer Sklaven, für die sie nur lobende Worte fand. Vor allem bei Expeditionen in den Dschungel brauchte sie Hilfe für das Freischlagen von Pfaden. Einen Teil der Reise in das Landesinnere legte sie allerdings mit einem Boot auf dem Fluss Suriname zurück. Nicht berichtet hat sie, wie sie alle Mühen dieser Reise überstand, war doch der Fluss voller Kaimane, es gab unbekannte Schlangen und Echsen, die Hitze war drückend. Ihr Forschungseifer war wohl so groß, dass all diese Gefahren und Unwägbarkeiten angesichts der abenteuerlichen Ergebnisse keine Erwähnung fanden.
Am 18. Juni 1701 kehrte sie mit dem Segler »De Vreede« nach zwei Jahren wieder nach Amsterdam zurück. Einen großen Teil der mitgebrachten Objekte verkaufte sie, da es in den reichen Handelsstädten der Niederlande eine große Anzahl von Sammlern gab.
1705 hatte sie einen Band über die in Suriname beobachteten Tiere und Pflanzen unter dem Titel »Metamorphosis insectorum Surinamensium oder Verwandlung der surinamischen Insekten, worin die surinamischen Raupen und Würmer in allen ihren Verwandlungen nach dem Leben abgebildet sind und beschrieben werden und wobei sie auf die Gewächse, Blumen und Früchte gesetzt werden, auf denen sie gefunden wurden. Es werden hier auch Frösche, wundersame Kröten, Eidechsen, Schlangen, Spinnen und Ameisen gezeigt und erklärt, und alles wurde in Amerika nach dem Leben und in natürlicher Größe gemalt« herausgebracht, der ihr viel Anerkennung brachte. Infolge der Größe dieses Werkes hat sie nicht alle Kupferstiche selbst hergestellt, sondern bei renommierten Künstlern stechen lassen. Sie selbst rührte in Frankfurt bei der jährlichen Herbstpräsentation der Neuerscheinungen die Werbetrommel für ihr Werk. Es war ein Folioband mit 60 Kupferstichen im Format 50 mal 35 cm, von dem im 18. Jahrhundert mehrere Nachdrucke erschienen. Ein Faksimile wurde erst 1975 hergestellt.
Die nächsten Jahre lebte sie von den Erträgen ihrer Bücher, aber auch vom Handel mit Malutensilien und Pigmenten, sowie vom Verkauf mancher exotischer Objekte. In Amsterdam war sie eine anerkannte Persönlichkeit, deren Leistungen gewürdigt wurden. 1717 erlitt sie einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht erholte. Das Werk der Mutter setzte ihre jüngere Tochter Dorothea fort. Diese heiratete den aus der Schweiz stammenden Maler und Kunsthändler Georg Gsell, der es bis zum Hofmaler Peters des Großen brachte. In einer erst 1800 erschienenen Würdigung Maria Sibylla Merians hieß es: »Wenn je ein Frauenzimmer lebte, welches auf einen bleibenden Ruhm und innige Hochachtung mit Recht Anspruch machen konnte, so ist es die berühmte Maria Sibylla Merian.«
Isabella Ackerl