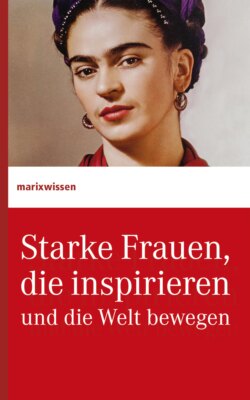Читать книгу Starke Frauen, die inspirieren und die Welt bewegen - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mystikerin
ОглавлениеTeresa von Ávila (bürgerlich: Teresa de Cepeda y Ahumanda, Ordensname: Teresa de Jesús) hatte die Fähigkeit zur hochempfindsamen Innenschau und war zugleich mit einem höchst praktischen Verstand und einer robusten Durchsetzungsfähigkeit begabt. Sie gehört mit Augustinus, Gregor dem Großen, Bernhard von Clairvaux, Hildegard von Bingen, Bonaventura und Ignatius von Loyola in die Reihe außergewöhnlicher Doppelbegabungen, die sich in den Innenwelten ihrer Seele ebenso sicher bewegten wie in der äußeren Welt. Teresas Schriften sind aus ursprünglichem Erleben entstanden und geben differenzierte Beschreibungen der verschiedenen Zustände mystischer Erhebung. Ihre Anleitungen zum »inneren Beten« eröffnen einen Versenkungsweg, der ohne Übersteigerung und falsche Selbstfixierung ist. Als Reformerin des Karmelitenordens und Gründerin zahlreicher Klöster hat sie gegen erhebliche Widerstände ein praktisches Werk geschaffen, das bis heute Bestand hat.
Früh schon ist die 1515 im kastilischen Ávila geborene Teresa religiös geprägt worden. Nach dem Tod ihrer Mutter wuchs sie in der Obhut von Klosterfrauen auf, und ein Onkel machte sie mit geistlicher Literatur bekannt. Im Alter von zwanzig Jahren trat sie in das Karmelitinnenkloster (Convento de la Encarnatión) in Ávila ein, aber auch als Nonne blieb ihr immer ein Ungenügen an ihrem geistlichen Weg, über das sie sich lange nicht klar werden konnte. Wenig hilfreich für ihre Selbstfindung war das unruhige Treiben in dem verweltlichten Kloster mit über hundertfünfzig Nonnen, das wie viele Klöster der Zeit nur noch wenig Ähnlichkeit hatte mit dem Ursprungsideal eines zurückgezogenen, gottgeweihten Lebens. Es herrschte stetiges Kommen und Gehen von Besuchern und Nonnen, die regelmäßig zu Stadtbesuchen das Kloster verließen. Die Nonnen lebten in großzügigen Wohnungen eher wie in einem vornehmen Pensionat, und ihre Frömmigkeitsübungen waren oft veräußerlichte Routine. Eine schwere Krankheit brachte Teresa drei Jahre nach ihrem Klostereintritt an den Rand des Todes. Sie lag in einem so tiefen Koma, dass man sie für tot hielt und ihr nach damaliger Praxis bereits die Augen mit heißem Wachs versiegelt hatte. In den langen Monaten der Rekonvaleszenz nach dieser schweren Krise, die sie in der Pflege ihrer Familie verbrachte, kam sie zu größerer innerer Ruhe, als es ihr im Klosteralltag möglich gewesen war. Dem Andachtsbuch Das dritte geistliche ABC von Francisco de Osuna (um 1492–um 1541) entnahm sie Anregungen für eine tiefe Versenkung in die Gegenwart Gottes, das sogenannte »innere Beten«, das sie in einer ihr gemäßen schlichten und unmittelbaren Form wie ein »Verweilen bei einem Freund« praktizierte. Hier schon stellten sich erste mystische Erfahrungen ein.
Es folgten anderthalb Jahrzehnte des inneren Kampfes, auf die sie in ihren Lebenserinnerungen nur knapp eingeht. Nach der Rückkehr ins Kloster blieb sie Suchende, oft an ihrem Weg zweifelnd und neu ansetzend. Sie folgte weiter ihrem Übungsweg, der Sammlung auf Gott hin im inneren Beten, aber erst 1554, in ihrem vierzigsten Lebensjahr, hatte sie zwei für sie einschneidende Begegnungen, durch die ihre anhaltenden Bemühungen endlich Erfüllung fanden. Der Anblick einer Darstellung des vom Schmerz gezeichneten Christus, die während der Osterzeit in ihrem Andachtsraum aufgestellt wurde, und die Lektüre der Bekenntnisse von Augustinus ließen offenbar lange Verdrängtes und Verschüttetes bei ihr aufbrechen. Alle seelischen Hemmnisse, die sie bis dahin an einer größeren Gottesnähe gehindert hatten, wurden in einem Gefühlssturm hinweggefegt. Ihr bis dahin noch keimhaftes mystisches Erleben entfaltete sich seitdem zu einer Intensität, die sie zutiefst erschütterte. Ein überwältigendes Gefühl der Gegenwart Gottes durchdrang dabei ihre Seele und ließ ihren Leib im Wonneschmerz erbeben. In bildhaften Visionen sah sie Jesus in überirdischem Glanz. Diese Erfahrungen nahmen an Häufigkeit und Stärke zu. In den zeitgenössischen Meditationsbüchern, etwa von Osuna, hatte sie gelesen, dass man im inneren Beten zu einer bildlosen, von allem Gegenständlichen abgelösten Versenkung streben soll. Ihr eigenes Beten aber kreiste immer um Jesus Christus, den Mensch gewordenen Gott, denn sein Leiden und seine Menschheit wollte sie sich gegenwärtig halten. Oft wurde ihr der verklärte Christus in bildhaften Visionen gezeigt. Beängstigt fragte sie sich, ob das nicht nur Wahngebilde und Täuschungen sein könnten und ob nicht ihr Weg des inneren Betens falsch sei. Zwei erfahrene geistliche Berater beruhigten sie und bestärkten sie auf ihrem Weg. Der junge Jesuit Diego de Cetina (1531–1572), dem sie ihre Ängste anvertraute, bestätigte ihr den Wert der bildhaften Vergegenwärtigung der Evangelienberichte. Es war die übliche Praxis in den Geistlichen Übungen seines Ordens, die Ignatius von Loyola entwickelt hatte. Fray Pedro de Alcántara (1499–1562), der Begründer einer Reformbewegung im Franziskanerorden, den sie 1560 kennenlernte, war selbst Mystiker und konnte ihre verschiedenen Erfahrungen einordnen und ihr die Echtheit bestätigen.
Mit der inneren Sicherheit, die sie langsam gewann, entstand der Wunsch, dem Weg des inneren Betens ungestört in der Schlichtheit und Zurückgezogenheit eines ursprünglichen klösterlichen Lebens folgen zu können, wie es in ihrem unruhigen Kloster nicht möglich war. Trotz erheblicher Widerstände im Orden und in der Stadt gelang es ihr 1562 durch Fürsprache einflussreicher Freunde, unter anderem von Pedro de Alcántara, und mit finanzieller Unterstützung ihres Bruders Lorenzo, zusammen mit einer kleinen Gruppe Mitschwestern in ein zum Kloster umgebautes Haus in der östlichen Vorstadt von Ávila umzuziehen. Aus dieser ersten, San José genannten Klostergründung Teresas ging die Reformbewegung der Unbeschuhten Karmeliten hervor, die zur alten Strenge und Ernsthaftigkeit der längst abgeschwächten Ordensregel von 1247 zurückkehrte. Dabei kam es Teresa weniger auf die Strenge selbst an, die sich in den einfachen Sandalen aus Hanf zeigte, von denen sich die Bezeichnung unbeschuht ableitete, als darauf, die äußeren Bedingungen für ihren Versenkungsweg des inneren Betens zu schaffen.
Noch während der Vorbereitungen für die Übersiedlung nach San José hatte sie ihre Lebenserinnerungen verfasst: Das Buch meines Lebens (Libro de la vida). Bereits dieses erste Werk verbindet den Rückblick auf ihren eigenen geistlichen Weg mit einer außerordentlich abgewogenen und lebensklugen Hinführung zur Mystik. Sie kannte zwar die zeitgenössische Literatur dazu, schöpfte aber vor allem aus ihren eigenen, präzise beobachteten Erfahrungen, Gefährdungen, Rückschlägen und schrittweisen Fortschritten, woraus sie Anleitungen ableitet für den mystischen Aufstieg über vier Stufen des inneren Gebets. Damit war sie gerüstet, ihre Mitschwestern als Seelenführerin auf ihrem Gebetsweg zu leiten und vor den Irrwegen, die sie selbst hatte durchschreiten müssen, zu bewahren. Es ist vor allem eine unverkrampfte Haltung, ohne besondere Techniken und ohne übertriebene Askese, zu der sie auffordert, ein einfaches Verweilen in der Aufmerksamkeit für Gott. Wichtig ist für sie dabei, frei zu werden von allen Fixierungen auf sich selbst. Als bereits erfahrene Mystikerin weiß sie auch, dass sich durch unsere Bemühungen allein nichts erreichen lässt, wenn Gott uns nicht zu sich erhebt. Alle schwärmerischen Vorstellungen, die meinen, den Weg zu einer Selbstvergottung zu kennen, weist sie ab. Auch einen Versenkungsweg, der den Geist entleeren will von allen Vorstellungen, hält sie für falsch. Diese neuplatonisch inspirierte mystische Theologie etwa Osunas oder auch Meister Eckharts ist für sie ein unchristlicher Weg, weil Gott sich selbst mit Jesus in Menschengestalt gezeigt hat und wir ihn im gewandelten Brot und Wein des Altarsakramentes stets ganz gegenständlich anwesend haben. Teresa gehörte auch zu den Mystikern, die oft während der Eucharistiefeier angesichts der erhobenen Hostie zur mystischen Gottesbegegnung entrückt wurden. Es ist für Teresas praktischen Menschenverstand offenkundig, dass es sich bei dem Streben nach rein geistigen, bildlosen Versenkungszuständen um eine theoretische Konstruktion handelt, die dem Menschen mit seiner beschränkten leibgebundenen Natur nicht gemäß ist, wie sie mit einem ihrer plastischen Vergleiche erläutert: »Wir sind keine Engel, sondern haben einen Leib. Uns zu Engeln aufschwingen zu wollen, während wir noch hier auf Erden leben – und dazu noch so sehr der Erde verhaftet, wie ich es war –, ist Unsinn, vielmehr braucht das Denken im Normalfall etwas, was ihm Halt gibt.« Teresa gibt ihren Schwestern auch klare Kriterien für die Unterscheidung dessen, was eine echte Erfahrung der Nähe Gottes ist und was bloße Täuschung. Vor allem muss sich nach echten Erfahrungen eine Umwandlung des Menschen zum Besseren zeigen, eine große innere Freiheit und eine mündigere vertrauensvolle Gottesfurcht, die alle »knechtische Furcht der Seele« verdrängt. Auf Wunsch der Schwestern von San José fasste sie ihre mündlich gegebenen Unterweisungen zu einer Anleitung für das innere Beten zusammen; es wurde ihr zweites Buch, Weg der Vollkommenheit (Camino de Perfección). Der Text lässt noch das an ihre Mitschwestern gerichtete gesprochene Wort erkennen, wenn sie etwa zur schlichten Haltung des inneren Betens auffordert: »Ich bitte euch ja gar nicht, dass ihr an ihn denkt oder euch viele Gedanken macht oder in eurem Verstand lange und subtile Betrachtungen anstellt; ich will nicht mehr, als dass ihr ihn anschaut.«
Bereits 1567, nur fünf Jahre nach der Übersiedlung in ihr eigenes Kloster, erhielt Teresa vom Ordensgeneral der Karmeliten die Genehmigung für weitere Gründungen nach ihren Vorstellungen. In rascher Folge entstanden Klöster der Unbeschuhten in Medina del Campo, Malagón und Valladolid. Die Strapazen ihrer Gründungsreisen, denen sie sich trotz labiler Gesundheit immer wieder aussetzte, waren außerordentlich. Stundenlang saß sie verschleiert bei Hitze oder klirrender Kälte im verhängten Eselskarren, während das wackelige Gefährt über die unbefestigten Wege rumpelte. Gleichzeitig mit der Gründung der ersten Frauenklöster bemühte sie sich darum, auch einen männlichen Reformzweig ins Leben zu rufen. Sie gewann dafür den Prior des Klosters von Medina und den jungen Pater Juan de Santo Matía, der später als Johannes vom Kreuz selbst einer der bedeutendsten Mystiker werden sollte. Verloren im Dorf Duroelo, in der Einöde am Rande der Sierra de Ávila, gründeten die beiden in einem baufälligen Haus im November 1568 das erste Männerkloster im Geist von Teresas Reform. Zügig folgten auch weitere Frauenklöster in Toledo, Pastrana, Salamanca und Alba de Tormes. 1571 wurde Teresa damit beauftragt, ihr altes Kloster in Ávila zu reformieren, was sie dort in der Funktion der Priorin bis 1574 festhielt. Anschließend gründete sie wieder in Segovia, Beas, Sevilla und Caravaca.
Zu den ungeheuren Anstrengungen dieser Gründungsaktivitäten kamen Widerstände, mit denen sie sich auseinandersetzen musste. Aufgrund einer Anzeige der überspannten Prinzessin Éboli wurden ihre Lebenserinnerungen von einem Inquisitionsgericht geprüft. Die Prinzessin hatte mitsamt Hofstaat in den neuen Karmel von Pastrana eintreten wollen, ohne ihr exzentrisches Leben aufzugeben, sodass Teresa schließlich einschreiten musste. Die Anzeige der gekränkten Diva verlief jedoch im Sande. Gefährlicher für ihr Werk waren die Gegenkräfte, die sich im Stammorden gegen Teresa sammelten, um die Bewegung der Unbeschuhten zu unterdrücken. Mit Unterstützung des päpstlichen Botschafters in Madrid, dem Teresas emanzipiert-selbstbewusstes Agieren ein Dorn im Auge war, schienen sich diese Kräfte durchsetzen zu können. 1575 wurden Teresa weitere Gründungen untersagt, und 1577 setzte der Stammorden führende Köpfe der Reform fest. Johannes vom Kreuz hielt man neun Monate unter erbärmlichen Bedingungen in einem Kloster der Karmeliten in Toledo gefangen. 1580 ermöglichte schließlich das Eingreifen König Philipps II. von Spanien die Wende zugunsten Teresas und die endgültige Anerkennung ihrer Reform.
Die Zeit, in der Teresa die Gründungstätigkeit untersagt war, nutzte sie noch einmal für ein großes Werk, ihr Buch Wohnungen der inneren Burg (Castillo interior, Las moradas). Am Bild einer Burg, deren innerste Kammer von sechs ineinander geschachtelten Wohnungen umschlossen ist, beschreibt sie den mystischen Weg. Die innerste Mitte dieser Seelenburg steht für den Ort, an dem sich die Begegnung mit dem personalen Gott ereignen kann. Diese Begegnung ist kein Verlöschen in einem dunklen göttlichen Abgrund, wie es sich eine neuplatonische Richtung der mystischen Theologie und östliche Heilswege vorstellen, sondern die Seele schaut den dreieinigen Gott auf eine geistliche Weise, »in allen drei Personen mit einer Entflammung, die ihren Geist zuerst nach Art einer Wolke von größter Klarheit überkommt«. Auf dem Weg nach innen lassen sich die Türen der ersten Wohnungen noch durch inneres Beten und geistliches Wachstum öffnen. Dazu gehört vor allem, dass man nicht genießerisch nach gemütvollen Andachtsgefühlen strebt, mit denen man allein sich selbst meint. Solche selbstverliebten, scheinbar frommen Gefühle haben für Teresa nichts mit der Erfahrung göttlicher Nähe zu tun. Die letzten Wohnungen, in denen sich die mystischen Vorgänge ereignen und bis zur höchsten Erhebung in der innersten Mitte der Seelenburg weiter verstärken, können wir nicht allein durchschreiten, wir müssen durch göttliche Gnade hineingeführt werden.
Vom Alter geschwächt und schwer krank machte sich Teresa 1582 auf, um weitere Klöster ins Leben zu Rufen. Unterwegs starb sie in Alba de Tormes in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober. Fünf Jahre nach ihrem Tod erkannte der Papst die Unbeschuhten Karmeliten als unabhängigen Orden an. 1622 wurde Teresa heiliggesprochen und 1970 zur Kirchenlehrerin erhoben.