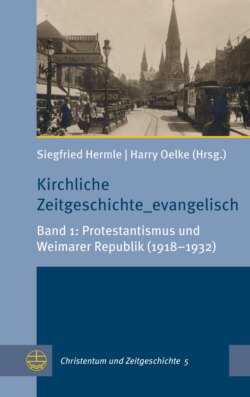Читать книгу Kirchliche Zeitgeschichte_evangelisch - Группа авторов - Страница 14
2. Die Weimarer Reichsverfassung und das Staat-Kirche-Verhältnis
ОглавлениеIm November 1918 schienen sich die Befürchtungen vieler Protestanten zu bewahrheiten: Während es im Zuge der Revolution in einigen evangelischen Landeskirchen zu keinen Eingriffen in die kirchlichen Belange kam, lagen die Dinge vor allem in Preußen anders. Dort wurde mit Adolf Hoffmann (USPD) ein erklärter Kirchengegner Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. In der Vorkriegszeit hatte er zu den entschiedensten Vertretern der sozialistischen Kirchenaustrittsbewegung gehört; die Zehn Gebote galten ihm als Herrschaftsinstrument der besitzenden Klasse. Hoffmann wies seine Beamten an, die Trennung von Staat und Kirche radikal und unverzüglich umzusetzen: Einstellung der staatlichen Zuschüsse, Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht, Abschaffung des Religionsunterrichts, Erleichterung des Kirchenaustritts. Breite evangelische Kreise machten daraufhin – teilweise gemeinsam mit Katholiken – in einer ›Volkskirchenbewegung‹ gegen die gefährdete öffentliche Rolle von Religion und Kirche erfolgreich mobil. Hoffmann blieb zwar nur sieben Wochen im Amt und sein Nachfolger setzte dessen kulturkämpferische Anordnungen weitgehend wieder außer Kraft, dennoch blieb bei vielen evangelischen Kirchenchristen diese Erfahrung von Kirchenfeindschaft mit der Entstehungsphase der Republik belastend verbunden und wirkte sich somit nicht nur auf das Verhältnis zur Sozialdemokratie dauerhaft negativ aus. Kurzfristig führte es dazu, dass Vertreter beider Großkirchen bei den Wahlen zur Nationalversammlung dazu aufforderten, nichtsozialistische Parteien zu wählen. Die kirchlich gefürchtete sozialistische Mehrheit wurde so erfolgreich verhindert.
Auch in der aus den ersten demokratischen Wahlen hervorgegangenen Nationalversammlung wurde von SPD-Vertretern eine konsequente Trennung von Staat und Kirche in der neuen Republik gefordert, wenngleich man nun von einer gewaltsamen Trennung absah. Dass es schließlich zu einer kirchenfreundlichen Variante der Trennung von Staat und Kirche – der sogenannten hinkenden Trennung – kam, verdankt sich der politischen Kräftekonstellation und auch dem Wirken einflussreicher Protestanten im Verfassungsausschuss: dem ehemaligen Pfarrer Friedrich Naumann (DDP) und dem Staats- und Kirchenrechtler Wilhelm Kahl (DVP). Politisch getragen wurde die Neuordnung des Staat-Kirche-Verhältnisses von der katholischen Zentrumspartei sowie von den realistischen protestantischen Kräften in der Deutschen Volkspartei (DVP) und der Deutschen Demokratischen Partei (DDP).
Die neue Verfassung des Deutschen Reiches bestätigte zwar das Ende des Staatskirchentums, bewahrte aber die privilegierte öffentliche Position der Kirchen und gab ihnen die Möglichkeit zur selbstständigen Gestaltung ihrer Angelegenheiten. Die für die Kirchen entscheidenden Regelungen wurden in Art. 135 bis 141 in einem eigenen Abschnitt ›Religion und Religionsgesellschaften‹ festgehalten. Hierzu gehörten unter anderem die Garantie der vollen Glaubens- und Gewissensfreiheit und der ungestörten Religionsausübung (Art.135); die Verfassung der Religionsgesellschaften als ›Körperschaften des öffentlichen Rechts‹ (Art.137); die Freiheit der Selbstverwaltung (Art.137); das Recht auf Kirchensteuererhebung mit Hilfe des Staates (Art.137); die Gewährleistung kirchlichen Eigentums (Art.138); die Anerkennung der Verpflichtung des Staates zu Leistungen, sofern die Kirchen hierauf durch Gesetz, Vertrag oder besondere Rechtstitel einen Anspruch hatten (Art.138); der Schutz des Sonntags und der staatlich anerkannten Feiertage (Art.139); das Recht auf ungestörte Religionsausübung unter Beteiligung der Religionsgesellschaften in staatlichen Einrichtungen wie Heer, Krankenhäusern und Gefängnissen (Art.140; 141); der Erhalt der Theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen (Art.149).
Die Beibehaltung des Religionsunterrichts wurde an allen Schulen – mit Ausnahme der wenigen »bekenntnisfreien (weltlichen)« Schulen – als »ordentliches Lehrfach« mit konfessioneller Prägung garantiert (Art.149). Die geistliche Schulaufsicht wurde indes beseitigt. Die Schulen sollten simultan sein, d. h. mit gemischt-konfessioneller Schüler- und Lehrerschaft; auf Antrag von Erziehungsberechtigten konnten jedoch konfessionell oder weltanschaulich ausgerichtete Schulen geschaffen werden, wenn dadurch ein ordentlicher Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wurde. Bestehende konfessionelle Volksschulen blieben unangetastet. Die Schulartikel der Reichsverfassung konnten den tobenden ›Schulkampf‹ um die Frage, welcher Schultyp das Leitmodell darstellen sollte, aber nicht dauerhaft beilegen; das Vorhaben eines Reichsschulgesetzes, das die genaue Ausgestaltung des Schulwesens regeln sollte, scheiterte, da in dieser weltanschaulich dominierten Frage keine politische Mehrheit zu finden war. Mit Ausnahme von Hessen, Baden und Thüringen, wo sich christliche Gemeinschaftsschulen bereits bewährt hatten, unterstützten die evangelischen Landeskirchen das überkommene Modell der Bekenntnisschule.
War vor 1918 das Verhältnis von Staat und Kirche auf Länderebene geregelt gewesen, so kam es mit der am 11. August 1919 in Kraft getretenen Weimarer Verfassung erstmals zu einer reichsweiten verfassungsrechtlichen Regelung. Diese wurde 1949 ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland übernommen.
Obgleich die Weimarer Verfassung den beiden großen christlichen Kirchen Wirkungsmöglichkeiten entsprechend ihres volkskirchlichen Anspruches sicherte, zeigten sich diese nur begrenzt zufrieden. Die evangelischen Kirche monierte vor allem die weltanschauliche Neutralität der Weimarer Republik (Art.137: »Es besteht keine Staatskirche«), die sie als Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens empfand. Die Weltanschauungsneutralität des Staates wurde als Religionslosigkeit gedeutet, von manchen gar als Religionsfeindschaft. Ein ›Staat ohne Gott‹ aber konnte nach dem Verständnis der evangelischen Zeitgenossen keine autarke und starke Staatsgewalt sein. Da die meisten Protestanten weiterhin am Ziel einer christlichen Gesellschaft festhielten, fiel es ihnen auch schwer, sich auf den weltanschaulich-religiösen Pluralismus einzustellen, der zur modernen Staatlichkeit gehört.
Die Verfassung hatte die Staat-Kirche-Beziehung grundsätzlich geregelt, alles Weitere wurde auf der Ebene der Länder festgelegt. Entsprechend der Abschlüsse von Konkordaten mit dem Vatikan kam es aus Paritätsgründen erstmals auch zu ›Kirchenverträgen‹ der Länder mit den jeweiligen evangelischen Landeskirchen, die damit als gleichrangige Partner des Staates anerkannt wurden. Dies erfolgte 1923 in Braunschweig, 1924 in Bayern, 1925 in der Pfalz, 1929 in Thüringen, 1931 in Preußen und 1932 in Baden. Zumeist erhielten die evangelischen Landeskirchen in diesen Verträgen die gleichen Rechte, die zuvor schon die katholische Kirche erhalten hatte, u. a. den Erhalt staatlich finanzierter theologischer Fakultäten sowie die kirchliche Mitwirkung bei der Ernennung von Theologieprofessoren und Religionslehrern. Auch die Dotationen des Staates an die Kirche als Kompensation für die Säkularisation von Kirchengut wurden geregelt. Teilweise, so in Preußen, bekam der Staat ein Einspruchsrecht bei der Besetzung kirchenleitender Ämter, sofern staatspolitische Bedenken gegenüber einem Kandidaten bestanden (›politische Klausel‹). Kirche und Weimarer Republik hatten damit einen »amtlichen und rechtlichen modus vivendi« [Smend, 5] gefunden. Der innere Vorbehalt gegenüber der demokratischen Republik konnte bei der Mehrheit der Kirchenchristen jedoch nicht überwunden werden.