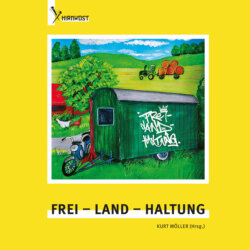Читать книгу Frei - Land - Haltung - Группа авторов - Страница 18
FAZIT UND PERSPEKTIVEN
ОглавлениеDas Dorf ist offenbar nicht mehr das, was es einmal war – jedenfalls nach den weithin verbreiteten nostalgisch-schönfärberischen Zeichnungen ländlicher Idylle: ein Ort der Heimat, der durch Homogenität, Nestwärme und Sesshaftigkeit gekennzeichnet ist. Im Ausmaß regional und auch geschlechtsspezifisch sehr unterschiedlich denkt heutzutage immerhin die Hälfte bis 3/4 der Landjugendlichen über einen (womöglich auch nur temporären) Wegzug nach (ebd.: 106/107), um Selbstverwirklichungs-, Ausbildungs- und Berufschancen zu verbessern und Chancen auf den Erwerb von Wohlstand zu nutzen. In einigen strukturschwachen Landstrichen bestehen deutlich spürbare Unzufriedenheiten mit den infrastrukturellen Gegebenheiten, und gerade die besser (aus)gebildeten, vor allem weiblichen jungen Menschen haben hier verstärkt Abwanderungstendenzen. Heimatgefühle und lokale sowie familiäre Verwurzelungen können Letzteren auf Dauer bei den meisten nichts entgegensetzen. Auch wenn konventionalistische Werthaltungen mit zum Teil problematischen Auswirkungen auf die politische Kultur des ländlichen Raums noch vergleichsweise stark verhaftet bleiben, weichen sich dennoch traditionelle Bindungen und kulturelle Praktiken mehr oder weniger rapide auf, erleiden über Jahrhunderte und Jahrzehnte gewachsene örtliche Vereinigungen Attraktivitätsverluste innerhalb der nachwachsenden Generationen und häufen sich bei ihnen dementsprechend fast durchweg die Klagen über Rekrutierungsschwierigkeiten neuer Mitglieder. Bleibt wenigstens die Kirche im Dorf? Auch ihre Rolle wird – nicht nur im weitflächig konfessionslosen Osten der Republik – erheblich in den Hintergrund geschoben. Gesellschaftliche Treiber wie Ökonomisierung, Mediatisierung, Anonymisierung, Individualisierung, Pluralisierung, Entschleunigung, Globalisierung und Mobilitätszuwächse haben längst auch ländliche Strukturen ergriffen.
Und dennoch oder gerade deshalb: Von regionalen Ausnahmen einmal abgesehen zeigen sich rund 90 % der Landjugendlichen mit ihren Lebenssituationen insgesamt und den Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Lebensumfeldern zufrieden, die meisten von ihnen sogar „überwiegend“ bzw. „völlig“ (vgl. Becker/Moser 2013: 58). Sie weisen damit für sich eine hohe Lebensqualität aus und sehen zumeist zuversichtlich in die Zukunft. Das lange vorherrschende Bild von Landjugend als benachteiligter Jugend erweist sich vor diesem Hintergrund eher als Zerrbild. Am Dorfleben wird besonders geschätzt, seine Ruhe zu haben, in einer sicheren Umwelt leben zu können und dabei viele Freiheiten zu besitzen (vgl. Becker/Moser 2013: 87).
Was diese Vorzüge neben allen empfundenen Widrigkeiten und Unzulänglichkeiten, aber auch den Strategien des Arrangements mit ihnen konkret für die jungen Menschen bedeuten und welche weiteren Vorteile Landleben aus ihrer Sicht mit sich bringt, lassen die in diesem Buch folgenden Gesprächsauszüge zutage treten. Ihre Vielfalt macht dreierlei deutlich: Erstens gibt sie zu erkennen: Die Landjugend gibt es nicht. Zweitens offenbart die Pluralität der Sichtweisen: Eine geografisch und kulturell statische Heimat lässt sich nicht (mehr) denken. Heimatverluste, die in dieser Weise verspürt werden, gleichen tatsächlich Phantomschmerzen (vgl. Schüle 2017), die auf einer Verklärung der Vergangenheit beruhen und die Möglichkeiten neuer Erfahrungsformen von Vertrautheit, Gemeinschaft und Geborgenheit ungenutzt lassen. Drittens nährt sie gerade mit Blick auf diese neuen Optionen von Beheimatung die Vermutung: Es kann kein Zufall sein, wenn der urbane Zeitgeist alte Dorfqualitäten in die Stadt holt: selbst gärtnern als Urban Gardening, das Backhaus als Backvollautomat, Nachbarschaftstratsch und Hocketse als Quartiersfest, alte Handwerkstugenden als aktueller Do-It-Yourself-Trend, unbekümmerte Freiflächennutzung als innerstädtisches Brachenrecycling, Hausmusik im kleinen Kreis als Wohnzimmer-Konzert einer Indie-Band, internetverbreitete Jugendkultur aus der Provinz als chart- und metropolentauglichen Hype, Fahrzeug ausborgen als Sharing-Kultur, Tante Emma als Bioladen, die Eckkneipe als hippen veganen Imbiss, Holzfällerhemden und Strickmützen kombiniert mit schweren Lederboots und Hosenträgern als Lumbersexual-Style für den urbanen wilden Mann, Marmelade selbst einkochen als ultimativen Nachhaltigkeits-Ausweis …