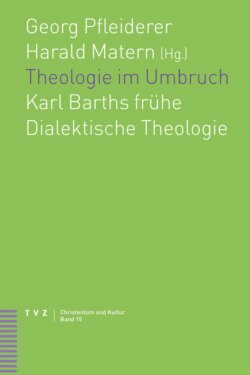Читать книгу Theologie im Umbruch - Группа авторов - Страница 17
IV.
ОглавлениеDiese Interaktionen und Interferenzen, die eine genauere Untersuchung verdienten, spiegeln die grosse grundsätzliche Korrelation, auf die auch die Formulierung meines Themas mit dem Bild aus Barths Brief an Thurneysen vom 11. November 191853 vom abwechselnden Brüten über der Zeitung und über dem Neuen Testament anspielt. Fragen wir, ob sich auf dem kirchlich-theologischen Feld eine ähnliche Entwicklungslinie zeichnen lässt wie auf dem politischen, so ist zunächst festzuhalten, dass Barths theologische Produktion nicht versiegte, wie er es im Brief an Loew jedenfalls für eine gewisse Zeit in Aussicht stellte. Freilich: Der Doppelschlag misslang, mit dem er im November 1915 auf die Sackgasse aufmerksam machen wollte, in die nach seinem Urteil Kirche und Theologie geraten waren: Der «Antrag betr. Abschaffung des Synodalgottesdienstes» vom 11. November 1915 wurde nur von wenigen verstanden, der besonders gegen den Repräsentanten der Schweizer liberalen Theologie Paul Wernle gerichtete Basler Vortrag «Kriegszeit und Gottesreich» vom 15. November 1915 erwies sich als «Schlag an die Wand»54, wie Barth es selbstkritisch ausdrückte. Aber es ist doch deutlich, dass Barth in diesem Vortrag mit den zwei Sätzen «Welt ist Welt»55 und «Gott ist Gott»56 den Ausgangspunkt und den Ariadnefaden für die weitere theologische Arbeit gefunden hatte57, die sich offenbar nicht |35| zuletzt im Blick auf das sozialistische Engagement als notwendig erwies und die zu den programmatischen Vorträgen und Aufsätzen der Folgejahre und zu den beiden Auslegungen des Römerbriefes führte.
Gerade im durchgängig polemisch gegen Wernle gerichteten und ganz im Gegensatz zu ihm entwickelten Vortrag «Kriegszeit und Gottesreich» macht Barth klar, dass alle anerkannten Wertinstanzen: Philosophie, Ethik, Staat, Sozialismus, Pazifismus und auch das Christentum, wie im Weltkrieg auf bittere Weise manifest wurde, deshalb keine überlegene schöpferische Position darbieten und eröffnen können, weil sie auf das Denken und Handeln im Gegensatz und in Gegensätzen fixiert sind und fixieren. Darin erweisen und vollziehen sie alle ihre sterile unfruchtbare Wahrheit: Welt ist Welt. Gott ist jedoch nicht aus einem Gegensatz zu begreifen, sondern nur aus seiner eigenen souveränen schöpferischen neuen Wirklichkeit: Gott ist Gott. Darauf kommt alles an, das ist die letzte Not und die letzte Aufgabe, dass wir uns unter und über und in allen Gegensätzen dem sich selbst setzenden, sich selbst beweisenden, d. h. sich selbst offenbarenden Ursprung zuwenden. Diese nicht leere, sondern in sich erfüllte, lebendige Tautologie «Gott ist Gott» erkennen und bekennen – das heisst: Glauben. Und «je wirklicher unser Glaube wird, desto weniger fragen wir überhaupt, wie wir uns morgen u. übermorgen halten sollen […]. Wir denken u. reden u. handeln dann einfach von Schritt zu Schritt so, wie wir müssen.»58
Kein Zweifel: Hier hatte Barth, in wenige Sätze zusammengefasst, die Grundlage, den Quellpunkt gefunden, von dem aus nun eine neue Hermeneutik, Theologie und Ethik zu entwickeln waren, die gerade nicht zu einer «Apokalyptik schroffster dualistischer Art» gerieten, wie Wernle als Hörer des Vortrags meinte.59 Die «Vorträge und kleineren Arbeiten 1914–1921» dokumentieren, wie Barth diese Aufgabe Schritt für Schritt in Angriff genommen hat, obwohl er von solchen «Expeditionen» wie der Rede in Basel zunächst Abstand nehmen wollte.60 |36|