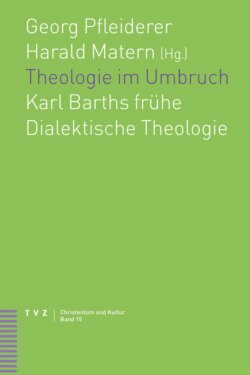Читать книгу Theologie im Umbruch - Группа авторов - Страница 28
3. Der Landesstreik 1918
ОглавлениеEs waren diese Spannungen, die sich schliesslich im Landestreik entluden.129 Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg hatten auch Sozialdemokraten zusammen mit den bürgerlichen Parteien im sogennanten Burgfrieden die militärischen Massnahmen zur Verteidigung der Schweiz gutgeheissen und für die Dauer des Krieges auf politische und gewerkschaftliche Kampfmassnahmen verzichtet. Barth hatte schon zu Beginn des Krieges in seinen Vorträgen130 das «Versagen»131 von Christen und Sozialisten angeprangert, weil sie den Krieg nicht verhindert hatten. Dass nun das Nationale, also ein «nationaler Sozialismus» und ein «nationales Christentum»132 im Vordergrund stünden, habe Christentum wie Sozialismus pervertiert.
Es gelang der Schweiz, sich aus den Kriegshandlungen herauszuhalten. Das rohstoffarme, hochindustrialisierte Land war allerdings wirtschaftlich durch den Krieg stark betroffen. Bei Ausbruch des Krieges hatte der Bundesrat die Generalmobilmachung der Armee beschlossen und damit die ökonomische Situation der Arbeiterbevölkerung verschlechtert. Durch Verhandlungen mit beiden kriegführenden Parteien hatte man nur eine minimale Versorgung mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln sicherzustellen versucht. Trotzdem wurde keine Lebensmittelrationierung beschlossen. Eine Lohnausfallentschädigung während des Militärdienstes gab es nicht. Lohnkürzungen, unentschädigte Überstunden, Sonntags- und Nachtarbeit waren die Folge der Aussetzung des Fabrikgesetzes.
Der Graben zwischen Deutschschweiz und Westschweiz verstärkte sich, weil man in der Westschweiz die Deutschfreundlichkeit der Deutschschweizer fürchtete. Barth weist an anderer Stelle verschiedentlich auf diese Gefahr hin, betont die Wichtigkeit der Neutralität auch für den inneren Zusammenhalt der Schweiz.133 |60|
Der Militärdienst – das Warten an der Grenze, aber auch der Drill der Offiziere, die deutsches Militär zum Vorbild genommen hatten, als Schikanen wahrgenommen – drückte auf die Moral, der Ersatz der Männer durch Frauen in der Industrie ging nochmals zulasten der Familien. 1917 wurde der Burgfrieden von den Sozialdemokraten faktisch aufgekündigt. Die sozialen Probleme stärkten die Gewerkschaften und die sozialdemokratischen Parteien, deren Mitgliederzahlen stiegen. Seit November 1917 entluden sich die Spannungen in Form von gewaltsamen Unruhen, Streiks und Demonstrationen.
Der Landesstreik vom November 1918 gilt als Höhepunkt der politischen Konfrontation zwischen dem «Bürgerblock», den traditionellen liberalen und konservativen Kräften, und der Arbeiterbewegung. Im Juli 1918 hatte der Schweizerische Arbeiterkongress dem sogennanten Oltener Komitee die Vollmacht erteilt, einen Generalstreik auszurufen.
1918 wurden dem Bundesrat folgende konkrete politische Forderungen gestellt:
Neuwahl des Nationalrates nach dem Proporzsystem
Frauenstimmrecht
Einführung einer Arbeitspflicht
Beschränkung der Wochenarbeitszeit (48-Stunden-Woche)
Reorganisation der Armee zu einem Volksheer
Ausbau der Lebensmittelversorgung
Alters- und Invalidenversicherung
Verstaatlichung von Import und Export
Tilgung der Staatsschulden durch die Besitzenden
Staatsmonopole für Import und Export
Der Bundesrat reagierte auf diese Forderungen mit militärischen Drohungen. Das Aktionskomitee rief am 7. November 1918 zu einem Proteststreik auf, der am Samstag, 9. November, in 19 Industriezentren ruhig verlief. Die Arbeiterunion in Zürich setzte den Streik fort, der Bundesrat bot Militär auf, es kam am 10. November zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Militär, worauf das Oltener Aktionskomitee für den 12. November zu einem unbefristeten, landesweiten Generalstreik aufrief.
Am 11. November organisierten Arbeitnehmer und Sozialisten lokale Streiks und Blockaden. Schliesslich beteiligten sich gegen 400’000 Arbeitnehmer an den Bestreikungen ihrer Betriebe. Fabriken, öffentliche Verwaltung, Eisenbahnen und Zeitungsdruckereien standen in den meisten Orten der Schweiz still. Der Bundesrat forderte den sofortigen Streikabbruch und liess Zürich, Bern und weitere Zentren militärisch besetzen. Auch die Eisenbahn wurde militarisiert, d. h. durch Soldaten betrieben.|61|
Zum Einsatz kamen vor allem Angehörige von Bauernregimentern, etwa aus dem Emmental. An verschiedenen Orten kam es zu Zusammenstössen, in Grenchen wurden am 14. November drei Arbeiter erschossen.
Bald wurde allerdings sichtbar, dass die Streikparole nicht über die organisierten Arbeiter und Angestellten hinaus zu wirken vermochte, und das Komitee erkannte die Ausweglosigkeit der Aktion. Es befürchtete, dass aufgrund des militärischen Aufmarsches jedes Festhalten am Streik zu weiterem Blutvergiessen führen würde. Deshalb befahl es nach drei Tagen den Abbruch des Streiks mit der Formulierung: «Der Landesstreik ist beendet, der Kampf der Arbeiterklasse geht weiter.» Die Arbeiterschaft fühlte sich da allerdings um ihren Erfolg betrogen.
In einem öffentlichen Verfahren wurden die Hauptakteure des Oltener Aktionskomitees zu Gefängnisstrafen von vier Wochen bis sechs Monaten Dauer verurteilt.
Barth hatte sich in einem Referat im Arbeiterverein Safenwil zum Landesstreik geäussert, und diese Äusserungen hatten in der Kirchenpflege zu lebhaften Auseinandersetzungen geführt, auch weil sie wohl z. T. entstellt wiedergegeben wurden. Im Versuch der Richtigstellung heisst es dann: «Der Pfarrer hat den Generalstreik nicht verherrlicht, wohl aber die Ansicht vertreten, er sei eine notwendige Folge der allgemeinen Lage.» Barth hatte die Anwendung von Gewalt als «vom Bösen» bezeichnet, aber doch die Frage gestellt, wer denn zuerst Gewalt angewendet habe: «Die Freiheit, solche Erwägungen auszusprechen, wo es sei, kann sich der Pfarrer nicht beschneiden lassen»134.
Abschliessend kann man feststellen, dass die politischen Forderungen des Landesstreiks nach und nach fast alle erfüllt wurden, wenn auch z. T. erst 1948 (AHV) oder 1971 (Frauenstimmrecht). Seine politische Bedeutung ging weit über die Zwischenkriegszeit hinaus, waren doch die Massnahmen der Regierung im Zweiten Weltkrieg (rechtzeitige Lebensmittelrationierung, Erwerbsersatz für Soldaten) vielfach der Angst vor der Wiederholung bürgerkriegsähnlicher Zustände zu verdanken.
Was aber die soziale Lage weiter Kreise der Bevölkerung in der Nachkriegszeit angeht, so blieb sie weiterhin prekär, die Weltwirtschaftskrise brachte nochmals eine Verschlechterung. Der Graben zwischen Sozialdemokratie und den bürgerlichen Kräften war vertieft worden; man hat von einer Stigmatisierung der Linken gesprochen, auch wenn die bald folgende Einführung des Proporzwahlrechts auf nationaler Ebene das politische Kräfteverhältnis deutlich zu ihren Gunsten verändern sollte.|62|
Diese Polarisierung zwischen den politischen Kräften dürfte für die weitere Haltung Barths eine wesentliche Rolle gespielt haben und sie war auch Grundlage der Kritik, die bürgerliche Kreise dem «roten Pfarrer» entgegenbrachten.