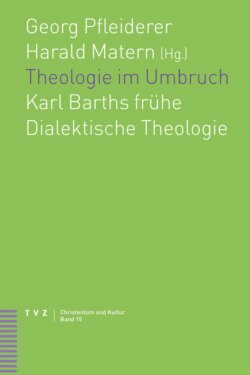Читать книгу Theologie im Umbruch - Группа авторов - Страница 8
1. Theologie der Krisen
ОглавлениеDie dialektische Theologie des Basler Theologen Karl Barth hat sich in Auseinandersetzung mit den grossen gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und religiös-theologischen Krisen des 20. Jahrhunderts entwickelt. Ihr – ihrerseits dialektisches – Spezifikum kann man darin sehen, dass es gerade diese Intensität der Auseinandersetzung mit ihrer so krisenreichen Zeit ist, die Barths Theologie zu einer immer stärker das eigentümlich Theologische betonenden Denkform geführt hat. Zudem hat Barth – wiederum in eigentümlich dialektischem Verhältnis zu jener Signatur der Zeitläufte – auch inhaltlich mehr und mehr die Überlegenheit Gottes betont, die gerade darin bestehe, dass sich Gott der Menschheit und ihrer Geschichte mit ihren krisenhaft-katastrophalen Verwicklungen und Verstrickungen heilsam zuwende. «Hominum confusione et Dei providentia Helvetia regitur.» Der alte Schweizer Wahlspruch gehörte für den krisengewohnten, Krisen nicht scheuenden, auch von persönlichen Krisen nicht verschonten Basler Theologen zeitlebens zu seinen Lieblingszitaten.1
Die sensible Wahrnehmung der Krisenhaftigkeit der Zeit, in der nach Barths Dafürhalten die Krisenhaftigkeit des Menschseins überhaupt aufscheint, und die dialektische Strukturierung der Theologie gehören bei Barth also aufs Engste zusammen.2 Mit dieser spezifischen Signatur ist ferner verbunden, dass diese eine dialogische, also dem Genre nach eine rhetorische |8| Dialektik ist. Barths Theologie entwickelt sich stets in Auseinandersetzung mit bestimmten anderen – theologischen und oft auch aussertheologischen – Positionen. So wie das Wort Gottes von ihm als den Menschen direkt ansprechende und in Anspruch nehmende Grösse verstanden und gefasst wird,3 so ist auch seine Wort-Gottes-Theologie – unerachtet ihres gerade in der späteren Phase der «Kirchlichen Dogmatik» mehr und mehr monologisch-monolithischen Erscheinungsbildes – eine in hohem Masse dialogische, sich auseinandersetzende, sich wehrende, aber vor allem auch um Verständnis und Teilnahme werbende und nicht zuletzt eine sich in solchen Auseinandersetzungen, auch in der kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst, weiterentwickelnde Theologie.
Die Brunnenstube dieser solchermassen mehrfach und mehrdimensional dialektischen Theologie liegt zweifellos im Zeitraum des Ersten Weltkriegs und seinem unmittelbaren zeitlichen Umfeld. In der Auseinandersetzung mit dieser ersten grossen allgemeinen, ja totalen4 Gesellschaftskrise des 20. Jahrhunderts formt und formiert sich die Theologie Karl Barths als dialektische Theologie. Aber, und darin scheint das dialogische Element jener Dialektik auf: Es sind bekanntlich nicht so sehr die Kriegsereignisse als solche, die Barths Denken im Herbst 1914 in eine neue theozentrisch orientierte Bewegung setzen, sondern sehr viel mehr die Reaktionen seiner ehemaligen deutschen theologischen Lehrer auf den Krieg. Beides zusammen – die Dramatik des Krieges und die Reaktionen darauf – zeigen für ihn die |9| Grenzen jeder Erlebnistheologie auf, und es beginnt ein Suchen nach einer neuen theologischen Sprache. Diese Suche wird zunehmend radikaler, denn es zeigt sich für Barth bald, dass auch die zweite, für ihn zu diesem Zeitpunkt noch massgebliche Bezugsgruppe, nämlich die Religiösen Sozialisten, aus seiner Sicht keine adäquaten Antworten auf die – theologischen – Herausforderungen der Gegenwart zu geben vermögen.
Alle diese Zusammenhänge sind inzwischen recht gut erforscht. Dem jungen Barth und der Entwicklung seiner dialektischen Krisentheologie hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine intensive, vor allem, aber keineswegs nur deutschsprachige Forschung zugewandt; und es sind auch mancherlei mehr oder weniger heftige Positions- und Schulkämpfe um die Deutung und Deutungshoheit dieser für das Spätere so wegweisenden Entwicklungsphase des Barthschen Denkens ausgetragen worden. Die entsprechenden Debatten fanden freilich auf der Basis einer in gewisser Hinsicht noch eingeschränkten Quellenlage statt: Das entscheidende tool, nämlich eine historisch-kritische Edition aller – publizierten und vor allem auch unpublizierten – Texte Barths aus jener Ära hatte bisher noch gefehlt. Barths «Vorträge und kleinere Arbeiten 1914–1921» waren noch nicht veröffentlicht. Eben dies hat sich jetzt geändert; und darum ist eine neue Sichtung dieser Zusammenhänge nun möglich, aber auch erforderlich.
Aufgrund der kritischen Edition ist jetzt erkennbar, in welchem Masse Barths Texte in konkreten Auseinandersetzungen mit einzelnen Personen und in damals geführten Debatten entstanden sind, viele davon mit einigem Lokalkolorit, aber mit nicht minder allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung. Eine auf solche Zusammenhänge achtende Sichtung sollte in einer ersten und gewiss noch alles andere als abschliessenden Weise im Rahmen einer Basler Vernissage-Tagung vorgenommen werden, die unmittelbar nach Erscheinen jenes Bandes im November 2012 stattfand.
Ähnliches gilt, wenngleich mit grossen Abstrichen, auch für Barths Hauptwerk aus jener Epoche, nämlich für seinen «Römerbrief» in der zweiten Auflage von 1922. Zwar war der Text als solcher wahrlich bekannt; aber eine historisch-kritische Edition dieses Textes ist doch erst jetzt, nämlich seit 2010, verfügbar.5 Dass die darin enthaltenen Verweise auf zeitgeschichtliche Kontroversen und nähere und fernere intellektuelle und kulturelle Zusammenhänge und Bezüge, vor deren Hintergrund und in die hinein auch und gerade dieses vermeintlich so monolithische, ja erratische Werk des Römerbriefkommentars geschrieben und darum auch zu lesen ist, die Forschung |10| weiterbringen werden, steht zu erwarten. Insbesondere können Fernerstehende, die sich nicht die Mühe der eigenen Erkundung jener zeitgeschichtlichen Diskurszusammenhänge machen können oder wollen, auf neue Weise an gerade diesen Text herangeführt werden.6
Der Erste Weltkrieg war auch für ein nicht kriegführendes Land wie die Schweiz eine enorme Belastungsprobe für die Leistungsfähigkeit von Institutionen, sozialen Verbänden, Individuen und Familien, aber auch und darin für die Kohärenz der Gesellschaft insgesamt. Einerseits wurden die grossen sozialen Spannungen und Ungleichheiten, welche die teilweise rapide und radikale Industrialisierung der Schweiz in der Vorkriegszeit mit sich gebracht hatte, während der Kriegsjahre verschärft und ausgeweitet, andererseits wurde ihre politische Bearbeitung weitgehend sistiert. Darum kamen sie im sogenannten General- oder Landesstreik von 1918 zum offenen Ausbruch. Karl Barth hat diese Abläufe als SPS-Mitglied intensiv mitverfolgt und in zahlreichen Auftritten im Rahmen seiner Möglichkeiten mit zu beeinflussen versucht. Die betreffenden Redemanuskripte und -skizzen, die sogenannten «Sozialistischen Reden», deren Publikation lang ersehnt war, liegen jetzt endlich vor.
Ob die wissenschaftliche Rezeption dieser wie der übrigen nun edierten oder neu edierten Texte Barths aus diesen Jahren das Bild und Verständnis seiner Theologie und theologischen Entwicklung in diesem Zeitraum entscheidend verändern wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird man die verschiedenen Stränge von Barths Theologie, ihre zeitkritischen und sozialethischen Dimensionen auf der einen Seite und ihre immer deutlicher die Form einer dialektischen, bibelbezogenen Wort-Gottes-Theologie annehmende Erscheinung auf der anderen Seite, nicht mehr unabhängig voneinander deuten dürfen. In dem Masse, wie solche Zusammenhänge und Verwobenheiten nun plastischer denn je greifbar werden, dürften sich einseitige Lesarten verbieten, die Barth in diesen Jahren entweder insgesamt als Sozialisten verstehen wollen oder aber seine theologische Entwicklung rein ideengeschichtlich, aus intellektuellen Gesprächen und Selbstgesprächen mit philosophischen und theologischen Positionen der näheren oder ferneren Theologie- und Philosophiegeschichte zu deuten suchen oder aber in einem einsamen, unmittelbaren und vermeintlich von allen zeitgenössischen Brillen weitgehend freien Blick in die Bibel begründet sehen.
Zugleich wird es erforderlich werden, bisher probate Beschreibungen solcher zeitgenössischer Tinkturen der Barthschen Texte wie etwa die Etikettierung |11| des zweiten «Römerbriefs» als expressionistisches Dokument genauer zu explizieren. Expressionismus ist eben, wie im vorliegenden Band Folkart Wittekind eindrucksvoll aufzeigt, nicht einfach eine kunsthistorische Kategorie, die in der ordnenden Rückschau einen bestimmten Phänotypus damaliger künstlerischer und literarischer Produktionen markiert. Expressionismus ist vielmehr als Kürzel für zeitgenössische Debatten zu begreifen, die sehr genau auf die Aufgabe der Kunst und Literatur (und unter Umständen auch der Wissenschaft!) in der Umbruchsituation der Moderne reflektieren. Vor diesem Hintergrund sind Barths Texte nicht lediglich als theologische Ausdrucksversion expressionistischer Kunst, sondern zugleich und vielmehr als reflektierte und theologisch reflektierende Beiträge zu jener zeitgenössischen kunsttheoretischen Debatte zu lesen.
Die Aufgabe, die sich also stellt, dürfte darin bestehen, Barths Theologie und theologische Entwicklung noch sehr viel genauer als bisher in der Regel üblich und möglich vor dem Hintergrund jener Diskurse zu interpretieren, in denen die Krisenhaftigkeit der Moderne in diesen Jahren von aufmerksamen Zeitgenossen selbst wahrgenommen und zu verarbeiten versucht wurde. In dem Masse, in dem dies gelingt, wird die Grösse, aber werden auch die unvermeidlichen Grenzen von Barths Krisentheologie jener Jahre noch sehr viel genauer als bisher zum Vorschein gebracht werden können.
Dass die beiden neuen Editionen einen Quantensprung für die Quellenlage bedeuteten, der es erforderlich machte, alle vor 2011 erschienenen Arbeiten der neueren Barthforschung in neuen Auflagen zu überarbeiten, soll aber gleichwohl nicht behauptet werden. Ihre Leistung dürfte vor allem darin bestehen, dass sie den Spezialistinnen und Spezialisten das Auge fürs Detail schärfen, ihnen aber auch die Grenzen allzu fachwissenschaftlicher Spezialisierung und die Notwendigkeit verstärkter interdisziplinärer Zusammenarbeit aufzeigen und sie (so) zugleich grössere Zusammenhänge leichter als bisher erkennen lassen. Fernerstehenden sollte es nun schwerer fallen, allzu einfache Deutungsmuster der Barthschen Theologie in den oben angedeuteten Richtungen weiter zu verfolgen, und sie stattdessen ermuntern, die Differenzierungsleistungen neuerer Barthforschung intensiver zur Kenntnis zu nehmen.
Im vorliegenden Band werden in dieser Richtung und Hinsicht – nur, aber immerhin – erste Schritte unternommen. Die darin versammelten Texte gehen grösstenteils auf Vorträge zurück, die an drei Vernissage-Veranstaltungen der Theologischen Fakultät der Universität Basel anlässlich von Neuerscheinungen der Karl-Barth-Werkausgabe zwischen 2011 und 2013 gehalten wurden.
Sechs Beiträge des Bandes, nämlich diejenigen von Hans-Anton Drewes, Regina Wecker, Andreas Pangritz, Georg Pfleiderer, Bruce McCormack und |12| Dirk Smit, haben ihren Ursprung in der gut besuchten, auch medial viel beachteten7 Tagung, die von der Basler Theologischen Fakultät Basel in Zusammenarbeit mit der Karl Barth-Stiftung und dem Karl Barth-Archiv am 9. November 2012 aus Anlass der Edition der «Vorträge und kleineren Arbeiten 1914–1921» im Kollegiengebäude der Universität Basel veranstaltet wurde.
Der Beitrag von Cornelis van der Kooi wurde in der Vortragsform präsentiert beim «Symposium aus Anlass des 125. Geburtstags Karl Barths sowie der Neuedition des «Römerbriefs» (1922) im Rahmen der Gesamtausgabe», das am 6. Mai 2011 ebenfalls in Basel und von den gleichen Institutionen wie jene erstgenannte Tagung veranstaltet wurde. Der bereits erwähnte Text von Folkart Wittekind ersetzt im vorliegenden Band dessen Tagungsvortrag.8
In den «Vorträgen und kleineren Arbeiten 1914–1921» nicht enthalten ist naturgemäss Barths Hauptwerk aus diesen Jahren, sein erster Römerbriefkommentar von 1919. Da jedoch in diesem Band der Bogen von 1914 bis zum Römerbriefjahr 1922 komplett geschlagen werden sollte, hat Harald Matern eigens für diesen Zweck einen Beitrag zu jenem ersten «Römerbrief» verfasst, dem in der Forschung vielleicht immer noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet wird.
Formal in gewisser Weise als Anhang, inhaltlich als eine Art Ausblick, haben sich die Herausgeber des vorliegenden Bandes entschlossen, in diesen noch einen weiteren Aufsatz aufzunehmen, nämlich Michael Hüttenhoffs genaue Rekonstruktion der Auseinandersetzung zwischen Barth und führenden Vertretern der Bekennenden Kirche im Zeitraum zwischen November 1933 und Mai 1934. Auch dieser Aufsatz wurde in Vortragsform an |13| einem Basler Vernissage-Symposium vorgetragenen, das aus Anlass des Erscheinens von Barths «Vorträge[n] und kleinere[n] Arbeiten 1930–1933»9 am 15. November 2013 wiederum an der Universität Basel und von denselben Veranstaltern wie jene Tagungen ausgerichtet wurde.10 Zwar wird damit über den im Untertitel des vorliegenden Bandes signalisierten Zeitraum hinausgegriffen; zu Barths «früher dialektischer Theologie» kann sein Denken in den ersten 1930er Jahren, also in der Phase der «Kirchlichen Dogmatik» I/1 bzw. I/2, nicht mehr eigentlich gerechnet werden.
Mit der Aufnahme des Beitrags in den Band verbindet sich vielmehr der doppelte Interpretationsvorschlag, zum einen die oben skizzierte Sichtweise des integrativen Blicks auf die zeitdiagnostischen und genuin theologischen Elemente der Barthschen Theologie nicht nur an seinen frühen Texten zu praktizieren. Auch – und vielleicht gerade – die Texte der «Kirchlichen Dogmatik» sollten stärker vor dem Hintergrund der zeitgenössischen «Vorträge und kleineren Arbeiten» Barths und der dort aufscheinenden intensiven dialektisch-dialogischen Bezüge und Verstrickungen gelesen werden, als dies in der Regel bisher der Fall ist.
Der inhaltliche Teil des damit verbundenen Deutungsvorschlags ist, dass Barths Theologie möglichst in ihrer gesamten Ausdehnung, nicht nur in ihren Anfängen und in den wilden zwanziger Jahren, als «Theologie der Krise» gelesen werden möge, die spätestens mit KD I/1 in eine ruhigere, positiv-dogmatische Form, deren Architektur nicht selten mit der einer Kathedrale verglichen worden ist, überführt wurde. Auch in der allgemeinen Historiographik beginnt es sich einzubürgern, das 20. Jahrhundert insgesamt als «Zeitalter der Extreme»11 wahrzunehmen, als die Phase einer Moderne, die bis mindestens 1989, aber vielleicht bis in unsere Gegenwart hinein, aus spannungsvollen, antagonistischen und darum stets neue Krisen erzeugenden Extremen nicht herauskommt. Möglicherweise fehlt auch uns Heutigen noch der Abstand, um zu sehen, in welchem Masse Karl Barths dialektische Krisentheologie der heilsamen Zuwendung Gottes zu gerade dieser Welt das Kind ihrer – und unserer(?!) – Zeit (gewesen) ist. Wie dem auch sei: Jedenfalls sind die für die nächsten Jahre und Jahrzehnte geplanten und zu erwartenden Bände der «Vorträge und kleineren Arbeiten» Karl Barths, |14| die über das Jahr 1933 hinausführen, auch und vor allem aus diesen Gründen mit Spannung zu erwarten.