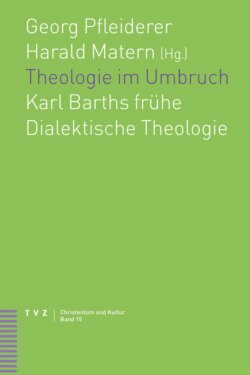Читать книгу Theologie im Umbruch - Группа авторов - Страница 26
1. Landesausstellung 1914
ОглавлениеLandesaustellungen haben Tradition in der Schweiz.111 Nach der Zürcher und der Genfer Ausstellung 1883 und 1886 war die Ausstellung in Bern die |52| dritte ihrer Art. Das Ziel bestand gemäss den Vorstellungen des Bundesrates darin, «ein vollständiges Bild der Leistungen des Schweizervolkes» zu bieten. Damit war natürlich vor allem die Leistungsfähigkeit der Schweizer Industrie gemeint. Die Schweiz gehörte zu den am frühesten und am stärksten industrialisierten Ländern Europas: 1910 waren etwa 44 Prozent der Erwerbstätigen im industriellen Sektor tätig. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Landwirtschaftssektor entsprechend an Bedeutung verloren und hatte nur noch gerade einen etwa gleich grossen Anteil wie der aufstrebende Dienstleistungssektor. Die Ikonographie der Ausstellung wies allerdings nicht auf die Bedeutung der Industrie hin: Das Plakat zeigt Reiter und Ross vor einer bäuerlich-idyllischen Landschaft, als Logo dient eine Ähre. Auch die Presse verwies weniger auf die Landesausstellung als Ort der Präsentation der wirtschaftlichen Leistung und der Innovationskraft der Schweiz. Vielmehr warb sie mit dem Charme der Schau, bei der ein traditionelles Unterhaltungsprogramm geboten werden sollte. Der Austragungsort war das «Dörfli» auf dem Berner Ausstellungsgelände, eine einheitliche architektonische Konzeption mit Kirche, aufgeteilt in reformierten und katholischen Teil.
Die Ausstellung sollte ursprünglich schon 1913 auch als Feier der Eröffnung der Bern-Simplon-Lötschberg-Strecke der Eisenbahn dienen. Damit ist nun wiederum auf die Zielsetzung der Zelebrierung der technischen Errungenschaften hingewiesen: Der Ausbau des Schweizer Eisenbahnnetzes war für die Industrialisierung ein wichtiger Faktor. Allerdings hatte es beim Bau des Lötschbergtunnels einen folgenschweren Unfall mit 25 Toten gegeben, der zur Verzögerung der Eröffnung der Strecke führte und damit auch die Verschiebung der Ausstellungseröffnung auf 1914 nötig machte. Das war aber nicht das einzige Problem. Es hatte im Vorfeld der Ausstellung einige für Landesausstellungen ungewöhnlich scharfe Auseinandersetzungen gegeben, die deutlich auf Probleme der Schweiz in dieser Zeit hinweisen. Die Westschweizer hatten sich nicht nur über das «Spinatross» lustig gemacht, ein anderes Logo verlangt und auch erhalten, sondern sie hielten sich auch darüber auf, dass die deutschen Aussteller zu stark vertreten waren und die Ausstellung in ihrem Stil zu stark auf die Deutschschweiz, ja mit dem «Style de Munich» auf Deutschland ausgerichtet sei. Einige Industrielle hatten einen Boykott erwogen, als der Auftrag zum Bau eines zweiten Simplontunnels an ein ausländisches Unternehmen ging. Zudem hatte der Konflikt zwischen dem auf Tradition bedachten Gewerbe und |53| der «profitorientierten» Industrie zu dieser skeptischen Haltung beigetragen. Schliesslich kritisierten Industrieunternehmer die «einseitige» Sozialpolitik des Bundes zugunsten der Arbeiterschaft, die in der Revision des Fabrikgesetzes zum Ausdruck gekommen sei, und die finanzielle Unterstützung, die der Auftritt des Arbeiterbundes erhalten sollte.
Hier werden also bereits Probleme sichtbar, die später in bei weitem heftigerer Form ausbrechen werden. Die Eröffnungsrede des Bundesrates versuchte diese Konflikte zu beschwichtigen: Bundespräsident Arthur Hoffmann wählte in seiner Eröffnungsrede «Lernen wir uns kennen!» als «Wahlspruch für unsere innerpolitischen Verhältnisse». Zielgerichteter drückte sich Bundesrat Gustav Ador aus, als er sich wünschte, «das ganze Volk» solle in der Landesausstellung erfahren, «dass man alles daran wenden muss, um den Antagonismus der Klassen zu vermeiden»112. Die Ausstellung wurde am 15. Mai eröffnet. Bei Beginn des ersten Weltkriegs und der Mobilmachung der Schweizer Armee wurde sie nicht abgebrochen, sondern nur für zwei Wochen unterbrochen und dann Mitte Oktober planmässig geschlossen. Hier wollte man sich nicht vom Krieg stören lassen.
Anders beim Fabrikgesetz. Die «Vermeidung des Klassenantagonismus» schien bei Ausbruch des Krieges nicht mehr so wichtig. Die Revision des Fabrikgesetzes, von den Unternehmern schon unmittelbar nach der Verabschiedung kritisiert, aber doch nicht durch ein Referendum infrage gestellt, also rechtsgültig, wurde bis nach dem Ende des Weltkrieges ausgesetzt und erst 1920 umgesetzt. Hier wird die Absicht des Bundesrates sichtbar, den Zusammenhalt der Bevölkerung eher durch eine Ausstellung der nationalen Errungenschaften zu erhöhen, als konkret die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiterschaft zu verbessern.