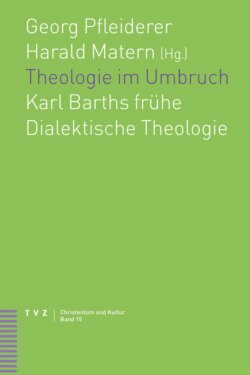Читать книгу Theologie im Umbruch - Группа авторов - Страница 21
VIII.
ОглавлениеDoch zurück zum «Leben im ‹Leben›», auf das diese Hoffnung hofft. Es ist für unser Verständnis der Explikationslinie, auf der sich Barths Theologie in diesen Jahren entfaltet, ausserordentlich aufschlussreich, dass wir dem Gedanken vom «Leben im Leben» – wenn nun auch in eine andere, durch den Austausch mit dem Bruder Heinrich Barth bestimmte Tonart transponiert – im Herbst 1919 wieder begegnen: Im Tambacher Vortrag «Der Christ in der Gesellschaft» vom 25. September 1919, den Georg Pfleiderer |41| zutreffend als die «Initialzündung der einflussreichsten theologischen Bewegung des 20. Jahrhunderts» bezeichnet hat.81 Im zweiten Teil des Vortrags, der den Standort feststellen soll, an dem sich Barth mit seinen Zuhörern befindet, wird die Formel vom «Leben im Leben» wieder aufgenommen: «einmal des Lebens im Leben bewusst geworden»82, schauen wir aus «nach einem wurzelhaften, prinzipiellen, ursprünglichen Zusammenhang unseres Lebens mit jenem ganz andern Leben» Gottes83. Es kann nicht anders sein: «der lebendige Gott», der uns nötigt, «auch an unser Leben zu glauben», bringt uns damit zum Leben – zum «Leben» in Anführungszeichen – «in kritischen Gegensatz».84 Unsere Seele ist «erwacht […] zum Bewusstsein ihrer Unmittelbarkeit zu Gott, d. h. aber einer verloren gegangenen und wieder zu gewinnenden Unmittelbarkeit aller Dinge, Verhältnisse, Ordnungen und Gestaltungen zu Gott»85. Eben dieses nie nur individuelle, immer auch soziale Erwachen der Seele ist «die Bewegung im Leben aufs Leben hin»86 – im Erstdruck hiess es noch kräftiger: «die Bewegung aufs Leben im Leben hin»87. Das Movens dieser Bewegung ist die Notwendigkeit, alles Leben «am Leben selbst zu messen»88. Damit und darin geschieht «die Revolution des Lebens gegen die es umklammernden Mächte des Todes»89, gegen «die tödliche Isolierung des Menschlichen gegenüber dem Göttlichen»90. An einer Stelle beschreibt Barth die Bewegung, die aus dem «kritischen Gegensatz zum Leben»91 entspringt – gemeint ist natürlich: aus dem kritischen Gegensatz zum Leben als «Abstraktum»92 –, als «Bewegung des Lebens in den Tod hinein und aus dem Tode heraus ins Leben»93.
Das scheint sich nun aufs engste zu berühren mit einer Aussage im Aarauer Vortrag «Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke» vom 17. April 1920. Barth spricht dort vom «eigentümlichen Rhythmus des Fortschritts: |42| aus dem Leben in den Tod – aus dem Tode in das Leben!, der uns im Mittelpunkt der Bibel entgegentritt»94. Die Verwandtschaft ist offensichtlich. Doch wir müssen genauer zusehen. Diese Aussage im Aarauer Vortrag bezieht sich ja zurück auf die Formulierung, die wie eine Devise, musikalisch gesprochen, die grosse Coda des Vortrags einleitet: «Aus dem Tode das Leben!»95 Schon wenn bei der Reprise in dieser Devise nur noch «Aus dem Tode das Leben!»96 hervorgehoben ist, wird klar, dass der Gedanke aus dem Tambacher Vortrag im Aarauer Vortrag wirklich eine Umwandlung erfährt. Das wird vollends dadurch deutlich, dass dieses Kernmotiv von den beiden Sätzen eingerahmt wird: «Die eine einzige Quelle unmittelbarer realer Offenbarung Gottes liegt im Tode.» Und:
«Das menschliche Korrelat zu der göttlichen Lebendigkeit heisst weder Tugend, noch Begeisterung, noch Liebe, sondern Furcht des Herrn, und zwar Todesfurcht, letzte, absolute, schlechthinnige Furcht.»97
Es ist deutlich: Das Wort Tod meint hier in seiner Grundbedeutung den Tod als radikales Ende, als wirklichen Tod. Tod meint nicht mehr, so wie Barth in Tambach in analoger Sprache ausgeführt hatte, «ein selbständiges Leben |43| neben dem Leben», das als solches eben «nicht Leben, sondern Tod» ist. Was Barth in Tambach einhämmerte, bleibt zwar wahr:
«Tot ist alles Nebeneinander von Teilen […]. Tot ist ein Innerliches für sich, ebenso wie ein Äusserliches für sich. Tot sind alle ‹Dinge an sich› […]. Tot sind alle blossen Gegebenheiten. Tot ist alle Metaphysik.»98
Aber jetzt in Aarau geht es nicht mehr um die vorauslaufenden Schatten des Todes, jetzt geht es – reduplicative, wie die Scholastiker sagen – um den Tod selber, es geht um «Gethsemane und Golgatha»99.
Es liegt danach auf der Hand, dass hier in Aarau mit dem gleichen Vokabular, ja mit den gleichen Sätzen etwas Neues, vielleicht sogar etwas «ganz Anderes» gesagt wird als ein halbes Jahr zuvor in Tambach. Man ist an das Bild von einem Handschuh erinnert, der umgestülpt worden ist: Es ist der gleiche Handschuh, aber er zeigt nun in den gleichen Umrissen eine ganz andere Gestalt – die Innenseite der Aussenseite als Aussenseite.