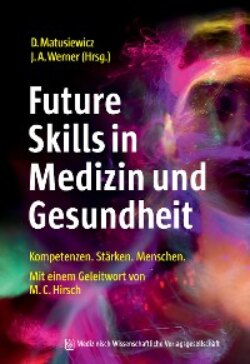Читать книгу Future Skills in Medizin und Gesundheit - Группа авторов - Страница 43
Оглавление8Intuition Peter Simon Fenkart
Die Universalgelehrte Hildegard von Bingen lebte im zwölften Jahrhundert. Mit dem Werk „Causae et curae“ (Ursachen und Behandlungen) (1957), das ihr zugeschrieben wird, setzte sie wissenschaftliche Zeichen. Sie trug das damalige Wissen der Heilkunde zusammen und interpretierte es in einer Weise, die Zeitgenossen als stimmig, nachvollziehbar und praktikabel erschien. Etwas, was gute Wissenschaft auch heute noch leistet, dort, wo sie sich als nutzbar erweisen möchte. Hildegard von Bingen ist bis in die heutige Zeit bekannt, in unserem digitalen Zeitalter. Vielleicht auch deshalb, weil ihre Lehre Elemente enthält, mit denen sich unsere moderne Heilkunde schwertut. Im vorliegenden Beitrag geht es um eine Komponente, die sich gerade in der Zeit der Digital Skills als entscheidend erweisen könnte. Aber kann es wirklich sein, dass unser modernes Gesundheitswesen von Ansichten profitieren kann, die vielfach als längst überholt gelten?
Hildegard von Bingens Werk trug mit dazu bei, dass beispielsweise die Kräuterheilkunde große Anwendung und Verbreitung fand, lange bevor die chemische Analyse von Pflanzenwirkstoffen zur heutigen Pharmazie beitrug. Soweit unbestritten. Interessant im vorliegenden Zusammenhang ist die Methode, mit der damals Erkenntnisse zu Wirksamkeit und Anwendung gewonnen wurden. Klinische Tests mit tausenden Probanden? Doppelblindstudien und Metaanalysen? Keinesfalls – „Überlieferung“, so lautet ein Erklärungsversuch. Doch das ist keine zulässige Methode um Erkenntnisse zu gewinnen, denn irgendwie musste das Wissen ursprünglich geerntet werden.
Versuch und Irrtum, so wird vielfach angenommen, soll dazu geführt haben. Wie sollten wir uns das vorstellen? Eine Person hatte ein Leiden und jemand, der dadurch heilkundig werden sollte, hat einfach gedacht: „Jetzt probiere ich mal Brennnessel aus. Und wenn das nicht wirkt, dann eben alle anderen Kräuter, die es gibt“. Das erscheint nicht wirklich praktikabel. Es muss noch einen anderen Faktor gegeben haben.
Welche seltsame Methode ersetzte damals unzählige Versuchsreihen, automatische Testverfahren und umfangreiche Wirkungsstudien?
Es muss eine Art Spürsinn sein, der beim Untersuchen – hier von Pflanzen – beim Probieren, Schmecken, dem Austesten der Wirkung, genau herausfindet, was sich dabei tut, wie der eigene Körper auf die Probe reagiert. Und der es ermöglicht, anschließend Schlüsse zu ziehen, wie die erlebte Wirkung beim Patienten anzuwenden ist. Eine Vorgehensweise, die in der digitalen Transformation nicht mehr praktikabel ist. Doch es gibt andere Aspekte dieses Sinnes, die sich auch heute noch als unverzichtbar erweisen.
Dieser Sinn muss ganz offensichtlich nach innen gerichtet sein, ins eigene Empfinden. Eine Fähigkeit, die es gerade in der heutigen Zeit schwer hätte, angesichts der gewaltigen Überflutung mit Außenreizen.
Beispielsweise können Patienten vielfach nicht angeben, wo genau ihnen etwas wehtut und wie es sich beschreiben lässt. Bauchweh kann damit so ziemlich jedes Organ zwischen Zwerchfell und Harnleiter betreffen. Angesichts der unzuverlässigen Mitwirkung von Patienten wäre anzuzweifeln, ob sich Diagnosen durch die digitale Transformation generell verbessern lassen, wenn nicht ein massiver apparativer Overkill erfolgt. MRT, CRT und ähnliches bei jedem Wehwehchen?
Es stellt sich die Frage: Ist die medizinische Diagnostik lediglich die Anwendung von erlerntem oder erfahrenen Wissen, also etwas, was sich irgendwann komplett automatisieren und digitalisieren ließe? Oder ist für gute Diagnostik noch weit mehr erforderlich? Was ist mit dem menschlichen Faktor? Ist er nur begrenzend, oder kann er auch Ergebnisse verbessern? Wenn ja, würde dies bedeuten, es gäbe einen Mehrwert, der nur von Menschen erbracht werden kann, nicht von Maschinen. Es lohnt sich, hier genauer hinzusehen.
In der TV-Serie Dr. House ist die namensgebende Person ein Arzt, wie ihn sich viele Fernsehzuschauer wünschen, denn er stellt aus kleinsten, scheinbaren Nebensächlichkeiten treffsicher die abenteuerlichsten Diagnosen. Dr. Jürgen Schäfer an der Uniklinik Marburg ging bereits vor über einem Jahrzehnt in einem Seminar den Fällen der fiktiven Gestalt nach, was von seinen Studenten begeistert angenommen wurde. Heute ist er Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen.
„Für diese Art der Diagnostik muss man sehr sensibel sein“, ist Schäfer überzeugt. „Man muss wahrnehmen, spüren, gut zuhören und auch scheinbar unwichtige Aspekte mit ins Kalkül ziehen.“ (Kleine 2019)
Da haben wir es wieder, schamvoll in der Aufzählung versteckt: „spüren“. Wohl auch deshalb, weil „Spüren“ als Begriff so schlecht fassbar zu sein scheint. Dabei ist es die natürlichste Sache der Welt. Ohne unseren Spürsinn, die Intuition, wären wir verloren in dieser Welt, würden wir nicht verstehen, was wirklich wichtig ist. Bevor Ihr Widerspruchsgeist hier aufsteigt: Ich werde versuchen, diese These im Folgenden zu belegen.
Intuition gilt als zufällig und unzuverlässig, und wird gerade von rationalen Menschen eher abgelehnt. Erst wenn man sich näher mit dieser Gabe beschäftigt, die uns Menschen angeboren ist, beginnt man die Nützlichkeit zu erkennen.
Ein Beispiel: Viele Menschen haben „Einfälle“. Das geht von einer Idee, die plötzlich im Bewusstsein auftaucht, bis hin zum Geistesblitz, begleitet von der Empfindung, dass einem etwas Großartiges „eingefallen“ ist. Normalerweise ist der Verstand, das Bewusstsein, eine Fertigungsstätte, in der Gedanken auf der Werkbank liegen, untersucht und mit anderen Gedanken zusammenmontiert werden. Man nennt das assoziieren und kombinieren. Im Gegensatz dazu taucht ein Einfall einfach so auf, ohne bewusstes Tun. Man kennt das alle aus eigenem Erleben. Interessant ist die Antwort auf eine Frage, die sich kaum einer stellt, der dergestalt beschenkt wurde: Wer oder was hat diesen Einfall ins Bewusstsein geworfen?
Es war die Intuition, unsere Fähigkeit, Informationen aus dem Unbewussten zu erhalten. Dort sind all unsere Erfahrungen, vor allem auch Sinneseindrücke und Erfahrungen, an die wir uns nicht bewusst erinnern können, nicht einfach nur gespeichert, sondern in einer Weise aufbereitet, welche die benötigten Informationen zur richtigen Zeit bereitstellt, dann, wenn sie aktuell gebraucht wird. Dort, wo der Chirurg durch jahrelanges Praktizieren sein „Muskelgedächtnis“ aufgebaut hat, sind auch unsere Soft Skills verborgen, stets zum Abruf bereit.
Ohne diese Intuition hätten wir auch keinen gesunden Menschenverstand, eine Empfindung, die uns hilft, das Richtige zu tun, das, was wir wirklich wollen, tief in uns selbst.
Wie aber kann sich diese Intuition im täglichen Gesundheitsbetrieb als hilfreich erweisen? Der Schlüssel liegt in einer oft unbemerkten Funktion, die Intuition, auch innere Empfindung genannt, leistet. Sie ermöglicht die Empfindung von Bedeutung. Das ist weit sensationeller, als es zunächst erscheint.
Der Verstand allein hat einen Makel, der oft übersehen wird: Er versteht keine Bedeutung. Er arbeitet mit den Begriffen „Wert“ und „Zwang“ (auch: Gegebenheit, Voraussetzung). Der Verstand ist ein guter Verwalter, wenn es darum geht, zu orientieren und zu strukturieren. Er kann hervorragend bewerten, beispielsweise durch Zahlen und Vergleiche. Er erkennt und berücksichtigt auch unabänderlich erscheinende Umstände und Vorgaben. Er verhandelt auch, mehr oder weniger wirksam, die Erfüllung oder das Aufschieben eigener Bedürfnisse. Schließlich ist der Verstand das uns gegebene optimale Werkzeug, um Ziele zu erreichen. Doch alle reinen Verstandesziele sind von außen übernommen, um für sich selbst eine Empfindung zu schaffen, die bei einer anderen Person angenommen oder beobachtet wird. Der Verstand kann Ziele ansteuern oder erreichen, selbst finden kann er sie nicht. Dazu gehört Bedeutung, die sich nicht verstehen lässt, nur empfunden werden kann.
Der Unterschied zwischen Wert und Bedeutung lässt sich durch ein einfaches Beispiel erklären. Ein eigenes Kind, das man liebt, hat keinen bezifferbaren Wert. Es hat Bedeutung, das heißt: es bedeutet etwas, zumindest für den Liebenden. Bedeutung ist emotional, ist eine Empfindung. Der Verstand kann das nur hinnehmen und daraus Handlungen ableiten.
Wissen und Wert lassen sich hervorragend digitalisieren, Bedeutung nicht. Sie müsste jeweils im Einzelfall programmiert werden, würde dann auch nur diesen Sonderfall abbilden. Auch moderne Verfahren, wie Neuronale Netze, können diese Bedeutung nicht generisch erzeugen, wohl aber der Mensch in seiner Erfahrung des Menschseins. Dort befindet sich auch für die digitale Transformation eine undurchdringliche Mauer, gleichzeitig auch eine großartige Chance für einen Classic Skill, der die Transformation wirkungsvoll ergänzt.
Wahres Wissen umfasst stets die Bedeutung des Gewussten. Denn ohne Bedeutung handelt es sich nicht um Wissen, lediglich um Informationen. So gesehen wissen Maschinen nichts. Sie verfügen nur über Informationen und Informationsverknüpfungen, die wir ihnen beigebracht haben.
Egal wie stark sich der Mensch durch Digitalisierung unterstützen lässt: Wenn es um Leben oder Tod geht, um Leib und Gesundheit, dann sollte die letzte Entscheidung, die endgültige Diagnose, von einem Menschen verantwortet werden. Ein Mensch, der idealerweise seinen Traditional Skill namens Intuition recht gut gebraucht und dann auch scheinbar nebensächlichen Symptomen eine Bedeutung zuordnen kann. Und dies trotz aller möglichen Irrtümer. Genialität stammt nicht aus Maschinen. Sie entsteht, indem aus uns eine Kraft entströmt, die durch Bedeutung getragen wird.
Im Zusammenwirken kann es eine abgerundete Ganzheit ergeben, ähnlich wie es einst Hildegard von Bingen formulierte:
„Und ich sprach und schrieb diese Dinge nicht aus Erfindung meines Herzens oder irgend einer anderen Person, sondern durch die geheimen Mysterien Gottes, wie ich sie vernahm und empfing von den himmlischen Orten.“ (von Bingen 2012)
Diese Mysterien offenbaren sich durch Intuition, einem Geschenk an uns Menschen, das wir alle erhielten und als Kind sehr gut zu gebrauchen wussten.
Heute wird die Intuition zum menschlichen Alleinstellungsmerkmal, zum bedeutsamen „Future Skill in Healthcare“, zum möglicherweise entscheidenden Faktor. Freilich müssten wir dann wieder vermehrt auf unsere Intuition setzen, was überraschend einfach ist. Wie bei anderen Fähigkeiten lässt sich Intuition einfach dadurch verbessern, indem sie angewandt wird.
Literatur
Hildegard von Bingen (1957) Heilkunde. Nach den Quellen übersetzt und erläutert von Heinrich Schipperges. Salzburg 1957. URL: http://kallimachos.de/fachtexte/index.php/Bingen_1957_-_Heilkunde (abgerufen am 05.02.2021)
Hildegard von Bingen (2012) Liber Scivias, Wisse die Wege. Beuroner Kunstverlag Beuren
Kleine L (2019) Deutscher „Dr. House“ gibt Menschen Hoffnung, deren Krankheiten niemand erkennt. Focus. URL: https://www.focus.de/perspektiven/mutmacher/der-krankheitsermittler-juergen-schaefer-hilft-menschen-mit-seltenen-erkrankungen_id_10264807.html (abgerufen am 15.01.2021)
Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen. URL: https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/umr_zuk/27241.html (abgerufen am 15.01.2021)
Peter Simon Fenkart
Peter Simon Fenkart studierte Informatik an der TU Karlsruhe und ist ausgebildeter Intuitions- und Mentalcoach, Autor mehrerer Bücher und Vortragsredner. Er berät führende Unternehmen in Industrie und Kommunikation. Mehr unter https://fenkart.consulting.