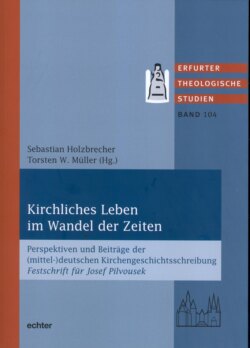Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 24
2.1 Zweiter Corveyer Fürstbischof 1795-1803
ОглавлениеAus Alters- und Gesundheits-Gründen wollte der erste Corveyer Fürstbischof Theodor von Brabeck den erfolgreichen und verwandten jungen Domicellar Ferdinand von Lüning am 16. November 1794 zu seinem Koadjutor wählen lassen. Doch als Fürstbischof Theodor von Brabeck schon am 25. Oktober 1794 verstarb, blieb dem neuen Corveyer Domkapitel vor dem Hintergrund der auf dem linken Rheinufer schon laufenden französischen Säkularisation der vormals deutschen Reichsbistümer (u. a. Köln, Lüttich, Mainz, Trier) am 16. Dezember 1794 nichts anderes übrig, als den 39-jährigen Domicellar Ferdinand von Lüning „per acclamationem“ zum zweiten Corveyer Fürstbischof zu wählen. Als Zeichen der noch bestehenden Reichskirche war bei dieser Fürstbischofswahl ein kaiserlicher Wahlkommissar anwesend gewesen, und es ist zu erinnern, dass der „Electus“ noch nicht einmal die Priesterweihe empfangen hatte. Wie es in der Reichskirche durchaus nicht unüblich gewesen war, erhielt Ferdinand von Lüning die päpstliche Bestätigung am 1. Juni 1795 von Papst Pius VI. (1775-1799), genauer mit der Auflage, die notwendigen niederen und höheren Weihen vor der Einführung nachzuholen.
Damit stand Ferdinand von Lüning im Alter von über 40 Jahren vor dem endgültigen und vollständigen Eintritt in den geistlichen Stand, ohne vorher Theologie studiert oder ein Priesterseminar besucht zu haben. Von dem benachbarten Fürstbischof von Hildesheim und Paderborn, Franz Egon von Fürstenberg († 1825)24, wurde Ferdinand von Lüning in Hildesheim binnen drei Tagen „hochgeweiht“. In diesem in der Epoche der Reichskirche durchaus auch schon vorher praktizierten Verfahren empfing Ferdinand von Lüning zunächst am 4. August 1795 die vier niederen Weihen (Ostiarier, Exorzist, Lektorat, Akolytat) und die Subdiakonatsweihe (mit der Verpflichtung der Ehelosigkeit). Am 5. August folgte die Diakonatsweihe und am 6. August wurde Ferdinand von Lüning zum Priester geweiht. Danach empfing der Priester Ferdinand von Lüning binnen Monatsfrist am 6. September 1795 im Münsterer Paulus-Dom die Bischofsweihe, die ihm gespendet wurde von seinem „ehemaligen Chef“, dem Kölner Kurfürsten und Erzbischof sowie Münsterer Fürstbischof25 Maximilian Franz zusammen mit seinem späteren Nachfolger im Bistum Münster, dem dortigen Weihbischof Caspar Max Droste zu Vischering (†1846),26 der am 1. Juli 1845 sein „Goldenes Bischofsjubiläum“ feiern sollte, was zu einem Aufbruchsereignis im westfälischen Katholizismus vor der März-Revolution 1848 wurde.27
Bis zur rechtsrheinischen Säkularisation der Reichskirche durch den Reichsdeputationshauptschluss vom Jahre 1803 konnte Fürstbischof Ferdinand von Lüning als zweiter Corveyer Bischof zusammen mit seinem Generalvikar Warinus Freiherr von Schade († 1824) gut sieben Jahre das kleine Fürstbistum regieren. Es hatte zwar nur 13 Pfarreien, aber Fürstbischof Lüning ließ ein eigenes Priesterseminar mit zwei Professorenstellen errichten.28 Ohne weiter auf seine Bistumsverwaltung eingehen zu können,29 sind aus den nun auch in Westfalen bewegter werdenden Jahren Eckdaten zu nennen, die zeigen, dass Fürstbischof Ferdinand von Lüning die Ereignisse nicht einfach über sich hereinbrechen ließ, sondern ein durchaus kirchenpolitisch handelnder Bischof war. Als der Regensburger Reichstag unter dem Druck Kaiser Napoleons zur Auflösung der Reichskirche zusammengekommen war, meldete Fürstbischof Lüning direkt am 2. Oktober 1802 die Bestandswahrung für das Corveyer Land und sein Fürstbistum an. Denn er wusste, dass nach einem preußisch-französischen Vertrag vom Mai 1802 Corvey als Entschädigungsland dem protestantischen Prinzen Wilhelm (V.) von Nassau-Oranien (1801-1802)30 zugesprochen worden war. Obwohl der Paragraf 35 des Reichsdeputationshauptschlusses alle Güter der fundierten Stifte der Disposition der Landesherren überwiesen hatte, konnte Fürstbischof Lüning erreichen, dass Corvey als Bistum in voller Funktion und der Bischof im Besitz aller seiner Rechte bleiben konnte. Doch bestand dieses nassau-oranische Land Corvey nur bis zum 31. August 1807. Dann kam Corvey zum französischen Königreich Westfalen unter dem jüngsten Bruder von Kaiser Napoleon, Jérôme Bonaparte, auch „König Lustig“ († 1860) genannt.
Auch in dieser neuen französischen Besatzungszeit konnte Fürstbischof Ferdinand Titel und Pension weiter behalten und führte in realpolitischer Einschätzung seine bischöflichen Amtsgeschäfte zeitweise von der neuen Hauptstadt des Königsreichs in Kassel aus. Dafür ernannte ihn König Jérôme von Westfalen im Jahre 1812 nicht nur zum Großalmosenier der Krone, sondern bezog ihn auch in die Pläne für die Neugestaltung der katholischen Kirchenverhältnisse im Königreich Westfalen ein. Danach sollte für das Königreich Westfalen ein neues Erzbistum errichtet werden aus den Territorien und mit den noch lebenden Domkapitularen der Bistümer Hildesheim und Paderborn sowie Corvey. Mit der Martini-Kirche in Kassel als neuer Domkirche wollte König Jérôme Fürstbischof Lüning zu seinem neuen Erzbischof machen.31 Dies wäre wohl für Ferdinand von Lüning der Kulminationspunkt seiner geistlichen Karriere geworden und hätte Westfalen einen ersten Erzbischof gebracht. Doch diese französischen Konkordatspläne waren nach der militärischen Niederlage Kaiser Napoleons in Russland im Winter 1812/13 gegenstandslos geworden, und Westfalen kam ab März 1815 an das Königreich Preußen. Der Wiener Kongress 1814/15 brachte zwar eine neue politische Ordnung für Europa, aber nicht die angestrebte kirchliche Neuordnung für Deutschland. Vielmehr ging nun die Regelung der Kirchenverhältnisse in die Zuständigkeit der Einzelstaaten im Deutschen Bund über.