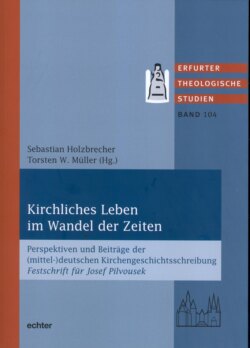Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 21
Fürstbischof Ferdinand von Lüning als Apostolischer Vikar für das Eichsfeld und Erfurt 1818-1823 Reimund Haas
ОглавлениеDie Thematik könnte mit der überraschenden Frage eingeleitet werden, wie es kam, dass ein Adeliger ohne Theologiestudium aus dem linken Rheinland, aus Gleuel bei Köln,1 für rund fünf Jahre der letzte Fürstbischof von Erfurt und dem Eichsfeld wurde. Es muss schon eine besondere Zeit und eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen sein, dass dies geschehen konnte. Ein erster Umstand der Epoche vor gut 200 Jahren war, dass es im Gefolge der Französischen Revolution (1789 und folgende Jahre) und der Säkularisation der deutschen Reichskirche (um 1803) nur noch wenige Bischöfe im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gab.2
Zu ihnen gehörte der im nordwestdeutschen Raum lange Jahre wenig beachtete Ferdinand von Lüning, zu dem der Verfasser im Jahre 1973 in einer Fußnote seiner Diplom- und Lizentiatsarbeiten noch feststellen musste: „Eine Biographie oder auch nur ein Lebensbild von ihm fehlen und ein Nachlass von ihm konnte nicht ausfindig gemacht werden.“3 Als der Verfasser dann im Jahre 1978 das posthume Werk von Beda Bastgen über die Besetzung der Bischofsstühle in Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einem Register herausgab, kamen darin nicht nur Ferdinand von Lüning, sondern auch das Eichsfeld und Erfurt mehrfach vor.4
Und mehr als zehn Jahre später in der Doktorarbeit über Domkapitel und Bischofsstuhlbesetzungen in Münster konnte nicht nur Lünings Bedeutung für das westfälische Bistum Münster erstmals ausführlich dargestellt werden, sondern vor allem seine grundlegende, überregionale und bis heute in Deutschland relevante Bedeutung für die staatskirchliche Finanzierung aufgezeigt werden. Denn während die preußische Regierung den Corveyer Bischof 1815/16 möglichst schnell durch Papst Pius VII. (1800-1823) nach Münster transferieren lassen wollte, um dort den kirchenpolitisch umstrittenen Kapitularvikar – und später auch in den „Kölner Wirren“ staatskirchenpolitisch hervorgetretenen – Clemens August Droste zu Vischering († 1845)5 auszuschalten, bestand Lüning zunächst darauf, dass die Dotation der Bischofskirchen, Domkapitel und Bistumseinrichtungen als Entschädigung für die Säkularisationsverluste vom preußischen Staat erst gesichert werden müssten. Gerade weil Lüning selbst aus der Säkularisation eine gesicherte Pension von 13.000 Talern pro Jahr bezog, war ihm die Sorge um die Existenzgrundlage seiner Amtsnachfolger ein besonderes Anliegen, so dass er dem Drängen der preußischen Regierung auf Amtsübernahme zunächst widerstand, bis die Sicherung durch die Zirkumskriptionsbulle „De salute animarum“ (16. Juli 1821) grundgelegt war. Als Jurist nahm Ferdinand von Lüning in kirchlichen Finanzfragen eine entschiedene Haltung ein, so dass es bis August 1820 dauerte, bis diese grundlegend gesichert waren und er endlich im Juli 1821 im Bistum Münster als erster Bischof nach der Säkularisation eingeführt werden konnte.6 So haben in den vormals preußischen Diözesen auch heute noch die Bischöfe und Domkapitel seiner Standhaftigkeit ihr gesichertes Einkommen zu verdanken.
Nachdem dieser Forschungsstand im Jahre 1987 in einem Artikel der Neuen Deutschen Biographie zusammengefasst werden konnte,7 hatte der akademische Lehrer des Autors, Prof. Dr. Dr. Alois Schröer (†2002)8, im Jahre 1993 im Handbuch des Bistums Münster den ersten Bischof der preußischen Zeit ausführlich beschrieben, sich dabei aber ganz auf die Münsterer Perspektive beschränkt.9 Im Unterschied zur älteren Forschung, die ihn als „schwachen“ Bischof im Verhältnis zum Staat dargestellt hatte, konnte in dem seit 2003 auch digital vorliegenden Artikel des Bibliographischen Kirchenlexikons10 differenziert werden: Während Bischof Lüning in den Finanzfragen eine kirchlich entschiedene Haltung dem preußischen Staat gegenüber einnahm, zeigte er sich in administrativen Fragen kooperativ und nahm zum 15. Dezember 1818 die Ernennung zum Apostolischen Administrator für Erfurt und das Eichsfeld an.11 Schließlich ist Ferdinand von Lüning in der Paderborner Bistumsgeschichte von Hans Jürgen Brandt und Karl Hengst zumindest beiläufig erwähnt worden.12
Sein Apostolisches Vikariat im Eichsfeld und in Erfurt war in der regionalen älteren Literatur nicht unbekannt,13 wurde aber in der allgemeinen bzw. neueren Literatur über diese kirchliche Umbruchphase nicht wahrgenommen, z. B. von Dominik Burkhard in seiner großen Habilitationsschrift über die Neuordnung der katholischen Kirche in Deutschland nach der Säkularisation, in der er die verschiedenen Bistumsprojekte von Rastatt skizziert hat von Kassel bis Oldenburg, das Eichsfeld-Erfurter Gebiet aber nicht erwähnt.14 Ebenso nennt Burkhard in seinem Überblick von 2005 über die Auswirkungen des Systemumbruchs der Säkularisation als Transformierungsprozess das Gebiet Eichsfeld-Erfurt nicht.15
Zuletzt hat sich um das Jahr 2005 – zum 180. Todesjahr von Fürstbischof Lüning – Günther Tiggesbäumker aus Corveyer Perspektive mit dem Lebenswerk von Bischof Lüning ausführlich beschäftigt.16 Und im Jahre 2011 hatte Arno Wand in seiner Geschichte der katholischen Kirche in Thüringen auf breiter Grundlage der Quellen des Preußischen Geheimen Staatsarchivs Berlin einige Aspekte des bischöflichen Wirkens von Fürstbischof Ferdinand vorgestellt, ohne näher auf den vorherigen Forschungsstand über seine Person einzugehen.17 Dazu konnten nun sowohl die einschlägigen kirchengeschichtlichen Quellen des Paderborner Erzbistumsarchivs18 als auch die Erfurter Überlieferung19 dank der freundlichen Unterstützung des Archivleiters Dr. Michael Matscha herangezogen werden, um zu Ehren des geehrten Erfurter Kollegen Josef Pilvousek erstmals eine Lebensskizze des letzten Erfurter Fürstbischofs Ferdinand von Lüning vorzulegen.