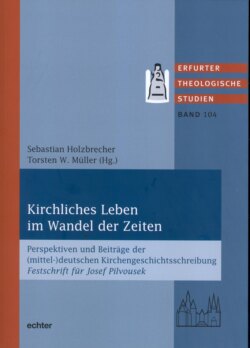Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 12
Religiöse Eliten in der Neuzeit. Ansätze zu einem internationalen und interkonfessionellen Vergleich Hubert Wolf
ОглавлениеWie Gott allgegenwärtig sei, so seien „auch seine Priester allgegenwärtig“, klagt ein liberaler Laie in dem Roman „Der Preßkaplan“, der Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Auflagen erlebte. „Sie begleiten die Gläubigen durch das ganze Leben. Schon bei der Geburt empfangen sie denselben durch die Taufe, sie unterrichten das Kind in der Schule, sie beeinflussen leitend den Jüngling und die Jungfrau in der Christenlehre und namentlich durch die Beichte, dieses Meisterwerk geistiger Verknechtung.“ Dabei sitze „der Priester an Gottes statt, ausgerüstet mit Gottes Vollmacht, … er hat die Gewalt auf Gemüth und Willen der Menschen, wie sonst keine Macht auf Erden. … Niemals wird die innige Verbindung zwischen Priester und Gläubigen aufgehoben. Sie dauert bis zum Sterbelager.“1
Der Autor dieses Romans war ein Priester, der sich ins Privatleben zurückzog und sich ganz der Schriftstellerei im Dienste an der katholischen Kirche widmete. Pius IX. zeichnete ihn mit dem Ehrentitel „Päpstlicher Geheimkämmerer“ aus.2 Die Macht des katholischen Klerus, die der liberale Laie im Roman beklagt, dürfte er begrüßt haben. Einig waren sich Autor und Romanfigur auch in ihrer Diagnose des klerikalen Einflusses: Alle Knotenpunkte im Leben eines Katholiken wurden von Priestern bestimmt, „von der Wiege bis zur Bahre“. Die Sakramente der Taufe, Firmung, Ehe und Krankensalbung sind den fundamentalen Lebenserfahrungen Geburt, Adoleszenz, Partnerschaft und Tod zugeordnet. Über diese für das Seelenheil unbedingt notwendigen Gnadenmittel der Kirche verfügte allein der Klerus, sieht man von der Nottaufe und dem Sakrament der Ehe ab, das sich die Partner gegenseitig spenden. Durch das Sakrament der Buße, vermittelt in der Ohrenbeichte, besaßen die Pfarrer nicht nur einen tiefen Einblick in das „Seelenleben“ ihrer Pfarrkinder, sondern zugleich ein äußerst wirksames Instrumentarium zur Kontrolle und Disziplinierung, das weit über den eigentlich religiösen Bereich hinausreichte.3 Außerdem prägten sie den Katholizismus als soziale Größe, hatten sie doch entscheidende Funktionen im gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und ökonomischen Leben inne. So galt die Wahl der katholischen Zentrumspartei als Glaubenssache, und viele Abgeordnete waren selbst Priester. Wer anders wählte, wurde nicht selten als halber Katholik diffamiert.4
Der Pfarrer fungierte nicht nur als Seelsorger im engeren Sinne, sondern zugleich auch als Lebenskontrolleur und „Milieumanager“5 mit umfassender Kompetenz. Die zentrale Bedeutung der katholischen Geistlichkeit weit über den eigentlich religiösen Bereich hinaus ist – wenn auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen – für Frühe Neuzeit und Moderne gleichermaßen evident.
Kaum eine andere, sozial klar abzugrenzende Gruppe dürfte über einen derartig langen Zeitraum einen vergleichbar umfassenden Einfluss auf das individuelle, politische und soziale Leben ausgeübt haben wie die katholische Geistlichkeit. Noch dazu war diese überstaatlich und zentralistisch in einer strengen Hierarchie organisiert, sodass sie, zumindest theoretisch, international abgestimmt handeln konnte. Und die Quellenlage ist ausgezeichnet. Die katholische Geistlichkeit bietet sich daher optimal für einen internationalen Vergleich in einer longue durée an. Doch zu berücksichtigen wären im Idealfall auch orthodoxe, protestantische, anglikanische, jüdische und islamische Eliten.
Dieser Vergleich stellt insbesondere mit Blick auf Europa ein dringendes Desiderat dar. Priester und andere religiöse Funktionsträger dürften einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in den Strukturen, Identitäten und Mentalitäten in den verschiedenen Staaten und Regionen Europas genommen haben. Wer die Faktoren kennenlernen will, die die europäische Integration begünstigen oder behindern, die eine gemeinsame europäische Identität grundlegen oder ihr im Wege stehen, wer Normen und Werte, Verhaltens-, Deutungs- und Wahrnehmungsmuster verstehen will, der muss sich ihres historischen Gewordenseins bewusst sein – und dabei kommt den religiösen Eliten eine herausragende Bedeutung zu. Nicht umsonst werden immer wieder das „christliche Abendland“ oder die „jüdisch-christlichen Werte“ bemüht, wenn es um die Ursprünge und die Identität Europas geht.6 Unter den „Europäischen Erinnerungsorten“ sind etliche religiös konnotiert,7 und Diskussionen über Europa haben im Katholizismus zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg eine wirkmächtige Tradition.8 Die Ursprünge des europäischen „Sonderwegs“ werden schon in religiösen Entwicklungen des Mittelalters gesucht.9 Aber auch mit Blick auf zukunftsweisende Entscheidungen werden Argumente religiös begründet, etwa in Diskussionen über den möglichen Beitritt der Türkei oder den Gottesbezug in einer europäischen Verfassung.10
Ein Vergleich von Status und Rolle der religiösen Eliten in verschiedenen Konfessionen und Staaten lässt in der Langzeitperspektive außerdem interessante Ergebnisse zu zentralen sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen erwarten. Um einen solchen Vergleich zu bewältigen, müssen aber auch hohe methodologische Hürden überwunden werden. All diese Religionsgemeinschaften sind von sehr unterschiedlichen Amtsverständnissen geprägt. Das zeigt schon ein Blick auf das Luthertum: Aus theologischer Perspektive gibt es, wenn man Luther folgt, bekanntlich gar keinen speziellen Klerikerstand. Das steht natürlich mit der katholischen Lehre und dem Selbstverständnis des katholischen Klerus im Gegensatz. Solche völlig unterschiedlichen theologischen Positionen erschweren einen Vergleich über Konfessionsgrenzen hinweg. Seit das Konfessionalisierungsparadigma hinterfragt worden ist, hat sich auch die Ansicht als problematisch erwiesen, dass Konfessionskirchen prinzipiell vergleichbar seien, weil in ihnen strukturelle Entwicklungen wenigstens teilweise parallel verlaufen.11
Um dennoch interkonfessionelle Fragestellungen zu ermöglichen, begeben sich Profanhistoriker relativ rasch auf eine soziologisch-funktionale Ebene. Sie betonen, dass die Rolle der evangelischen Pfarrer, ihr Status und ihre konkreten Aufgaben doch faktisch in vielem denen der katholischen Pfarrer entsprechen. Weil die theologischen Unterschiede im Amts- und Selbstverständnis bei der Geistlichkeit der westlichen Kirchen angeblich keine markanten Unterschiede in den Funktionen bewirkten, werden die seelsorgerlich tätigen Amtsträger jenseits aller konfessionellen Unterschiede durchaus als einheitliche Gruppe angesehen.
Ein solcher Zugang erscheint aus der Perspektive einer katholischen Kirchengeschichte, die sich als theologisches Fach versteht, verkürzt. Es dürfte plausibel sein, dass ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis von Kirche und kirchlichem Amt weitreichende Auswirkungen auf die Einflussmöglichkeiten der jeweiligen Amtsträger auf die Gläubigen haben muss. Denn ist nicht ein Katholik, der die Kirche und den geweihten Priester unbedingt braucht, um das Heil zu erlangen, in ganz anderer Weise von seinem Seelsorger abhängig als ein evangelischer Christ, dem sich die Heilige Schrift unmittelbar erschließt und der von den Prinzipien „sola scriptura, sola fide et solus Christus“ ausgehen muss? Ob es eine konfessionsübergreifende Sozialgruppe der religiösen Amts- und Funktionsträger wirklich gegeben hat, müsste in einem großen internationalen und interkonfessionellen Vergleich erst geprüft werden. Gleiches gilt schon für die These, dass diese religiösen Eliten dem Bürgertum zugehörig waren. Zweifel sind angebracht. Eigneten sie sich tatsächlich den bürgerlichen Habitus an, oder waren sie doch Repräsentanten einer Gegengesellschaft? Untersuchungen zu Herkunft und Habitus der katholischen Geistlichkeit in Deutschland zeigen für die sogenannte „pianische“ Epoche der Kirchengeschichte von 1850 bis 1950 dezidiert deren antibürgerliche Einstellung.12 Es ist davon auszugehen, dass es einerseits große Unterschiede innerhalb der einzelnen Konfessionen gab, andererseits aber auch Gemeinsamkeiten über konfessionelle Grenzen hinweg, die sich zum Beispiel durch nationale und regionale Eigenheiten erklären. Lief etwa die Rezeption „aufgeklärter“ oder „ultramontaner“ Ideale durch den katholischen Klerus in den unterschiedlichen Ländern Europas gleichzeitig und weitgehend parallel ab oder sind die jeweiligen sozialen und kulturellen Bedingungen für ganz unterschiedliche Ausprägungen dieser Ideale verantwortlich?
Die Frage nach theologischen Inhalten und deren konfessionsspezifischen Auswirkungen auf soziale und politische Strukturen sollten nicht nur Kirchenhistoriker grundsätzlich stellen, doch sind sie hier gegenüber kulturwissenschaftlich arbeitenden Profanhistorikern im Vorteil. Friedrich Wilhelm Graf ist zuzustimmen, wenn er formuliert, dass die historischen „analytischen Außenperspektiven auf religiöse Mentalitäten und der gelebte Glaube von Individuen niemals kongruent“ seien. „Der Glaube ist für einen frommen Menschen etwas qualitativ anderes als eine Funktion von x oder ein Nutzen für y.“ Konfessionsspezifische Frömmigkeitsmuster und somit auch Rolle und Funktion der Geistlichkeit kann man in der Tat „ohne theologische Deutungskompetenz“ nicht vollständig analysieren.13
Es ist im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich, den Forschungsstand zum Thema „Katholischer Klerus in Europa“ auch nur einigermaßen adäquat darzustellen und aufzuarbeiten. Allein die deutschsprachigen Publikationen zu diesem Thema sind Legion. Sprachliche Barrieren existieren vor allem, aber nicht nur mit Blick auf die slawischsprachigen, ungarischen und griechischen Publikationen. Die folgenden Ausführungen beschränken sich deshalb darauf, exemplarisch zu skizzieren, wie sich das Priesteramt in der katholischen Kirche entwickelte und dabei einige Themenfelder und Fragehorizonte vorzustellen, die sich für einen Vergleich über Epochen und Generationen, Staaten sowie Religionen und Konfessionen hinweg besonders anbieten. Zu berücksichtigen sind neben den drei Hauptvergleichsebenen Religion, Raum und Zeit auch weitere Differenzen wie die „cleavages“ zwischen Stadt und Land, Zentrum und Peripherie, verschiedenen sozialen Schichten sowie genderspezifische Unterschiede.14