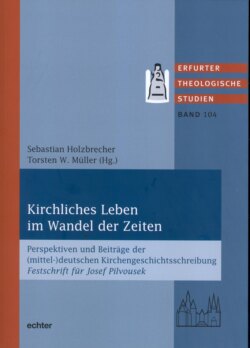Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 18
Religiöse Funktionsträger und Nationalismen
ОглавлениеAuch hier ist wieder das Thema „Religion und Gewalt“ zu berücksichtigen, da religiöse Funktionsträger zwangsläufig auch in Nationalitätenkonflikten und Kriegen zwischen Nationalstaaten Position beziehen müssen, etwa als Militärseelsorger oder wenn sie in ihren Gemeinden mit der Sinnfrage des Kriegs konfrontiert werden.90
Auch auf die „nationale Frage“ mussten religiöse Eliten als „Multifunktionäre“91 eine adäquate Antwort geben – ein Thema, dem überall in Europa nach der Französischen Revolution eine zentrale Bedeutung zukam.92 Für die Katholiken bedeutete sie eine besondere Herausforderung: Konnten sie loyale Bürger eines Nationalstaats sein, obwohl sie zugleich einer grundsätzlich transnationalen Organisation wie der Catholica angehörten, deren Zentrale aus Sicht der allermeisten Menschen im Ausland, in Rom, lag? Die Nationalisten waren jedenfalls misstrauisch angesichts der „katholischen Internationale“, die mit dem Jesuitenorden über eine weltweit agierende „mobile Eingreiftruppe“ verfügte. Das Problem der doppelten Loyalität verschärfte sich, wenn ein Staat wie etwa das Deutsche Kaiserreich von einer protestantischen Leitkultur dominiert wurde. Katholischen Priestern konnte deswegen bei der Entstehung der liberalen Nationalstaaten die undankbare Rolle zukommen, deren Verfechter in ihrem Antikatholizismus, Antiklerikalismus und Antijesuitismus zu einigen.93 Religiöse und nationale Identitäten konnten aber auch eng miteinander verflochten sein, wie es heute zum Beispiel in Polen und Irland, aber auch in zahlreichen, von orthodoxen Kirchen geprägten Ländern der Fall ist.
Nicht nur Kommunismus und Nationalsozialismus sind als „politische Religionen“ charakterisiert worden.94 Elias Canetti hat in „Masse und Macht“ vorgeschlagen, auch Nationen so zu betrachten „als wären sie Religionen“.95 Dahinter steckt die Überzeugung, dass es zur Konstruktion kollektiver Identität – zur Erfindung der Nation96 – des Bezugs auf gegebene symbolische Bestände bedarf, und dass die Erfinder der Nation „auf religiöse Symbolsprache angewiesen“ sind, um „eine emotional bindende, starke Vergemeinschaftung erzeugen zu können“97. Wenn diese Annahme stimmt, dann kann man mit Friedrich Wilhelm Graf zu Recht fragen: „Welche überkommenen theologischen Gehalte wurden auf den ‚neuen Gott‘ bezogen? Inwieweit lassen sich unterschiedliche Nationskonzepte auch nach ihren impliziten Theologien unterscheiden? Wie ist es zu erklären, dass in vielen europäischen Gesellschaften gerade die Repräsentanten der kirchlichen Institutionen, also die Pfarrer, und akademische Theologen Nationalismen propagierten oder Nationskonzepte entwarfen?“98
An diesem Punkt wird der besondere Charme der longue durée eines Vergleichs deutlich, die es beispielsweise auch erlaubt, Nations- und Konfessionsbildung zusammen in den Blick zu nehmen: Strukturell stehen ja ganz ähnliche Vorgänge zur Diskussion: Hier die Erfindung der Nation und ihre Durchsetzung – dort die Erfindung von Konfessionen und ihre Verkündigung bis in das letzte Dorf. Es wäre zu prüfen, ob und, wenn ja, unter welchen Umständen sich religiöse Funktionsträger ebenso für die Nation in Dienst nehmen ließen wie für ihre jeweilige Konfession.
Das Thema Nation spielte bereits in der Frühen Neuzeit eine wichtige Rolle.99 Sahen Protestanten die ideale deutsche Nation primär durch evangelische Traditionen bestimmt – Luthers Bibelübersetzung galt als Urdatum der deutschen Kulturnation –, so entwarfen Katholiken eigene Gründungsmythen und Kriterien guten Deutsch-Seins – etwa durch die Verehrung des Germanenmissionars Bonifatius. Gerade das führte aber im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert vonseiten der Protestanten zum Vorwurf, die Katholiken seien undeutsch, weil sie über Bonifatius versucht hätten, Deutschland der päpstlichen Hegemonie zu unterstellen.100
Vom Summepiskopat des evangelischen Landesherren, der zugleich als oberster Bischof seiner Landeskirche fungierte, zum Oberhaupt eines Nationalstaats von Gottes Gnaden war der Weg in der Tat nicht weit. Wo eine eigenständige Kirchenbehörde wie ein Bischöfliches Ordinariat fehlte, wo der Pfarrer immer schon als Landesbeamter fungierte, war der Übergang zum Agenten eines kulturprotestantisch begründeten Nationalstaats fließend. Für das deutsche Kaiserreich ist evident, dass vor allem evangelische Pfarrer religiöse Symbolbestände benutzten, um den Nationalstaat als gottgewollt auszugeben. Eine Letzthingabe an und eine Totalidentifikation mit dem Nationalstaat brauchten in der Tat religiöse Qualitäten, die zumindest in der Gründungsphase durch Pfarrer vermittelt werden konnten.
Hier wäre genau zu untersuchen, welche Aufgaben an die religiösen Funktionsträger herangetragen wurden, wie sich diese mit ihrem Selbstverständnis vertrugen und welche Rolle sie in Dorf, Stadt, Region und Nation tatsächlich spielten. Während das Thema „evangelischer Klerus und Nation“ bestens erforscht ist, mussten Heinz-Gerhard Haupt und Dieter Langewiesche in ihrem großen Sammelband „Nation und Religion in der deutschen Geschichte“ konstatieren, dass „ein Beitrag zum Verhältnis katholischer Klerus und Nation nicht zu gewinnen war“.101 Bei der Behebung dieses Forschungsdesiderats ist einerseits die Frage nach der grundsätzlichen „Nationsfähigkeit“ eines zu einer internationalen Institution gehörenden Amtsträgers zu stellen und andererseits zu differenzieren, ob die dem katholischen Pfarrer gegenüberstehende Nation ebenfalls katholisch, durch eine andere Religionsgemeinschaft geprägt oder religionsfeindlich eingestellt war. Der Katholizismus konnte nationale Identitäten gegen fremde Besatzungsmächte schützen wie in Irland102 oder gegen ideologische Besatzer aus dem eigenen Volk wie in Polen. In Belgien verbündeten sich Katholizismus und Liberalismus, um einen eigenen Staat aus den protestantisch dominierten Niederlanden herauszulösen. In Frankreich stritt man um die Rolle der Kirche zwischen den Alternativen „Thron und Altar“ oder „Katholizismus und Freiheit“. Und in all diesen Auseinandersetzungen waren katholische Pfarrer Hauptagenten.
Auch in Deutschland gerieten der neuentstandene, protestantisch dominierte deutsche Nationalstaat und seine katholische Minderheit mit dem Kulturkampf zunächst in einen heftigen Konflikt. Katholizismus und Moderne, katholische Kirche und moderner Nationalstaat, Glaubensbekenntnis und Grundrechte waren für inkompatibel erklärt worden. Der neue Nationalstaat fürchtete die „katholische Internationale“ und ihre Agenten.103 Deshalb hatten zahlreiche Kulturkampfgesetze vor allem die katholischen Pfarrer im Blick, wie etwa der Kanzelparagraph, das Brotkorbgesetz, die Anzeigepflicht und die Gesetze über wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen zeigen. Die starke Bekämpfung durch den protestantischen Staat trieb die Katholiken noch mehr in die Defensive und erschwerte eine Integration in das neue deutsche Kaiserreich über Jahrzehnte hinweg. Auf katholischer Seite kam es zur Bildung einer Gegengesellschaft; der diffamierte Pfarrer konnte seine Stellung als „Milieumanager“ aus der Defensive heraus stärken und sorgte oft dafür, dass Katholiken im Ghetto blieben. Erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs gegen den „Erzfeind“ Frankreich sorgte dafür, dass die Katholiken im Kaiserreich ankamen und die Zugehörigkeit zur deutschen Nation über die mit dem französischen Gegner gemeinsame Zugehörigkeit zur katholischen Kirche stellten.104 Grundsätzlich stand der deutsche Kulturkampf allerdings in einem internationalen Kontext,105 vergleichbare Auseinandersetzungen gab es auch außerhalb Europas, etwa in Mexiko, wobei sich oft religiöse, soziale, politische, ökonomische und allgemein kulturelle Konflikte überlagerten.106 Zu prüfen wäre insbesondere, ob auch Vertreter anderer Konfessionen mit dem Nationalstaat in Konflikt gerieten und was die Gründe dafür waren.
Anders strukturiert waren Konflikte, in denen religiöse Eliten zur Partei in nationalen Auseinandersetzungen wurden.107 Regionen wie das Baskenland, Elsass-Lothringen und Tirol zogen ihre eigene Identität nicht zuletzt aus sprachlichen Differenzen, besondere Bedeutung kommt dabei dem Begriff der „Heimat“ zu, wie Forschungen zu Südtirol gezeigt haben.108 Nationale und regionale Identitäten bildeten sich aber auch über andere „cleavages“ heraus: den Gegensatz von Stadt und Land, von Zentrum und Peripherie – und zwischen verschiedenen Religionen und Konfessionen oder verschiedenen Fraktionen innerhalb dieser Glaubensgemeinschaften.
Ein gutes Beispiel stellt der von katholischen Pfarrern propagierte baskische Nationalismus dar.109 Hier standen auf beiden Seiten der Front Katholiken, alle drei involvierten Gruppen wollten sich im Katholisch-Sein nicht von den anderen übertreffen lassen: weder die Basken noch die Spanier noch Rom. Den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung bildete ein Ritenstreit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Baskische Pfarrer kämpften gegen ihre von Zentralspanien eingesetzten Bischöfe für baskische Taufnamen der Kinder und damit für eine eigene nationale Identität. Gleichzeitig wurde von baskischen Katholiken eine neue Gesellschaftsutopie entworfen, das katholische „Euskadi“ als ideale Gesellschaft, als Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden, während man das ebenfalls katholische Spanien, welches das Baskenland unterdrückte, als Reich des Teufels ansah. Die ETA wurde am Gedenktag des heiligen Ignatius in einem Jesuitenkolleg gegründet, während andererseits Franco den Basken Ignatius zum Spanier machen wollte.
Interessant dürfte auch ein Blick auf die Reaktionen katholischer und evangelischer Pfarrer in Elsass-Lothringen auf den mehrfachen Wechsel der staatlichen Zugehörigkeit ihrer Heimat sein.110 Die Protestanten orientierten sich überwiegend am Deutschen Reich, die Katholiken überwiegend an Frankreich, wobei für sie offenbar die konfessionelle vor der nationalen Solidarität stand. Der katholische Klerus wirkte dabei massiv auf das Wahlverhalten der Gläubigen ein.
Völlig anders sah die Lage bis zum Ersten Weltkrieg in Osteuropa aus: Dort gab es keine Nationalstaaten, sondern multinationale Imperien, die religiös heterogen, aber nicht pluralistisch waren. So gehörte ein Großteil der Bevölkerung im Osmanischen Reich der Ostkirche an, aber der Islam war Staatsreligion. Die Orthodoxie war Staatsreligion im Zarenreich, aber diverse nichtrussische Nationen waren muslimisch, katholisch oder protestantisch. Im Habsburgerreich dominierte der Katholizismus, aber unter den Nicht-Titularnationen (Serben, Ukrainern, Rumänen) herrschten die Orthodoxie und die griechisch-katholische Kirche vor. Wie später beim Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens kam der Religion schon nach 1918 eine große Bedeutung für die Festigung nationaler Identitäten zu.
Schon diese wenigen Schlaglichter vermögen die Bedeutung religiöser Eliten im Allgemeinen und katholischer Priester im Besonderen für die Genese der europäischen Nationen und Europas anzudeuten. Die Frage nach den Ursprüngen der europäischen Identität stellt sich angesichts der aktuellen „Eurokrise“ drängender denn je. Um sie zu beantworten, muss aber auch die Geschichtsschreibung ihre nationalen und konfessionellen Fixierungen überwinden.
1 C. v. Bolanden, Der Preßkaplan. Erzählung für das Volk, Mainz 61890, 61f.; zitiert auch bei O. Blaschke, Die Kolonialisierung der Laienwelt. Priester als Milieumanager und die Kanäle klerikaler Kuratel, in: ders. / Kuhlemann, F.-M. (Hg.), Religion im Kaiserreich. Milieus, Mentalitäten, Krisen (Religiöse Kulturen der Moderne 2), Gütersloh 1996, 93-135, hier 100f.
2 Bolanden war ein Pseudonym des katholischen Priesters und Päpstlichen Geheimkämmerers Joseph Eduard Konrad Bischoff, vgl. Saarländische Biographien, online unter: <http://www.saarlandbiografien.de/Bischoff-Joseph-Eduard-Konrad> (letzter Aufruf: 26. November 2012).
3 Zur sozialdisziplinierenden Rolle des katholischen Klerus im Zuge der katholischen Konfessionalisierung vgl. W. Reinhard / H. Schilling, (Hg.), Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte 1993 (RGST 135), Münster 1995. Zum Amtscharisma und zu seiner Funktion vgl. auch T. Schulte-Umberg, Profession und Charisma. Herkunft und Ausbildung des Klerus im Bistum Münster 1776-1940 (VKZG.F 85), Paderborn 1999.
4 Vgl. C. Weber, „Eine starke, enggeschlossene Phalanx“. Der politische Katholizismus und die erste deutsche Reichstagswahl 1871 (Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens 35), Essen 1992.
5 Vgl. O. Blaschke, Kolonialisierung; M. Klöcker, Katholisch – von der Wiege bis zur Bahre. Eine Lebensmacht im Zerfall? München 1991.
6 Vgl. F. W. Graf / K. Große Kracht, Einleitung: Religion und Gesellschaft im Europa des 20. Jahrhunderts, in: dies., Religion und Gesellschaft. Europa im 20. Jahrhundert (Industrielle Welt 73), Köln u.a. 2007, 1-42; H. Kaelble, Europäische Identitäten, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 13 (2012) 141-146; D. Levering Lewis, God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570 to 1215, New York 2008.
7 P. d. Boer u. a. (Hg.), Europäische Erinnerungsorte, 3 Bde., München 2012.
8 A. Holzem, Deutsche Katholiken zwischen Nation und Europa 1870-1970. Europa- und Abendland-Perspektiven in Kulturdebatten und gesellschaftlicher Praxis im Spiegel jüngerer Publikationen, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 9 (2008) 3-29; A. Langner (Hg.), Katholizismus, nationaler Gedanke und Europa seit 1800, Paderborn 1985.
9 Vgl. M. Mitterauer, Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München 2003, insbesondere die Kapitel über „Papstkirche und universale Orden“, „Kreuzzüge und Protokolonialismus“ sowie „Predigt und Buchdruck“, aber auch die Ausführungen über die Eucharistieverehrung als „Schlüsselfaktor“ des europäischen Sonderwegs (287-292).
10 Vgl. z. B. J. Casanova, Der Ort der Religion im säkularen Europa, in: Transit 27 (2004) 86-106.
11 Vgl. A. Schindling, Konfessionalisierung und Grenzen von Konfessionalisierbarkeit, in: ders. / Ziegler, W. (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, 7 Hefte, Münster 1989-1997, Heft VII, 9-44; T. Kaufmann, Die Konfessionalisierung von Kirche und Gesellschaft. Sammelbericht über eine Forschungsdebatte, in: ThLZ 121 (1996) 1009-1025 u. 1113-1121; W. Ziegler, Kritisches zur Konfessionalisierungsthese, in: Frieß, P. / Kießling, R. (Hg.), Konfessionalisierung und Region, Konstanz 1999, 41-53.
12 Vgl. hierzu I. Götz von Olenhusen, Klerus und abweichendes Verhalten. Zur Sozialgeschichte katholischer Priester im 19. Jahrhundert: Die Erzdiözese Freiburg (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 106), Göttingen 1994; O. Blaschke / F.-M. Kuhlemann (Hg.), Religion; E. Garhammer, Seminaridee und Klerusbildung bei Karl August Graf von Reisach. Eine pastoralgeschichtliche Studie zum Ultramontanismus des 19. Jahrhunderts (MKHS 5), Stuttgart 1990.
13 F. W. Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München 22004, 109.
14 Zu den „cleavages“ vgl. S. M. Lipset / S. Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction, in: dies. (Hg.), Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, New York 1967, 1-66; Arbeitskreis für kirchliche Zeitgeschichte Münster (AKKZG), Konfession und Cleavages im 19. Jahrhundert. Ein Erklärungsmodell zur regionalen Entstehung des katholischen Milieus in Deutschland, in: Horstman, J. / Liedhegener, A., Konfession, Milieu, Moderne. Konzeptionelle Positionen und Kontroversen zur Geschichte von Katholizismus und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, Schwerte 2001, 97-144. Zu den Ebenen und Möglichkeiten von vergleichender Geschichte und Verflechtungsgeschichte auch K. Tenfelde, Sozialgeschichte und religiöse Sozialisation, in: ders. (Hg.), Religiöse Sozialisationen im 20. Jahrhundert. Historische und vergleichende Perspektiven (Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen A 43), Essen 2010, 7-32; R. Rytlewski, Warum und wie vergleichen wir Kirchen in Deutschland und Europa? In: Dähn, H. / Heise, J. (Hg.), Staat und Kirchen in der DDR (Kontexte 34), Frankfurt a. M. 2003, 9-16; F. W. Graf / K. Große Kracht, Einleitung; O. Blaschke / F.-M. Kuhlemann, Religion in Geschichte und Gesellschaft. Sozialhistorische Perspektiven für die vergleichende Erforschung religiöser Mentalitäten und Milieus, in: dies., Religion, 7-56.
15 Vgl. die Beiträge zu religiösen Eliten in: L. Dupeux / R. Hudemann / F. Knipping (Hg.), Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen, München 1996, Bd. 2, 157-192; Ch. Kösters / W. Tischner, Die katholische Kirche in der DDR-Gesellschaft. Ergebnisse, Thesen und Perspektiven, in: dies. (Hg.), Katholische Kirche in SBZ und DDR, Paderborn u. a. 2005, 13-34, hier 30-33.
16 F. W. Graf / K. Große Kracht, Einleitung, 23-40. Vgl. auch J. Wischmeyer, Kirchliche Zeitgeschichte im Kontext historischer Europaforschung – Methodische und thematische Überlegungen, in: Mitteilungen zur Kirchlichen Zeitgeschichte 5 (2011), 9-31.
17 H. Jedin, Das Leitbild des Priesters nach dem Tridentinum und dem Vaticanum II, in: ThGl 60 (1970) 102-124, hier 103.
18 Dazu E. Gatz (Hg.), Der Diözesanklerus (Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts – Die katholische Kirche 4), Freiburg i. Br. 1995, 25f.
19 Vgl. A. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 32005, insbesondere 440-462; J. Laudage, Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert, Köln / Wien 1984.
20 J. Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, München 1924.
21 H. Jedin, Leitbild, 104.
22 Vgl. K. Baumgartner, Der Wandel des Priesterbildes zwischen dem Konzil von Trient und dem II. Vatikanischen Konzil (EichHR 6), München 1978; K. Ganzer, Das Konzil von Trient und die theologische Dimension der katholischen Konfessionalisierung, in: Reinhard, W. / Schilling, H. (Hg.), Konfessionalisierung, 50-69. Zum Wandel des Priesterbildes vgl. ferner E. L. Grasmück, Vom Presbyter zum Priester. Etappen der Entwicklung des neuzeitlichen Katholischen Priesterbildes, in: Hoffmann, P. (Hg.), Priesterkirche (TzZ 3), Düsseldorf 1987, 96-131; J. Lenzenweger, Wandel des Priesterbildes zwischen Tridentinum und Vatikanum II, in: Marböck, J. / Zinnhobler, R. (Redaktion), Priesterbild im Wandel. Theologische, geschichtliche und praktische Aspekte des Priesterbildes. Festschrift Alois Gruber (LTR 1), Linz 1972, 105-120; H. Brosseder, Das Priesterbild in der Predigt. Eine Untersuchung zur kirchlichen Praxisgeschichte am Beispiel der Zeitschrift „Der Prediger und Katechet“ von 1850 bis zur Gegenwart, München 1978; A. Rauch / P. Imhof (Hg.), Das Priestertum in der Einen Kirche, Aschaffenburg 1987; S. Hell / A. Vonach (Hg.), Priestertum und Priesteramt. Historische Entwicklungen und gesellschaftlich-soziale Implikationen (Synagoge und Kirchen 2), Münster 2012.
23 Dr. Martinus Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 6, Weimar 1888, 408 (künftig: Luther, WA).
24 Luther, WA VI, 564.
25 Luther, WA VIII, 415.
26 H. Jedin, Leitbild, 110.
27 Tridentinum Sessio 22, 17. September 1562, Doctrina et canones de sanctissimo missae sacrificio, in: Wohlmuth, J. (Hg.), Dekrete der ökumenischen Konzilien Bd. 3, Paderborn 2002, 732-737.
28 Tridentinum Sessio 23, 15. Juli 1563, Canones de sacramento ordinis, in: Wohlmuth, J. (Hg.), Dekrete, 743.
29 G. Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts, Regensburg 31881, 129f.
30 Zitiert nach A. Arens, Die Entwicklung des Priesterbildes in den kirchenamtlichen Dokumenten von der Enzyklika „Menti Nostrae“ Papst Pius’ XII. (1950) bis zur gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1975), in: ders. (Hg.), Pastorale Bildung. Erfahrungen und Impulse zur Ausbildung und Fortbildung für den kirchlichen Dienst, Trier 1976, 7-35, hier 10.
31 Zitiert nach R. Dürr, „... die Macht und Gewalt der Priestern aber ist ohne Schrancken“ – zum Selbstverständnis katholischer Seelsorgegeistlicher in der zweiten Hälfte des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Dinges, M. (Hg.), Hausväter, Priester, Kastraten – zur Konstruktion von Männlichkeit im Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 1998, 75-99, hier 87.
32 Ebd., 87f. Vgl. auch dies., Images of the Priesthood: An Analysis of Catholic Sermons from the Late Seventeenth Century, in: Central European History 33 (2000) 87-107.
33 R. Dürr, Macht, 88.
34 Ebd., 89.
35 Dass das Priesterbild ein entscheidender Faktor für das Verständnis der katholischen Kirche im Wilhelminischen Kaiserreich ist, betont beispielsweise auch W. Freitag, Klerus und Laien im Bistum Münster 1871-1914. Eine herrschaftssoziologische Annäherung, in: Westfalen 83 (2005) 104-119, hier v.a. 111.
36 T. Schulte-Umberg, Profession, 485.
37 O. Blaschke, Kolonialisierung, 96.
38 Ebd.
39 Ebd.
40 R. v. Scherer, Art. Clerus, in: WWKL, Bd. 3 (1884) 537-547 (Zitate auf verschiedenen Seiten).
41 O. Blaschke (Hg.), Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites konfessionelles Zeitalter, Göttingen 2002; kritisch dazu z. B. A. J. Steinhoff, Ein zweites konfessionelles Zeitalter? Nachdenken über die Religion im langen 19. Jahrhundert, in: GeGe 30 (2004) 549-570.
42 Hinweise z. B. bei W. Freitag, Klerus, 115-118.
43 Vgl. K. Tenfelde, Sozialgeschichte, 8.
44 M. Persch, Zur Lebenskultur des Trierer Diözesanklerus im 19. und 20. Jahrhundert, in: RQ 88 (1993) 374-396, hier 387.
45 Vgl. E. Gatz, Der Diözesanbischof und sein Klerus im deutschsprachigen Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, in: RQ 95 (2000) 250-261; I. Götz von Olenhusen, Klerus; H. Wolf, „… ein Rohrstengel statt des Szepters verlorener Landesherrlichkeit …” Die Entstehung eines neuen Rom- bzw. Papstorientierten Bischofstyps, in: Decot, R. (Hg.), Kontinuität und Innovation um 1803. Säkularisation als Transformationsprozess. Kirche – Theologie – Kultur – Staat (VIEG. Beiheft 65), Mainz 2005, 109-134.
46 I. Götz von Olenhusen, Klerus, 392.
47 Ebd.
48 Vgl. W. H. Schröder, Kollektivbiographie als interdisziplinäre Methode in der Historischen Sozialforschung: Eine persönliche Retrospektive (Historical Social Research Supplement 23), Köln 2011.
49 K. Tenfelde, Sozialgeschichte, 12f.
50 Vgl. H. Wolf, Priesterausbildung zwischen Universität und Seminar. Zur Auslegungsgeschichte des Trienter Seminardekrets, in: RQ 88 (1993) 218-236.
51 Vgl. H. Bullinger (Hg.), Studiorum Ratio – Studienanleitung. Teilbd. 1: Text und Übersetzung. Teilbd. 2: Einleitung, Kommentar, Register, aus dem Lateinischen, hg. v. P. Stotz, Zürich 1987; J. W. Donohue, Jesuit Education. An Essay on the Foundations of its Idea, New York 1963; B. Duhr SJ, Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu, Freiburg 1896; ders., Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, 3 Bde., Freiburg i. Br. 1907-1921.
52 Vgl. v. a. A. Ohlidal / S. Samerski (Hg.), Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des Östlichen Mitteleuropa 28), Stuttgart 2007; K. Hengst, Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung, Paderborn 1981; T. Kurrus, Die Jesuiten an der Universität Freiburg i. Br. 1620-1773 (BFWUG 21), Bd. 1, Freiburg 1963; M. Müller, Die Entwicklung des höheren Bildungswesens der französischen Jesuiten im 18. Jahrhundert bis zur Aufhebung 1762-1764, Frankfurt a. M. 2000; R. A. Müller, Hochschulen und Gymnasien, in: Brandmüller, W. (Hg.), Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, Bd. 2, St. Ottilien 1993, 535-556; B. J. Murphy, Der Wiederaufbau der Gesellschaft Jesu in Deutschland im 19. Jahrhundert. Jesuiten in Deutschland 1849-1872 (EHS.T 262), Frankfurt a. M. 1985.
53 J. Pilvousek, Die Integration der Theologischen Fakultät in die Universität Erfurt, in: ThG 55 (2012) 172-238.
54 Vgl. W. Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische Zukunft, Freiburg i. Br. u. a. 2004; B. Schmidt / H. Wolf (Hg.), Ekklesiologische Alternativen? Monarchischer Papat und Formen kollegialer Kirchenleitung (15.-20. Jahrhundert) (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme – Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Bd. 42), Münster 2013; K. Schatz, Der Päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart, Würzburg 1990.
55 W. Müller, Wessenberg und seine Bemühungen um die Bildung der Priester, in: Schwaiger, G. (Hg.), Kirche und Theologie im 19. Jahrhundert (SThGG 11), Göttingen 1975, 41-53.
56 Vgl. M. F. Langenfeld, Bischöfliche Bemühungen um Weiterbildung und Kooperation des Seelsorgeklerus. Pastoralkonferenzen im deutschen Sprachraum des 19. Jahrhunderts, eine institutionsgeschichtliche Untersuchung, Rom u. a. 1997; L. Mödl, Priesterfortbildung um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dargestellt am Beispiel der Pastoralkonferenzen von 1854-1866 im Bistum Eichstätt, Regensburg 1985.
57 Vgl. U. Küppers-Braun / T. Schilp, Katholisch – Lutherisch – Calvinistisch. Frauenkonvente im Zeitalter der Konfessionalisierung (Essener Forschungen zum Frauenstift 8), Essen 2010; A. Conrad, Ursulinen und Jesuiten. Formen der Symbiose von weiblichem und männlichem Religiosentum in der Frühen Neuzeit, in: Elm, K. / Parisse, M. (Hg.), Doppelklöster und andere Formen der Symbiose männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter (BHSt 18; Ordensstudien 8), Berlin 1992, 213-238.
58 Vgl. R. Meiwes, „Arbeiterinnen des Herrn“. Katholische Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert (Geschichte und Geschlechter 30), Frankfurt a. M. 2000; J. Schmiedl, Die Säkularisation war ein neuer Anfang. Religiöse Gemeinschaften des 19. und 20. Jahrhunderts, in: HJ 126 (2006) 327-358; E. Frie, Sozialisation der Ordensfrauen. Kongregationen, Katholizismus und Wohlfahrtsstaat in Deutschland im 20. Jahrhundert, in: Tenfelde, K. (Hg.), Sozialisationen, 75-88.
59 Vgl. U. Küppers-Braun, Macht in Frauenhand – 1000 Jahre Herrschaft adeliger Frauen in Essen, Essen 2002.
60 Vgl. K. Große Kracht, Die katholische Welle der „Stunde Null“. Katholische Aktion, missionarische Bewegung und Pastoralmacht in Deutschland, Italien und Frankreich 1945-1960, in: ASozG 51 (2011) 163-186; A. Steinmaus-Pollak, Das als Katholische Aktion organisierte Laienapostolat. Geschichte seiner Theorie und seiner kirchenrechtlichen Praxis in Deutschland, Würzburg 1988; zusammenfassend: H. Hürten, Deutsche Katholiken 1918-1945. Paderborn u. a. 1992, 119-137; K. Unterburger / H. Wolf (Bearb.), Eugenio Pacelli. Die Lage der Kirche in Deutschland 1929 (VKZG.Q 50), Paderborn u. a. 2006, 84-88; M. della Sudda, Les défis du pontificat de Pie XI pour l’Action Catholique féminine en France et en Italie (1922-1939), in: Guasco, A. / Perin, R. (Hg.), Pius XI: Keywords. International Conference Milan 2009 (Christianity and History 7), Münster 2010, 207-226.
61 H. Hürten, Kurze Geschichte des deutschen Katholizismus 1800-1960, Mainz 1986, 243, dazu auch C. Kösters, Vereinskatholizismus und religiöse Sozialisation in Deutschland seit 1945. Zum Stand der Debatte, in: Tenfelde, K. (Hg.), Sozialisationen, 33-58, hier 42-44.
62 Vgl. z. B. J. Pilvousek, Heimatvertriebene Priester in der SBZ/DDR von 1945 bis 1948, in: RQ 104 (2009) 297-311; ders., Von der „Flüchtlingskirche“ zur katholischen Kirche in der DDR. Historische Anmerkungen zur Entstehung eines mitteldeutschen Katholizismus, in: Manemann, J. / Schreer, W. (Hg.), Religion und Migration heute. Perspektiven – Positionen – Projekte (Quellen und Studien zur Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 6), Regensburg 2012, 170-186.
63 Vgl. etwa T. Mittmann, Säkularisierungsvorstellungen und religiöse Identitätsstiftung im Migrationsdiskurs. Die kirchliche Wahrnehmung „des Islams“ in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1960er Jahren, in: ASozG 51 (2011) 267-290; außerdem die Tagung „Christentum im Islam – Islam im Christentum? Identitätsbildung durch Rezeption und Abgrenzung in der Geschichte“, die im Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 2012 dokumentiert wird; Bericht von M. E. Gründig, in: H-Soz-u-Kult vom 28. Januar 2011, online unter: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3508> (letzter Aufruf: 5. November 2012).
64 O. Blaschke, Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (KSGW 122), Göttingen 1997, 238; vgl. dazu auch die Rezension von A. Owzar, in: H-Soz-u-Kult, 13.01.2000, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=244> (letzter Aufruf am 28. November 2012).
65 K. Große Kracht, Welle.
66 K. Tenfelde, Sozialgeschichte, 14 (Anführungszeichen auch im Original). Der Beginn der Auflösung des katholischen Milieus wird unterschiedlich datiert und zunehmend auch als „Transformationsprozess“ beschrieben, vgl. z. B. B. Ziemann, Der deutsche Katholizismus im späten 19. und im 20. Jahrhundert. Forschungstendenzen auf dem Weg zur sozialgeschichtlichen Fundierung und Erweiterung, in: ASozG 40 (2000) 402-422; W. Damberg, Abschied vom Milieu? Katholizismus im Bistum Münster und in den Niederlanden 1945-1980, Paderborn u. a. 1997; Ch. Kösters u. a., Was kommt nach dem katholischen Milieu? Forschungsbericht zur Geschichte des Katholizismus in Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: ASozG 49 (2009) 485-526, hier v. a. 486f.; H. McLeod, The Religious Crisis of the 1960s, New York 2008.
67 Vgl. v. a. die Publikationen der Bochumer DFG-Forschergruppe „Transformation der Religion in der Moderne“, online unter: <http://www.fg-religion.de> (letzter Aufruf: 28. November 2012).
68 Vgl. B. Ziemann, Säkularisierung oder Neuformierung des Religiösen. Religion und Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: ASozG 51 (2011) 3-36.
69 Vgl. z. B. F. W. Graf, Wiederkehr; D. Pollack, Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und in Europa II, Tübingen 2009; Ch. Gärtner, Die Rückkehr der Religionen in der politischen und medialen Öffentlichkeit, in: Gabriel, K. / Höhn, H.-J. (Hg.), Religion heute – öffentlich und politisch. Provokationen, Kontroversen, Perspektiven, Paderborn u. a. 2008, 93-108.
70 Vgl. K. Gabriel / Ch. Gärtner / D. Pollack (Hg.), Umstrittene Säkularisierung. Soziologische und historische Analysen zur Differenzierung von Religion und Politik, Berlin 2012; O. Müller / G. Pickel / D. Pollack (Hg.), The Social Significance of Religion in the Enlarged Europe: Secularization, Individualization and Pluralization, Farnham u. a. 2012; M. Borutta, Genealogie der Säkularisierungstheorie. Zur Historisierung einer großen Erzählung der Moderne, in: GeGe 36 (2010) 347-376; H. Joas / K. Wiegandt, Säkularisierung und die Weltreligionen, Frankfurt a. M. 2007; mehrere Beiträge zum Rahmenthema „Säkularisierung und Neuformierung des Religiösen. Gesellschaft und Religion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ in: ASozG 51 (2011); bald auch: U. Willems u. a. (Hg.), Kontroversen um die Moderne und die Rolle der Religion in modernen Gesellschaften, Bielefeld (2013).