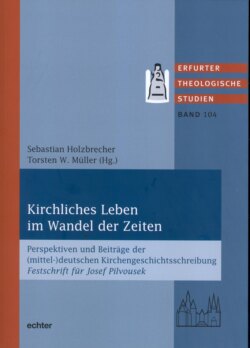Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 36
Antonius von Steichele, Erzbischof von München und Freising (1878-1889), im Erleben seines Sekretärs Johann Baptist Huber Anton Landersdorfer
ОглавлениеAls Antonius von Steichele1 1878 sein Amt als neuer Erzbischof von München und Freising antrat, übernahm er von seinem Vorgänger Gregor von Scherr2 nicht zuletzt dessen Sekretär Johann Baptist Huber (1842-1886)3. Dieser, ein gebürtiger Massinger aus der Pfarrei Baumburg (Erzbistum München und Freising), hatte nach dem Abitur in der Studienanstalt der Benediktinerabtei Metten zunächst als Alumne des Germanikums4 am Collegium Romanum5 Philosophie und Theologie studiert und dann als Stenograph beim I. Vatikanischen Konzil6 gewirkt, ehe er 1872, nach vorübergehendem Einsatz als Kaplan im Institut der Englischen Fräulein in Nymphenburg, von Scherr zu seinem engsten Mitarbeiter berufen wurde.
Da Huber als „Doctor Romanus“ keinen leichten Stand in seiner bayerischen Heimat hatte – im Zuge des Kulturkampfes verbot die Regierung hierzulande sogar den Besuch des Germanikums, solange dieses unter jesuitischer Leitung stehe7 –, blieb er seit seiner 1870 erfolgten Rückkehr aus Rom stets in engem Kontakt mit seinem früheren, von ihm überaus geschätzten Rektor P. Andreas Steinhuber SJ8. In knapp einhundert erhalten gebliebenen Briefen9 informierte er ihn fast 16 Jahre lang nicht nur eingehend über seine vielseitige und aufopferungsvolle Tätigkeit an der Seite zweier Erzbischöfe ebenso wie über alle wichtigen Vorgänge im Erzbistum und in der katholischen Kirche Bayerns, sondern äußerte sich darin auch wiederholt zu den beiden von ihrem Charakter und ihrer Mentalität her recht unterschiedlichen Oberhirten und schilderte darüber hinaus gar manche Begebenheit, die er beruflich oder privat mit ihnen erlebte.
Weil die Gregor von Scherr, den ehemaligen Abt von Metten, betreffenden Passagen bereits im Wesentlichen publiziert sind10 – erinnert sei deshalb lediglich an das abendliche, gelegentlich im Streit endende Tarockspiel –, soll im Folgenden komprimiert zur Darstellung gebracht werden, welche interessanten Einzelheiten der Erzbischöfliche Sekretär bezüglich Antonius von Steichele zwischen 1878 und 1886 nach Rom zu berichten wusste, und zwar wegen der Originalität der Sprache und des Ausdrucks ganz bewusst mittels längerer wörtlicher Zitate.
Gut fünf Jahre hatte Huber Erzbischof Scherr treu und zuverlässig gedient, mit der Konsequenz, dass sie trotz der „persönlichen Launen“ und des „ziemlich rauhen Äußeren“ des Oberhirten im Laufe der Zeit „innig zusammengewachsen“11 waren, als dieser am 24. Oktober 1877 nach langer, von massiven innerkirchlichen wie kirchenpolitischen Auseinandersetzungen geprägter Amtszeit starb. Sechs Monate später wurde bekannt, dass der aus dem schwäbischen Mertingen stammende Antonius von Steichele, bislang Dompropst und Bistumshistoriker in Augsburg, von König Ludwig II. auf Vorschlag von Kultusminister Johann Freiherrn von Lutz12 offiziell zu seinem Nachfolger nominiert worden sei, und so stellte sich für den bisherigen Erzbischöflichen Sekretär umgehend die Frage nach seiner künftigen Verwendung. „Was Steichele mit dem Huber Johannes anfangen wird, weiß ich zwar noch nicht ganz genau, aber höchst wahrscheinlich wird letzterer wenigstens für den Anfang Secretär bleiben müssen. Wenigstens äußerte sich Steichele in diesem Sinne dem HH. Cap. Vicar13 gegenüber mit dem Beisatze: wenn er mag“, schrieb Huber im Sommer 1878 an Steinhuber14, um einige Zeilen weiter zu ergänzen: „Im Interesse der Sache u. des neuen Erzbischofs selbst wird es wohl am besten sein das zu thun, was man über mich verfügt. Der Münchener Stuhl bringt gar Manches mit sich, wovon andere Bischöfe nichts wissen, u. Steichele, der nicht blos ein Feind der Complimentirungen, sondern, wie man sagt, in diesem Punkte auch ziemlich peregrinus in Israel ist, muß schon deßhalb einen eingeschulten Secretär wünschen, um bei Hof u. dem Adel nicht Anstoß zu erregen.“
Wie vermutet „musste“ der überaus pflichtbewusste und verschwiegene Germaniker in seiner alten Stellung bleiben, worauf er bald nach Steicheles feierlicher Besitzergreifung vom Erzbistum am 14. Oktober 1878 nach Rom meldete: „Unter dem neuen Erzbischof geht es mir auch nicht schlecht; er ist und wird schon recht, nur muß man anfangs selbstverständlich etwas Geduld haben.“15 Zugleich teilte er mit, dass dessen erster Hirtenbrief „überall sehr gut gefallen“ habe. In ihm hatte der neue Oberhirte seine künftige, „durch die Verhältnisse der Gegenwart nicht undeutlich angezeigte“ Aufgabe mit den Worten umschrieben: „Durch den dreifachen Gehorsam gegen die Kirche, gegen Thron und Vaterland und gegen Gottes Gebot der kirchlichen, der staatlichen und der religiös-sittlichen Ordnung die heutzutage tief erschütterte Grundlage ihres Bestandes zurückzugeben, welche da ist: Gott Alles in Allem.“16 Diese Aufgabe zu erfüllen, war Steichele in den elf Jahren seines oberhirtlichen Wirkens redlich bemüht. In Bezug auf die Kirchenpolitik nahm er dabei stets eine staatsloyale und kooperationsbereite Haltung ein, was ihm seitens des intransigenten Flügels im bayerischen Episkopat und eines Teiles der politisch formierten Katholiken den Vorwurf der Nachgiebigkeit einbrachte.
Anderer Meinung war da, zumindest am Anfang, sein Sekretär, der mit Ausnahme des Freitags jeden Abend „ungefähr 1 ½ St[unden]“ allein mit dem Erzbischof beisammen saß17. „Seine Gesinnung ist jedenfalls gut u. er gewiß nicht gesonnen, seinen Rechten etwas zu vergeben. Daß er die Gunst des Lutz nicht schon in den ersten Flitterwochen verscherzen will u. auch in andern Dingen durch Schaden klug werden muß, finde ich erklärlich, besonders da man ihm manchen Floh in das Ohr gesetzt zu haben scheint u. ein Nachfolger es immer besser machen will als sein Vorgänger. Ich selbst komme ganz gut mit ihm aus u. glaube sein Vertrauen schon einigermassen zu besitzen; kann ich dieses einmal für fest begründet erachten, so werde ich mir gelegentlich manche Bemerkungen erlauben, mit denen ich jetzt noch zurückhalten zu sollen glaube, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Ganz still verhalte ich mich übrigens auch jetzt nicht u. steht mir dabei der Vortheil zur Seite, daß ich befragt u. unbefragt als alter Secretär ihm Manches sagen muß, was zu wissen in seinem eigenen Interesse liegt“, ließ Huber, der Scherr neben mehr „Herz“18 auch größere „Rüstigkeit und Zähigkeit“19 als Steichele attestierte, seinen früheren Rektor wenige Wochen später wissen20, nicht ohne anschließend darauf zu verweisen, dass der Apostolische Nuntius Gaetano Aloisi Masella21 über den nunmehrigen Oberhirten eine „etwas ungünstigere Ansicht“ habe. Allein „ich schreibe dieß theils dem verschiedenen Naturel eines hitzigen Italieners u. eines kalten u. langsamen Deutschen, theils andern äußern Gründen zu“, fügte der Erzbischöfliche Sekretär erläuternd bei.
Freilich, bereits ein halbes Jahr später schlug Huber keine so moderaten Töne mehr an. Zunächst äußerte er gegenüber Steinhuber „vorläufig“, dass es ihm „unter Erzbischof Gregor im Palais u. was damit zusammenhängt besser gefallen“ habe, weshalb er „etwas vom s. g. Pfarrerfieber befallen“ sei22. Bald darauf gestand er unverblümt ein: „In dem günstigen Urtheile über meinen R[everendissi]mus bin ich unterdessen bedeutend nüchterner geworden u. gar Manches will mir nicht mehr gefallen. Der Verkehr mit Lutz dauert mir bereits zu lange u. ist mir zu häufig, u. die Intimität mit dem Kanonikus Türk23 von St. Cajetan, einem Vertrauten des Lutz, gefällt mir auch nicht. Wenn ich dann bedenke, daß Erzbischof Gregor auch nicht ein einziges Mal zu Lutz ging, weil er es unter seiner Würde hielt, so steigen mir manchmal sehr trübe Gedanken auf. Nach ‚Schwaben’ wird auch noch immer gar so oft gegangen u. ist dadurch bereits das bonmot entstanden, der HH. Erzbischof habe in München zwar ein Palais, aber keine Residenz. Das rege Interesse, welches Erzb. Gregor an allen Vorfällen in der Erzdiözese nahm, sowie die Sorge u. Bemühung für eine gedeihliche Pastoration, die Gregor stets als wichtige Gewissensangelegenheit betrachtete u. behandelte, fehlt in hohem Grade. Mir scheint der gute Herr, der viele Jahre hindurch sich fast nur mit seiner Beschreibung der Diöcese Augsburg24 beschäftigte, dadurch das Interesse für andere Dinge großentheils verloren zu haben. Diese Beschreibung wird auch jetzt noch fortgesetzt. Das sind ungefähr meine Hauptschmerzen.“25
Dass im Erzbischöflichen Palais in München inzwischen ein „etwas anderer Wind“ wehte, musste Huber ebenso im Herbst des gleichen Jahres erfahren, als Steichele ihm durch Generalvikar Dr. Michael Rampf26 mitteilen ließ, er wünsche, dass er „mit der Nuntiatur keine Beziehungen mehr unterhalte, weil ein guter Freund ihm bedeutet habe, daß das von mehreren Seiten übel vermerkt werde. Es schicke sich für den Sekretär des Erzbischofs nicht, daß er so viel mit dem Nuntius verkehre, wie auch der Erzbischof den Sekretär des Nuntius nicht so oft bei sich sehen wollte“27. Damit hatte Huber allerdings kein Problem, wie er seinem früheren Rektor postwendend zu verstehen gab: „Ich für meine Person bin darüber froh, weil ich eine große Plage weniger habe.“ Warum der seiner Ansicht nach durchaus über „gute Eigenschaften“28 verfügende Oberhirte ihm seinen Wunsch jedoch „auf einem Umwege“ habe kundtun lassen, konnte der Sekretär nicht nachvollziehen. Jedenfalls nahm er sich „die Freiheit“, „die Sache zur Sprache zu bringen“ und Steichele „über den Ursprung u. die Ungefährlichkeit“ seiner Beziehungen aufzuklären29.
Eine Besserung im Miteinander zwischen dem Erzbischof und seinem engsten Mitarbeiter trat hierdurch allerdings nicht ein – im Gegenteil. Fünf Monate später sah sich Huber zu folgenden mehr als deutlichen Äußerungen verlasst: „Die Verhältnisse unter dem neuen Erzbischof haben mir, wenn ich ihn auch Anfangs in Schutz genommen habe u. Alles möglichst gut zu interpretiren suchte, doch nie recht gefallen u. werden mir jetzt fast von Tag zu Tag unerquicklicher. ... Was meine Person insbesonders betrifft, so könnte ich zwar tuta conscientia nicht sagen, daß er positives Mißtrauen gegen mich hat; aber das Vertrauen wie unter Gregor scheint mir nicht vorhanden zu sein; überhaupt nicht jenes, wie es zwischen Bischof u. Sekretär nach meiner Ansicht herrschen soll; hiefür liegen auch positive Fakta vor, die ich mir nur sehr schwer anders erklären kann; ich komme mir mehr als nothwendiges Uebel vor. Manches wird allerdings auch auf Rechnung der Naturanlage zu setzen sein, ob aber Alles? Ob und wodurch ich zu diesem Verhältniß vielleicht Anlaß gegeben habe, weiß ich nicht. Aber das weiß ich, daß ich gerade wegen der Lage der Dinge Alles sorgfältig vermieden habe, was mich in seinen Augen als ‚jesuitischen Heißsporn’ hätte erscheinen lassen können; daß ich ihn nach außen hin immer in Schutz genommen habe, weil ich das im Interesse der Sache für Gewissenspflicht hielt u. noch halte; daß ich Unberufenen nie etwas anvertraute, was ihn hätte compromittiren können. Wenn dessen ungeachtet bei der Geschwätzigkeit der Leute, bei den manchmal cursirenden ungünstigen Gerüchten u. bei dem Mangel an vollem Vertrauen von Seite des Clerus (der von Anfang an bestanden u. bisher eher gesteigert als vermindert wurde) auch angebliche Äußerungen von mir colportirt u. ihm hinterbracht wurden, so kann ich das nicht hindern, weiß auch nicht, ob es wirklich der Fall war. Sollte ich vielleicht als Germaniker bei ihm ipso facto zur massa damnata gehören oder ihm ein ‚hunc cave’ beigebracht worden sein, so werde ich deßhalb meinen Grundsätzen doch nie untreu werden. Uebrigens seufzt auch der HH. Gen.Vicar unter analogen Verhältnissen, von den andern Domherrn gar nicht zu sprechen.“30
Noch heftiger fiel Hubers Kritik an Steicheles bisheriger Amtsführung aus: „Für die Diöcese u. ihre Bedürfnisse fast kein Interesse; dem Diöcesanclerus gegenüber große Kälte, verhältnißmäßig wenig Zugänglichkeit u. nicht großes Vertrauen von Seite des Clerus; herzliches Entgegenkommen mit Niemand, auch nicht mit dem Capitel; durch die That sich kundgebendes Vertrauen zu Niemand, selbst nicht zum HH. Generalvicar im wünschenswerthen Maß; Intimität mit Leuten, die zum Erzbischof in fast keiner Beziehung stehen oder nicht des besten Rufes sich erfreuen; anhaltende Vorliebe für Schwaben; im Ordinariat Augsburg Alles gut, hier fast Alles reformbedürftig; nach oben große Furcht u. Besorgniß anzustoßen; mit Lutz Intimität u. ängstliches Vermeiden Alles dessen, was das bisherige Wohlwollen u. gute Einvernehmen untergraben könnte; dem Lutz zu Liebe Aufgeben des bisherigen Pastoralblattes (weil es manchmal geharnischte Artikel brachte) u. an dessen Stelle ein ‚Amtsblatt’31, von welchem ich der unglückliche u. streng beaufsichtigte Redacteur bin. Das ist so ziemlich die Situation im Allgemeinen. Sie werden es mir nicht verargen, wenn ich mich da nicht heimlich fühle.“32
In Anbetracht dessen überlegte sich der Erzbischöfliche Sekretär damals ernsthaft, ob er nicht seinen Posten räumen und sich um eine Pfarrei bewerben solle, was ihm aber angesichts der Tatsache, dass ein „passender Ersatz“ für ihn derzeit nicht leicht zu finden sei, als problematisch erschien. Denn der Oberhirte war Hubers Worten zufolge „in den Functionen sehr unbeholfen; hat mit dem Studium der schwierigern u. längeren sicher noch keine Zeit verloren, sondern verließ sich ganz auf d. Secretär. Andere Functionen, z. B. Pfarrvisitationen, bei denen man Vieles gründlich u. genau wissen muß, hat er noch nicht vorgenommen, auch noch nicht studirt u. von Haus aus scheint die diesbezügliche Wissenschaft nicht sonderlich hervorragend zu sein. Kommt ein neuer Sekretär, so weiß keiner etwas. Das ist sicher weder für ihn noch für die Sache vortheilhaft. Um ferner die absolut nothwendige courtoisie gegen den Hof u. dgl. nicht zu verletzen, muß man immer erinnern, da hievon weder Kenntniß noch Gefühl vorhanden ist. Ein neuer Sekretär wird hierin auch nicht behilflich sein können, u. folglich der R[everendissi]mus in diesem Punkte noch mehr ausgerichtet werden, als es ohnehin schon geschieht“.33
Deshalb blieb Huber auf ausdrücklichen Wunsch des Erzbischofs weiterhin dessen Sekretär – mit den „bekannten Schmerzen“, wie er Mitte Mai 1881 seinem früheren, inzwischen nicht mehr mit der Leitung des Germanikums betrauten, sondern als Konsultor diverser römischer Kongregationen tätigen Rektor kundtat34. Die Folge war, dass sich Ende des nächsten Jahres zwischen Steichele und ihm eine „Scene abspielte, die sehr ernst hätte werden können“, letztlich aber „große Wirkungen“ zeitigte35. Was war geschehen? Unmittelbar vor Beginn einer am 18. Dezember 1882 in der Erzbischöflichen Hauskapelle stattfindenden Ordination „überraschte“ der Oberhirte Huber mit der Anordnung, er müsse „in Zukunft bei allen Funktionen Handschuhe tragen, um die Mitra beim Aufsetzen und Abnehmen mehr zu schonen“, worauf dieser „opponirte“, „Handschuhe bei Funktionen gebühren sich einzig für den Bischof, u. ein Cäremoniar mit Handschuhen sei wie David in der Rüstung des Goliath“. Gleichwohl hatte der Sekretär sich zu fügen, allerdings fand er an der ganzen Angelegenheit rasch noch einen „anderen Hacken“, vor dem seiner Ansicht nach „alle persönlichen Überzeugungen zurücktreten“ mussten.
„Ich glaube Ihnen schon einmal mitgetheilt zu haben“, schrieb er wenig später an Steinhuber, „daß dem R[everendisi]mus die fama eines tenax rerum nach München vorausging. Dieser Ruf wurde von bösen Zungen in ergiebigster Weise gegen den R[everendiss]mus ausgebeutet, genährt u. gesteigert, u. ich muß leider sagen, daß manche Handlungsweisen schmähsüchtigen Zungen neue Nahrung zuführen konnten. Als solche sah ich nach meinen Erfahrungen diese Maßnahme ganz klar voraus, da sie ja wegen ihrer Neuheit in unserer Diöcese u. Sonderbarkeit überall auffallen mußte, aus den Umständen sich nur als im Interesse der Sparsamkeit getroffen darstellen konnte u. zudem auf den Firmungsreisen durch die ganze Diöcese zu Tage treten sollte. Darum faßte ich den Entschluß, in seinem eigenen Interesse diese günstige Gelegenheit zu benützen, um die über ihn verbreitete fama u. die Nahrung, welche er ihr durch diese Maßnahme zuführen würde, einmal ordentlich ihm zu Gemüthe zu führen.“ Obwohl der von Huber ins Vertrauen gezogene Generalvikar Rampf „große Angst“ hatte, es könnte zwischen den beiden „zum Bruche kommen“, glaubte der Sekretär es im Hinblick „auf die fama u. das Ansehen“ des Erzbischofs sogar „darauf ankommen lassen zu müssen“.
Mit welch gut durchdachter Strategie Huber sein Ziel zu erreichen suchte und wie Steicheles Reaktion auf dessen durchaus gewagten Vorstoß ausfiel, darüber informierte jener Steinhuber wie gewohnt in aller Ausführlichkeit: „Mir lag an zwei Dingen: 1.) ihm die ganze u. volle Wahrheit tüchtig sagen zu können und dieß 2.) in einer Weise, daß er sich selbst sagen müsse, ich hätte dabei weder ihn verletzen wollen, noch mein Interesse verfolgt, sondern einzig u. allein sein eigenes Interesse im Auge gehabt. Da ich den R[everendissi]mus ziemlich genau kenne u. auch weiß, wie viel ich mir erlauben darf, schlug ich zur sichern Erreichung meines doppelten Zweckes folgenden Weg ein, den ich nach reiflicher Ueberlegung als den allein richtigen u. wirksamen erkannte. Ich spielte – u. war es auch in Wirklichkeit – den tiefbetrübten, redete nichts, antwortete nur mit ja u. nein u. machte dazu ein Gesicht, fast so lange wie die Frauenthürme hoch sind. Das, dachte ich, wird u. muß er merken, u. ich will sehen, wie lange er es aushält. Als nächste Wirkung erwartete ich, nicht daß er mich selbst fragte, sondern den H. Generalvicar, was ich denn eigentlich habe, weßhalb ich diesen ersuchte, in dieser delikaten Angelegenheit nicht den Vermittler der Antwort machen zu wollen, sondern ihm zu sagen, er solle mich selbst fragen. Am 18. u. 19. Dez. gingen wir bei Tisch rasch auseinander, weil mit mir absolut nichts zu machen war. Am 20. Vormittags wurde bereits H. G. Vicar gerufen u. über mich befragt. Der ließ sich in die Sache nicht ein, ‚wußte nichts näheres’, u. gab die Antwort, um die ich ihn gebeten. R[everendissi]mus sagte, so könne er es mit mir nicht mehr aushalten. Mittags bei Tisch war ich wieder traurig u. stumm, u. so brachte er es endlich am Abend eine Stunde vor Tisch über’s Herz, an meiner Glocke zu ziehen. Als ich erschien, fing er bewegt u. in wohlwollendem Tone an, er habe bemerkt, daß ich seit einigen Tagen verstimmt u. traurig sei, nichts rede, was ich denn habe, ob mich die Handschuhe so schmerzen, er wolle nichts gegen mein Gewissen, ich solle aufrichtig Alles sagen. Meine Antwort war zunächst, nicht die Handschuhe an sich seien die Ursache, sondern was damit für seine Person zusammenhänge, u. das sei wiederum nur ein Glied an einer Kette. Auf die weitere Aufforderung, Alles zu sagen, erwiederte ich, das sei für mich sehr schmerzlich; auch fürchte ich, es könnten mir zu starke Ausdrücke entschlüpfen; ich wolle es deßhalb schriftlich sagen. Auf letzteres ließ er sich nicht ein u. so mußte ich denn mit der Sache herausrücken. Ich glaube die ganze u. volle Wahrheit gesagt zu haben, u. wie es aufgenommen wurde, können Sie daraus abnehmen, daß wir uns zum Schluß auf seine Aufforderung gegenseitig die Hand reichten u. er mich ermunterte, wieder fröhlich zu sein u. in Zukunft ihm ohne Umstände auch die unangenehmsten Dinge frei zu sagen. Er wolle von mir keine Schmeicheleien, sondern daß ich ihm die Wahrheit sage, die Andere ihm nicht sagen. Seither genoß ich Aufmerksamkeiten, die ich sogar als zu viel ablehnen mußte, u. als ich ihm zu Neujahr gratulirte, sagte er, er hoffe, daß wir noch lange beisammen bleiben; wenigstens ihn würde das freuen. Die Handschuhe sind natürlich abgethan; auch anderes, was ich angeführt, wurde geändert, u. die Almosen fließen jetzt in einem Grade reichlich, daß ich fast zurückhalten möchte. Es hat also, Gott sei Dank, gewirkt, wie ich es besser nicht wünschen könnte, u. ich bereue es keineswegs, diesen auch für mich unangenehmen Schritt gethan zu haben.“
In der Tat scheint sich von diesem Zeitpunkt an das Verhältnis zwischen dem Erzbischof und seinem Sekretär weitestgehend normalisiert zu haben, so dass Huber ein halbes Jahr später nach Rom schreiben konnte: „Das alter alterius onera portate abgerechnet hausen wir gut zusammen. Er liebt wie sein ehemaliger Prinzipal Bischof Petrus Richarz36 v. Augsburg, bei dem er alles war, ein persönliches Regiment in hohem Grade u. deßhalb sind jetzt meine Arbeiten unvergleichlich mehr als unter Erzbischof Gregor, der alles amtliche durch das Ordinariat erledigen ließ. Manches wird im Palais erledigt, was die Domherrn gar nicht oder erst post factum erfahren. Außerdem sind unsere alten Domherrn in jeder Beziehung conservativ; R[everendissi]mus dagegen findet hie u. da etwas bei uns nicht ganz in Ordnung, möchte es deßhalb ändern, begegnet aber bei den alten Herrn Schwierigkeiten u. Widersprüchen. Da ich nun bestrebt bin, das Gute dort zu nehmen, wo ich es finde, u. selbst wenn es von Augsburg käme, das minder Gute aber zu verbessern, so sind wir zwei in manchen Dingen oft ganz gleicher Ansicht, wo es bei den Domherrn Widersprüche gibt. Das verschafft mir sein Vertrauen, aber auch manche Arbeit, u. wenn ich in dieser Beziehung ehrgeizig wäre, so wäre es mir wohl nicht unmöglich, mit der Zeit im Palais ein kleines Generalvicariat zu etabliren. Indeß suum cuique.“37
Wie wichtig, ja allem Anschein nach beinahe unentbehrlich Huber für Steichele schließlich geworden war, zeigte sich Ende 1883, als jener infolge zunehmender gesundheitlicher Probleme einen längeren Kuraufenthalt antreten sollte. „Ich habe sichere Beweise, daß dem R[everendissi]mus meine Abreise sehr unlieb wäre, u. deßhalb käme es mich auch schwer an. Bei d. Kirchweihe in Rosenheim Anfangs Oktober gab es z. B. Champagner, der mir nicht blos gut mundete, sondern auch für meinen ‚Zustand’ sehr zuträglich war. Auf das hin hat er nach der Rückkehr 3 Flaschen spendirt, was viel heißen will. Als ich dann später vom Arzt mich untersuchen ließ, wovon Abreise oder Nicht-Abreise abhing, u. dann meldete, vorläufig brauche ich nicht abzureisen, bekundete er darüber eine so ungekünstelte Freude, daß sie nothwendig vom Herzen kommen mußte. Abgesehen von seinem theilnahmsvollen Benehmen gegen mich hat er auch Andern gegenüber, die es mir wieder erzählten, seither wiederholt die Besorgniß geäußert, ich möchte abreisen müssen. Darum werden Sie es mir nicht verargen, wenn ich mich nur schwer dazu entschließen könnte“, bemerkte Huber anschließend gegenüber Steinhuber38.
In der Folgezeit kam der Erzbischöfliche Sekretär in seinen Briefen an Steinhuber nicht mehr näher auf seinen Oberhirten zu sprechen, sieht man von einigen Äußerungen zu der wiederholt geplanten, letztlich aus diversen Gründen jedoch nicht zustande gekommenen Reise in die Ewige Stadt ab. Möglicherweise hatten sich die beiden nach ihrer konstruktiven, in aller Offenheit geführten Aussprache Ende 1882 derart gut arrangiert, dass sie fortan, bis zu Hubers frühzeitigem Ableben knapp vier Jahre später39, ohne nennenswerte Differenzen und Probleme miteinander auskommen konnten.
Wie dem auch sei, die hier wiedergegebenen, allesamt aus persönlichen Eindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen resultierenden Schilderungen seines engsten Mitarbeiters liefern ohne Zweifel wertvolle, bislang so nicht bekannte Aufschlüsse über den vierten Erzbischof von München und Freising.
1 Zu Steichele (1816-1889), von 1847/48 bis 1873 Domkapitular, von 1873 bis 1878 Dompropst in Augsburg, dann Erzbischof von München und Freising: A. Landersdorfer, Antonius von Steichele (1816-1889), in: Weitlauff, M. (Hg.), Lebensbilder aus dem Bistum Augsburg. Vom Mittelalter bis in die neueste Zeit (Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 39), Augsburg 2005, 323-338 (mit Literaturhinweisen).
2 Zu Scherr (1804-1877), von 1840 bis 1856 Abt von Metten, dann Erzbischof von München und Freising: A. Landersdorfer, Gregor von Scherr (1804-1877). Erzbischof von München und Freising in der Zeit des Ersten Vatikanums und des Kulturkampfes, München 1995.
3 Zu Huber: Dr. Johann Baptist Huber (Abriß eines Priesterlebens.), in: Beilage zum Amtsblatt für die Erzdiöcese München und Freising, Nr. 1, 25. Januar 1888, 1-16; Nr. 2, 21. Februar 1888, 17-34; abgedruckt auch in: Licht- und Lebensbilder des Clerus aus der Erzdiöcese München-Freising (1840-1890), zusammengestellt von Ernest Zeller, München 1892, 215-248. – J. Speigl, Die Münchner Germaniker zur Zeit des Vatikanums. Versuch einer Darstellung nach ihren Briefen ins Kolleg, in: Korrespondenzblatt für die Alumnen des Collegium Germanicum et Hungaricum, Mai 1957, 1-24, hier: 5, 18-24. – A. Landersdorfer, Johann Baptist Huber (1842-1886) – vom Mettener Absolventen und Konzilsstenographen zum Erzbischöflichen Sekretär und Domkapitular in München, in: Alt und Jung Metten 78, Heft 1 (2011/12) 64-77.
4 Zur Geschichte des Germanikums: A. Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum in Rom, 2 Bde., Freiburg i. Br. 21906; P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552–1914), Tübingen 1984.
5 Zum Römischen Kolleg, heute Päpstliche Universität Gregoriana: G. Martina, Art. Gregoriana, in: LThK 4, Freiburg 31995, 1029f.
6 Grundlegend zum Ersten Vatikanum (1869/70): K. Schatz, Vaticanum I (1869/70), 3 Bde., Paderborn-München-Wien-Zürich 1992-1994.
7 Siehe dazu: K. Hausberger, Auf Konfrontation zur Katholischen Kirche. Der Kulturkampf in Bayern, in: Bonk, S. / Schmid, P. (Hg.), Königreich Bayern. Facetten bayerischer Geschichte 1806-1919, Regensburg 2005, 119-137, hier 128.
8 Zu Steinhuber (1825-1907), geb. in Uttlau (Bistum Passau), von 1867 bis 1880 Besuch des Germanikums, später Kurienkardinal und Präfekt der Indexkongregation: H. H. Schwedt, Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation 1814-1917, L-Z, Paderborn u. a. 2005, 1415-1418.
9 Die Briefe befinden sich im Archiv des Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum in Rom (ACGU Bf. 19, Huber Joh.) und werden vom Verfasser dieses Beitrages demnächst im vollen Wortlaut ediert. – Weitere Schreiben richtete Huber zudem an seinen ehemaligen Spiritual P. Franz Xaver Huber SJ (1801-1871) sowie an seine „Mitbrüder“ in Rom.
10 Siehe dazu: A. Landersdorfer, Gregor von Scherr, 506f, 512f.
11 Zu den wörtlichen Zitaten siehe die Briefe Hubers an Steinhuber vom 7. Januar 1873, 21. November 1877 und 31. Januar 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh. – Sonstige Aussagen Hubers über Scherr finden sich bei A. Landersdorfer, Gregor von Scherr, 506f, 512f.
12 Zu Lutz (1826-1890), von 1869 bis 1890 Minister des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten, von 1880 bis 1890 Vorsitzender im Ministerrat: W. Grasser, Johann Freiherr von Lutz (eine politische Biographie) 1826-1890, München 1967.
13 Dr. Michael Rampf. – Zu Rampf (1825-1901), seit 1864 Domkapitular, von 1874 bis 1889 Generalvikar in München, dann Bischof von Passau: F. X. Bauer, Das Bistum Passau unter Bischof Dr. Michael von Rampf (1889-1901), Passau 1997.
14 Huber an Steinhuber, München, 8. Juli 1878. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
15 Huber an Steinhuber, München, 27. November 1878. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
16 Generalien-Sammlung der Erzdiöcese München und Freising, IV: Die oberhirtlichen Verordnungen und allgemeinen Erlasse vom 16. September 1878 bis 10. März 1890, München 1890, 5-11, hier 10.
17 Huber an Steinhuber, München, 14. Februar 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
18 Huber an Steinhuber, München, 31. Januar 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
19 Huber an Steinhuber, München, 2. Juni 1880. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
20 Huber an Steinhuber, München, 31. Januar 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
21 Zu Gaetano Aloisi Masella (1826-1902), von 1877 bis 1879 Nuntius in München: H. H. Schwedt, Prosopographie von Römischer Inquisition und Indexkongregation 1814-1917, A-K, Paderborn u. a. 2005, 31-33.
22 Huber an Steinhuber, München, 4. Juni 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
23 Zu Jakob von Türk (1826-1912), Dr. theol., 1852 Priesterweihe, seit 1863 Kanoniker bei St. Kajetan/München, 1883 Dekan, 1890 Propst: H.-J. Nesner, Das Erzbistum München und Freising zur Zeit des Erzbischofs und Kardinals Franziskus von Bettinger (1909-1917), St. Ottilien 1987, 224f.
24 Das Bisthum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben, Bde. II-IV, Augsburg 1864-1883.
25 Huber an Steinhuber, München, 20. Juni 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
26 Siehe Anm. 13.
27 Huber an Steinhuber, München, 1. September 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
28 Huber an Steinhuber, München, 20. Juni 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
29 Huber an Steinhuber, München, 1. September 1879. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
30 Huber an Steinhuber, München, 16. Februar 1880. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
31 Ab dem Jahre 1880. Generalien-Sammlung der Erzdiöcese München und Freising, IV, München 1890, 63.
32 Huber an Steinhuber, München, 16. Februar 1880. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
33 Ebd.
34 Huber an Steinhuber, München, 18. Mai 1881. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
35 Zum Folgenden: Huber an Steinhuber, München, 13. Januar 1883. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
36 Zu Johann Peter von Richarz (1783-1855), 1835/36 Bischof von Speyer, von 1836 bis 1855 Bischof von Augsburg: P. Rummel, Richarz, Johann Peter von, in: Gatz, E. (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1983, 614f.
37 Huber an Steinhuber, München, 5. August 1883. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
38 Huber an Steinhuber, München, 20. Dezember 1883. ACGU Bf. 19, Huber Joh.
39 Huber starb am 16. Oktober 1886 im Alter von lediglich 44 Jahren an „Lungenschwindsucht“ und wurde in der Gruft des Metropolitankapitels auf dem Südlichen Friedhof zu München beigesetzt.