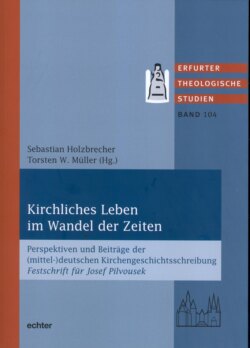Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 31
4. Erste Würdigung des „ letzten Fürstbischofs“ im Eichsfeld und in Erfurt
ОглавлениеBlicken wir auf das Apostolische Vikariat von Fürstbischof Ferdinand von Lüning über das Eichsfeld und Erfurt zurück, so hat es formal vom 15. Dezember 1818 bis zum 13. April 1823 bestanden, also „brutto“ vier Jahre und vier Monate. Zwar hat Fürstbischof Ferdinand von Lüning relativ zügig ab April 1819 die Amtsgeschäfte aufgenommen, aber wegen seiner Erkrankung spätestens ab Ende Oktober 1821 nicht mehr persönlich ausgeübt, wobei er schon in der ersten Jahreshälfte 1821 schwerpunktmäßig wohl mit seiner Einführung im Bistum Münster befasst gewesen war. So ist die Amtstätigkeit von Fürstbischof Lüning in den Erfurter Akten hauptsächlich für die Jahre 1819 und 1820 belegt.
Auch wenn der letzte Fürstbischof im Eichsfeld und in Erfurt nur eine kurze „Netto-Amtszeit“ von 32 Monaten in schwierigen Jahren der politisch-kirchlichen Umstrukturierung hatte, sollte Fürstbischof Ferdinand von Lüning als Apostolischer Vikar nicht vergessen werden. Zwar steht Fürstbischof Lüning im Schatten des bekannteren Fürsterzbischofs Karl Theodor von Dalberg, doch war Fürstbischof Ferdinand von Lüning in den Umbruchsjahren der beginnenden preußischen Verwaltung der letzte Fürstbischof dieser Region mit einer zwar kurzen, aber doch durchaus intensiven pastoralen Tätigkeit.
Fürstbischof Ferdinand von Lüning
Landgraf Viktor Amadeus
1 M. Borisch, Ortsfamilienbuch der Herrlichkeit Gleuel mit Aldenrath, Bell, Berrenrath, Burbach, Horbell, Sielsdorf, Ursfeld und Ziskoven, die Familien bis 1800 (Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 277), Köln 2012, 267.
2 D. Burkard, Kirchliche Eliten und Säkularisation. Zu den Auswirkungen eines Systembruchs, in: Decot, R. (Hg.), Kontinuität und Innovation um 1803. Säkularisation als Transformationsprozeß. Kirche – Theologie – Kultur – Staat (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, Beiheft 65), Mainz 2005, 135-170, speziell 159, Anhang 5, wonach im Jahre 1818 insgesamt nur noch vier Ortsbischöfe in der deutschen Reichskirche im Amt waren.
3 R. Haas, Die Besetzung der Bischofsstühle in der Kölner Kirchenprovinz 1821-1840. Wissenschaftliche Hausarbeit für die kirchliche Abschlussprüfung (1973 bzw. Diplomarbeit 1975), 19 Anm. 1; ders., Die erste münsterische Bischofswahl (1825) nach der Neuordnung des Domkapitel und ihre Vorgeschichte, in: Schröer, A. (Hg.), Das Domkapitel zu Münster 1823-1973 (Westfalia Sacra, Bd. 5), Münster 1976, 52-83, hier 62.
4 B. Bastgen, Die Besetzung der Bischofssitze in Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hg. und bearbeitet von R. Haas, München 1978, Register.
5 Zu dem späteren und durch die „Kölner Wirren“ bekannt gewordenen Kölner Erzbischof vgl. M. Hänsel-Hohenhausen, Clemens August Droste zu Vischering. Erzbischof von Köln 1773-1845. Die moderne Kirchenfreiheit im Konflikt mit dem Nationalstaat, 2 Bde., Egelsbach bei Frankfurt 1991.
6 R. Haas, Domkapitel und Bischofsstuhlbesetzungen in Münster 1813-1846 (Westfalia Sacra, Bd. 10), Münster 1991, zur Pensionszahlung 185.
7 R. Haas, Art. Lüninck, NDB 15, Berlin 1987, 469f.
8 Vgl. R. Haas / R. Jüstel (Hg.), Kirche und Frömmigkeit in Westfalen. Gedenkschrift für Alois Schröer (Westfalia Sacra Bd. 12), Münster 2002; R. Haas, Nachruf auf Alois Schröer, in: Westfälische Forschungen 53 (2003), 493-501; R. Jüstel, Nachruf Prof. DDr. Alois Schröer, in: Jahrbuch für westfälische Kirchengeschichte 98 (2003) 23-30; R. Haas, Von Georg Schreiber (†1963) zu Alois Schröer (†2002). Zum Paradigmenwechsel in der religiösen Volkskunde und rheinisch-westfälischen Kirchengeschichte, in: Scheidgen, H. –J. / Prorock, S. / Rönz, H. / Haas, R. (Hg.), Kirche und Gesellschaft im Wandel der Zeiten. Festschrift für Gabriel Adriányi zum 75. Geburtstag, Nordhausen 2012, 279-346.
9 A. Schröer, 63. Ferdinand III. von Lüning (1821-1825), in: Thissen, W. (Hg.), Das Bistum Münster, Bd. 1: Alois Schröer, Die Bischöfe von Münster. Biogramme der Weihbischöfe und Generalvikare, Münster 1993, 251-254.
10 A. Schröer† / R. Haas, Art. Lüning, Ferdinand, BBKL XXI, Nordhausen 2000, 865-870.
11 Dieses bisher kaum bekannte Datum vom 15.12.1818 ist nun belegt durch das päpstliche Ernennungsschreiben (Breve) im Erzbistums-Archiv Paderborn (EAP) XXI, 216, 153-156 (Urkunde und Abschrift) und Urkundensammlung.
12 H. J. Brandt / K. Hengst, Geschichte des Erzbistums Paderborn, Bd. 2: Das Bistum Paderborn von der Reformation bis zur Säkularisation 1532-1802/21, Paderborn 2007, 268, 396; Bd. 3: Das Bistum Pa- derborn im Industriezeitalter 1821-1930, Paderborn 1997, 31, 41f., 128.
13 C. Zehrt, Eichsfeldische Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, Heiligenstadt 1892, 67; B. Opfermann, Die kirchliche Verwaltung des Eichsfeldes in seiner Vergangenheit. Ein Handbuch mit 5 Karten, Heiligenstadt, 1958, 24.
14 D. Burkard, Staatskirche, Papstkirche, Bischofskirche. Die „Frankfurter Konferenzen“ und die Neuordnung der Kirche in Deutschland nach der Säkularisation (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 53. Supplementband), Rom-Freiburg-Wien 2000.
15 D. Burkard, Kirchliche Eliten, nur 159.
16 G. Tiggesbäumker, Ferdinand Reichsfreiherr von Lüninck. Der letzte Bischof von Corvey (1755-1825), in: Jahrbuch Kreis Höxter 2005, 196-206; ders., Vor 180 Jahren starb der letzte Bischof von Corvey, in: Höxter-Corvey. Monatsheft des Heimat- und Verkehrsverein Höxter 53 (3) (2005) 5-10.
17 A. Wand, Die Katholische Kirche in Thüringen (1785-1914). Forschungen im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Heiligenstadt 2011, 221-229.
18 EAP, XXI Corvey, Kloster und Bistümer, A 216, Blatt 153-176 und A rot 158.
19 Bistumsarchiv Erfurt (BE), Geistliches Gericht, ältere Bestände II. 4 und VI. 1.
20 Bei der in den Quellen und der Literatur schwankenden Schreibweise des Familiennamens Lüninck oder Lüning wurde hier einheitlich Lüning gewählt, weil er selbst in den meisten Briefen so unterschrieben hat.
21 F. Keinemann, Das Domkapitel zu Münster im 18. Jahrhundert. Verfassung / persönliche Zusammensetzung / Parteiverhältnisse (Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen Landesforschung, Bd. 11), Münster 1967, 250, Nr. 205.
22 Vgl. zum Modell der Benediktinerabtei Fulda zum Fürstbistum: W. Kathrein, Die Erhebung der Fürstabtei Fulda zum Bistum 1752/53, in: 250 Jahre Bistum Fulda (Dokumentation zur Stadtgeschichte 22), Fulda 2002, 16-12; ders., Die Kirchliche Verfassung des Hochstifts und Bistums Fulda im Spiegel der Berufungen von Generalvikaren und Weihbischöfen, in: AMKG 62 (2010) 139-154.
23 G. Föllinger, Corvey – Von der Reichsabtei zum Fürstbistum (Paderborner Theologische Studien, Bd. 7), Paderborn 1978, 94-145.
24 H.J. Brandt / K.-Hengst, Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn, Paderborn 1984, Nr. 54, 265-269.
25 Vgl. W. Thissen (Hg.), Handbuch Bistum Münster, Bd. I, A. Schröer, Die Bischöfe von Münster, Nr. 62, 244-250.
26 R. Haas, Art. Droste zu Vischering, Caspar, BBKL XXXIV, Nordhausen 2013 (im Druck).
27 R. Haas, War die erste deutsche Bischofskonferenz im Jahre 1845 in Münster? Hintergründe und Perspektiven des Goldenen Bischofsjubiläums von Bischof Caspar Max Droste zu Vischering, in: Haas, R. (Hg), Ecclesia Monasteriensis. Beiträge zur Kirchengeschichte und religiösen Volkskunde Westfalens. Festschrift für Alois Schröer zum 85. Geburtstag (Geschichte und Kultur, Bd. 7), Münster 1992, 171-260; ders., War das Goldene Bischofsjubiläums von Caspar Max Droste-Vischering in Münster im Jahre 1845 die erste deutsche Bischofskonferenz?, in: AHC 24 (1992) 209-229; ders., Die Adresse des Kempener Dechanten Schönbrod zum Goldenen Priester- und Bischofsjubiläum von Bischof Caspar Max Droste zu Vischering (1845-46), in: Neuheuser, H. P. (Hg.), Quellen und Beiträge aus dem Props- teiarchiv Kempen, Bd. 2, Köln 1998, 77-117.
28 G. Föllinger, Corvey, 146-173.
29 Nach H. J. Brand / K. Hengst, Das Bistum Paderborn 2, 396 ließ Fürstbischof Lüning u. a. eine neue Kirche in Amelunxen bauen.
30 In Anschluss an G. Föllinger, Corvey, 154 und 177 ist zu differenzieren, dass Wilhelm V. (†1806) von Oranien-Nassau als Fürst der Entschädigungslande Corvey und Fulda direkt 1802 zugunsten seines Sohnes Erbprinz Wilhelm (I.) Friedrich (†1843) von Oranien-Nassau, der 1813 König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg werden sollte, verzichtet hatte, dessen Herrschaft auch nur bis 1806 dauerte.
31 R. Haas, Warum scheiterte 1928 der erste Plan für ein Bistum Essen?, in: Göllner, R. (Hg.), Das Ruhrbistum in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 50 Jahre Bistum Essen (Theologie im Kontext, Bd. 17), Münster 2010, 27-63, hier 36.
32 M. Asche, Krise und Untergang der alten Reichskirche in den geistlichen Territorien Norddeutschlands. Formen und Verlaufstypen eines Umbruch, in: Historisches Jahrbuch 124 (2004) 179-259; R. Haas, „Dem bösen Willen des Domkapitels die Schuld beimesset …“. Zum Ende der Adelsdominanz in den westfälischen Domkapiteln 1803-1823, in: Frese, W. (Hg.), Zwischen Revolution und Reform. Der westfälische Adel um 1800 (Vereinigte Westfälische Adelsarchive, Veröffentlichungen 16, Westfälische Quellen und Archivpublikationen Bd. 24), Münster 2005, 25-44.
33 W. Lipgens, Ferdinand August Graf Spiegel und das Verhältnis von Kirche und Staat 1789-1835. Die Wende vom Staatskirchentum zur Kirchenfreiheit (Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens XVIII, Westfälische Biographien IV), 2 Bde., Münster 1965.
34 Zu einer vergleichbaren Regelung kam es im linksrheinischen französischen Bistum Aachen J. Torsy, Geschichte des Bistums Aachen während der französischen Zeit (1802-1814), Bonn 1940; R. Haas, Der Generalvikar im Hintergrund: Dr. theol. Michael Klinkenberg als zweiter Generalvikar (1807-1822) des ersten Bistums Aachen, in: Geschichte im Bistum Aachen 6 (2001/2002) 197-229.
35 R. Haas, Domkapitel, 71-82.
36 R. Haas, Domkapitel, 175-196.
37 R. Haas, Domkapitel, 196-207.
38 Vgl. u. a. H. H. Schwedt, Das Römische Urteil über Georg Hermes (1775-1831). Ein Beitrag zur Geschichte der Inquisition im 19. Jahrhundert (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Supplementheft 37), Freiburg 1980; T. Fliethmann, Vernünftig glauben. Die Theorie der Theologie bei Georg Hermes, Würzburg 1997.
39 R. Haas, Domkapitel, 208-217.
40 F. Jürgensmeier, Art. J. M. von Haunold, in: Gatz, E. (Hg.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648-1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, 175f.
41 Aus der umfangreichen Literatur über ihn vgl. von H. Bastgen, Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland (Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft 30), Paderborn 1917 bis K.-B. Springer, Carl von Dalberg (1744-1817) als letzter kurmainzer Stadthalter (1771/72-1802) in Erfurt im Kontext der Erforschung des Reformabsolutismus (Habilitationsschrift Erfurt 2011).
42 K. Hausberger, Geschichte des Bistums Regensburg, Bd. 2: Vom Barock bis zur Gegenwart, Regensburg 1989, 94-104.
43 O. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage, 3 Teile, Freiburg 1885, II, 12f.
44 H. Ammerich, Das Bayerische Konkordat 1817, Weißenhorn 2000.
45 R. Haas, Domkapitel, 242-257.
46 Zur bisher noch nicht vollständig edierten Denkschrift vgl. R. Haas, Domkapitel, 223-226.
47 R. Haas, Domkapitel, 230.
48 EAP, XXI 216, 152f.
49 BE, Geistliches Gericht, älterer Bestand II. 4.
50 A. Wand, Die Katholische Kirche in Thüringen, 221.
51 EAP, XXI 216, 162 und BE, Geistliches Gericht, ältere Abteilung II. 4.
52 EAP, XXI 216, 157f.
53 EAP, XXI 216, 166.
54 EAP, XXI 216, 162f.
55 EAP, XXI 216, 160f.
56 EAP, XXI 216, 158: Aufgabenbeschreibung von Pfarrer Rensing.
57 Schriftliche Auskunft von Archivdirektor Dr. Michael Matscha, 14.04.2011.
58 C. Zehrt, Eichsfeldische Kirchengeschichte, 119; A. Wand, Die Katholische Kirche in Thüringen, 225.
59 W. Liese, Necrologium Paderbornense. Totenbuch Paderborner Priester (1822-1930), Paderborn 1934, 366.
60 A. Wand, Die Katholische Kirche in Thüringen, 225f. berichtet von einem Konflikt um Kommissar Würschmitt (ab 1815 Assessor, ab 1830 Direktor des Geistlichen Gerichtes, †1863) wegen der Vernachlässigung seiner Predigtpraxis, an dem das Berliner Kultusministerium, die Erfurter Regierung und der Fürstbischof Lüning mitwirkten.
61 A. Wand, Die Katholische Kirche in Thüringen, 226-229.
62 Priester-Daten nach: W. Liese, Necrologium Paderbornense; A. Wand, Die Katholische Kirche in Thüringen, 119.
63 Vgl. BE, Geistliches Gericht, älterer Bestand VI. 1.
64 EAP, XXI 216, 178.
65 BE, Geistliches Gericht, älterer Bestand VI. 1.
66 Directorium pro districtu Erfordiensi sive ordo recitandi officium divinum missamque celebrandai juxta breviarium ac missale Romanum et normam proprii sanctorum jussu et authoritate reverendissimi ac celsissimi domini domini Ferdinandi die gratia episcopi et principis Corbejensis, episcopi Monasteriensis, vicarii provincia rum Erfurth et Eichsfeld in spiritualibus apostolici etc. etc. pro anno Christi MDCCCXXI, Aschaffenburgi (1820). Herrn Archivdirektor Dr. Michael Matscha gilt der Dank für den Hinweis auf das Exemplar in der Dienstbibliothek des Bistumsarchivs Erfurt (DV 422 (U) 7).
67 E. R. Huber / W. Huber, Staat und Kirche im 19. Und 20 Jahrhundert. Dokumente zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd. I: Staat und Kirche vom Ausgang des alten Reichs bis zur Vorabend der bürgerlichen Revolution, Berlin 1973, 203-222, hier Punkt XXX, 212f. „die von der Diözes Maynz, später Regensburg, abgelösten Orte und Pfarreien, die von dem vormaligen Bischofe von Corvey, jetzt Bischofe von Münster, verwaltet werden, der einstweiligen Leitung eines apostolischen Vikars anvertraut werden.“
68 W. Lipgens, Ferdinand August Graf Spiegel I, 288; R. Haas, Domkapitel, 278.
69 A. Eichhorn, Die Ausführung der Bulle „De salute animarum“ in den einzelnen Diözesen des Preußischen Staates durch den Fürstbischof von Ermland, Prinz Josef von Hohenzollern, in: ZGAE 5 (1870-1874) 1-130; B. Wolf-Dahm, Art. J. W. F. Prinz von Hohenzollern-Hechingen, in: BBKL 3, Herzberg 1992, 679-683.
70 R. Haas, Domkapitel, 281.
71 R. Haas, Domkapitel, 284-290.
72 R. Haas, Domkapitel, 296-304.
73 R. Haas, Domkapitel, 284-294.
74 H. J. Brandt / K. Hengst, Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn, Nr. 56, 269-299.
75 EAP, XXI 216, 159.
76 H. J. Brandt / K. Hengst, Das Bistum Paderborn 3, 41.