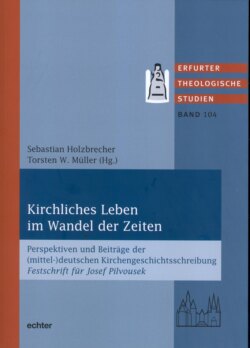Читать книгу Kirchliches Leben im Wandel der Zeiten - Группа авторов - Страница 34
Joseph von Görres – Eine biographische Skizze Wolfgang Bergsdorf
Оглавление1948, das Geburtsjahr unseres Jubilars, des katholischen Kirchenhistorikers Josef Pilvousek, war das 100. Todesjahr von Joseph Görres, der sich in der Geschichte des politischen Katholizismus in Deutschland, wie er sich in Katholikentagen, im katholischen Verband- und Vereinswesen und später auch in der Zentrumspartei entfaltete, einen festen Platz erobert hat ebenso wie auch in der Geschichte der deutschen Publizistik mit dem von ihm 1814 gegründeten Rheinischen Merkur. Görres war ein genialer Autodidakt, wortgewaltiger Publizist und universalistischer Denker. Er führte seinen Familiennamen zurück auf eine volkstümliche Verballhornung von Gregorius, dem Drachentöter. Zeit seines Lebens hat er gegen die Drachen der Willkürherrschaft und Staatsallmacht gekämpft und sich für Gerechtigkeit, Freiheit und Einheit seines Vaterlandes eingesetzt. Sein Zeitgenosse Jean Paul nannte ihn „einen Mann, der aus Männern besteht.“1 Einer seiner geistigen Nachfahren, der langjährige Chefredakteur und spätere Herausgeber des 1946 revitalisierten „Rheinischen Merkur“, Otto B. Roegele, hat dem Herausgeber des ersten „Rheinischen Merkur“ von 1814 bis 1816 in einem Porträt bescheinigt, er habe „das Herz eines Revolutionärs, das historische Bewusstsein eines Konservativen, den Scharfblick eines Naturforschers, die Phantasie eines Dichters und die politische Leidenschaft eines geborenen Publizisten.“2
Görres hatte nie ein hohes Staatsamt inne, dennoch adelte ihn Napoleon als seinen Gegenspieler, indem er ihn mit seinem „Rheinischen Merkur“ als eine „cinquième puissance“ fürchtete.3 Görres hatte nie eine Universität besucht, gleichwohl wurde er zunächst in Heidelberg und später in München ein einflussreicher Hochschullehrer. Auch das publizistische Handwerk hatte er nie erlernt, obwohl er mit seinen vielfältigen publizistischen Unternehmungen die wirkungsmächtigste Stimme im deutschen Raum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden sollte.
Joseph Görres lebte zwischen zwei Revolutionen, zwischen der Französischen Revolution von 1789, die er erlebte, zunächst bewunderte, dann erlitt und schließlich bekämpfte, und der erahnten und ersehnten Revolution von 1848. Ihren Ausbruch und ihr Scheitern sollte er nicht mehr erleben.4 Die Irrungen und Wirrungen dieser an Umbrüchen reichen Zeit machten Görres zu einem der ersten Krisendenker Deutschlands, dessen Krisenwahrnehmung immer deutlicher eine antirevolutionäre Wendung nahm. Er plädierte dafür, der Revolution durch eine freiheitlich-ständische Verfassung zuvorzukommen.5 Das machte ihn zum Vorkämpfer der Freiheit und Einheit Deutschlands und zum wortmächtigen Kämpfer für die Freiheit der katholischen Kirche. Im revolutionären Taumel hatte er sich der katholischen Kirche entfremdet, im Straßburger Exil fand er zur Kirche zurück und wurde zu einem Wegbereiter des politischen Katholizismus, der sich im Revolutionsjahr 1848 zu formieren begann.6
I.
Joseph Görres wuchs – 1776 in Koblenz geboren – als ältestes von acht Kindern in einer kleinbürgerlichen Familie auf. Sein Vater Moritz Görres war ein rheinfränkischer Händler von geflößtem Holz, dessen Vorfahren an der Mosel lebten. Seine Mutter, Helene Theresia Görres, geborene Mazza, war in Koblenz aufgewachsen. Ihre Vorfahren stammten aus Italien. 1786 trat Görres als Zehnjähriger in das von Jesuiten geleitete Gymnasium ein. In ihm herrschte der Geist der Aufklärung, der den frühreifen und hochbegabten Görres prägte. Die am Gymnasium angebotenen Fächer unterforderten ihn. Er betrieb eigene historische, geographische und naturwissenschaftliche Studien und versenkte sich darüber hinaus in die lateinischen Klassiker und später in die Werke von Klopstock, Gellert, Goethe, Schiller und Kant. So vorbereitet, erlag der Autodidakt Görres der Faszinationskraft der Französischen Revolution mit ihren großen Versprechungen. 1793 verlässt er das Gymnasium, um Medizin zu studieren. Aber „der Lärm der Zeit ist so groß, als daß er eine Universität beziehen könnte. In ihm reden nicht minder laut ungestüme Stimmen.“7 1794 besetzten die Franzosen Koblenz, und der Feuerkopf Görres übernahm die Parolen der Revolution und agitierte für die Gründung einer Cisrhenanischen Republik an der Seite Frankreichs. Von ihr erhoffte er sich die Verwirklichung der revolutionären Trias Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Als junger Mann ließ er sich von der Freiheitsbewegung mitreißen, misstraute allen politischen und kirchlichen Hierarchien, glänzte als ingeniöser Redner in den vaterstädtischen Clubs und verfasste erste Beiträge für Periodika, die seine literarische und seine polemische Begabung erkennen ließen. 1796 erschien seine Erstlingsschrift „Der Allgemeine Friede, ein Ideal“. 1798 gründete er das „Rothe Blatt, eine Dekadenschrift“, in der er die von den Besatzungsbehörden zu verantwortenden Missstände anprangerte. Sein Kampf gegen Entscheidungen der Besatzungsherrschaft machte ihn bald bekannt und führte bald zu einem Verbot durch die Landesdirektion. Dadurch ließ er sich nicht entmutigen und startete noch im gleichen Jahr ein neues Blatt mit dem Titel „Rübezahl“, in welchem er die politische Linie der verbotenen Zeitschrift weiterentwickelte. Der neue Titel „Rübezahl“ wurde hier als Symbol des Rächers der Unterdrückten und des Wiederherstellers des Rechts in Anspruch genommen.
Von seinen Mitbürgern wurde Görres zusammen mit drei Gesinnungsgenossen nach Mainz entsandt, um vor den französischen Besatzungsbehörden Beschwerde zu führen gegen die Willkürakte des kommandierenden Generals Leval. Dies brachte ihm eine zwanzigtägige Haftstrafe ein. 1799 reiste er an der Spitze einer Delegation seiner Heimatstadt nach Paris. Nach dem Sturz des Direktoriums bat er um eine Beendigung der drückenden Okkupation und eine Vereinigung und Gleichstellung des linken Rheinufers mit Frankreich. Seine persönliche Begegnung mit dem Ersten Konsul Bonaparte ließ ihn die prophetischen Worte an seine Mitbürger schreiben: „Nehmt auch in Bälde den Suetonius zur Hand, denn der neue Augustus ist fertig.“8 Die in Paris gewonnenen Eindrücke heilten den jungen Idealisten von seiner revolutionären Begeisterung. Der Gesinnungswandel war nicht Resultat reinen Nachdenkens, sondern folgte einer Kollision mit der Realität.
In seiner Schrift „Resultante meiner Sendung nach Paris“ (1800) erklärte er seine Abkehr von einer republikanischen Verfassung, denn „der Zweck der Revolution (ist) gänzlich verfehlt.“9 In dieser Schrift warnt er seine Mitbürger vor den Ideen der Französischen Revolution und entdeckt seine „rheinisch-deutsche Verwurzelung.“ (Rudolf Morsey) Aus dem vom Geist der Revolution inspirierten Weltbürger wurde der seiner rheinischen und deutschen Identität bewusste Patriot.
II.
Mit dem neuen Jahrhundert beendete er seine politisch-publizistische Tätigkeit und wandte sich seiner wissenschaftlichen und literarischen Arbeit zu. Er übernahm eine Gymnasiallehrerstelle für Chemie und Physik an der Französischen Sekundärschule in Koblenz, seinem früheren Gymnasium. Es war eine wenig einträgliche Stelle mit einem Jahresgehalt von 1.400 Franken, aber sie gestattete ihm einen bescheidenen Lebensstandard. Im Herbst 1801 gab er seinem Leben einen festen Rahmen durch die Vermählung mit Katharina von Lassaulx, Tochter des früheren Kurtrierischen Hofrats Peter Ernst von Lassaulx. Sie war eine schöne, geistvolle und freigeistige Frau. Das Paar begnügte sich mit einer zivilen Eheschließung nach französischem Recht.
Die Tätigkeit als Gymnasialprofessor ließ Görres Zeit, seine naturwissenschaftlichen und medizinischen Studien zu vertiefen und sich darüber hinaus mit indogermanischer Philologie und Mythologie zu beschäftigen. Zudem fühlte er sich zur Kunstwissenschaft hingezogen. In jener Zeit entstanden seine Schriften „Aphorismen über die Kunst“ (1802), „Aphorismen über Organonomie“ (1803), „Exposition der Physiologie“ (1805) und „Aphorismen über Organologie“ (1805) sowie sein Buch „Glauben und Wissen“ (1806), das sich noch in den von der Schellingschen Naturphilosophie vorgezeichneten pantheistischen Bahnen bewegte, aber doch schon eine Rückkehr zur katholischen Kirche erahnen ließ, deren wichtigstes Sprachrohr im Deutschland der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts er werden sollte. Seine schriftstellerische Tätigkeit in literarischen Zeitschriften wurde vom zeitgenössischen Idealismus inspiriert. Herder und Schelling halfen ihm, die Bedeutung von Sprache, Nationalstereotypen und Volkstum zu entdecken. Sein Geschichtsverständnis begann sich zu wandeln. Der revolutionäre Fortschrittsoptimist wurde zu einem konservativen Denker mit offenen Sinnen für Metaphysik. Sein Weltbild wurde vom Streben nach organischer, lebendiger Universalität bestimmt.
1806 wechselte er als Dozent an die Heidelberger Universität, um dort philosophische, physiologische und anthropologische Vorlesungen zu halten. Er bot aber auch Veranstaltungen zu altdeutscher Literatur an. Die erstaunliche Vielfalt seiner Interessen und seiner geistes- und naturwissenschaftlichen Kenntnisse wollte er einmünden lassen in eine Synthese von Geistes- und Naturwissenschaft.
Nach Heidelberg hatte ihn sein früherer Mitschüler und Jugendfreund Clemens von Brentano geholt. Zusammen mit ihm und Achim von Arnim wurde Görres zum Mitbegründer der jüngeren Romantik. Zu seinen Heidelberger Hörern gehörte auch Joseph von Eichendorff. In den Tagebüchern von Joseph von Eichendorff charakterisiert der romantische Dichter die Astronomie-Vorlesung von Joseph Görres: „Blaß, jung, wildbewachsen, feurigen Auges, aber monotoner Vortrag.“ Seine philosophische Vorlesung empfand Eichendorff als „ein göttlich Kolleg.“ Später schreibt er „Es ist unbegreiflich, welche Gewalt dieser Mann, damals selbst noch jung, auf die Jugend ausübt. Sein freier Vortrag war monoton, fast wie ein fernes Meeresrauschen, schwellend und sinkend, aber durch das einförmige Gemurmel leuchteten zwei wunderbare Augen und zuckten Gedankenblitze beständig hin und her; es war wie ein prächtiges nächtliches Gewitter, weckend und zündend für ein ganzes Leben.“10
Doch die Heidelberger Zeit blieb Episode. 1808 kehrte er auf die freigehaltene Stelle an der Sekundärschule in Koblenz zurück. Dort setzte er seine eklektischen sprachwissenschaftlichen und mythologischen Studien fort und lernte sogar im Selbststudium Persisch. Er veröffentlichte eine zweibändige „Mythengeschichte der asiatischen Welt“ (1810). In den Vorworten zu seinen Werken und in Aufsätzen behielt Görres das politische Geschehen in Deutschland im Auge. In „Über den Fall Teutschlands und die Bedingungen einer Wiedergeburt“ (1810) plädierte Görres für eine sittlich-religiöse Erneuerung. Als Voraussetzung einer solchen Erneuerung forderte er die Schaffung einer öffentlichen Meinung als Gewissen der Nation und der Regierungen.11
III.
Es sollte nicht lange dauern, bis Görres seine Forderung nach der Formierung einer öffentlichen Meinung selbst verkörpern konnte. Nach der Völkerschlacht von Leipzig (1813) erschienen im Januar 1814 die Heere der Alliierten am Rhein. Vor ihnen zog sich die französische Besatzungsmacht zurück. So konnte Görres am 23. Januar die Erstausgabe einer neuen Zeitung, nämlich seines „Rheinischen Merkur“ herausbringen. Mit Joseph Görres sollte der „Rheinische Merkur“ seine Leser für die deutsche Sache und die der Heiligen Allianz gewinnen.
Görres‘ Popularität, seine Sprachkraft, seine Energie verhalfen dem Rheinischen Merkur trotz der geringen Auflage von 5.000 Exemplaren zu der Stellung eines Nationalblattes, wie es Deutschland weder vorher noch nachher besessen hatte. Das Blatt erschien zwei bis viermal wöchentlich und wurde bald als Stimme Deutschlands im Kampf gegen Napoleon wahrgenommen. Mit dem Titel „Rheinischer Merkur“ wollte Görres „die rheinische Zunge, welche seit zwanzig Jahren in der Genossenschaft deutscher Völkerschaften beinahe ganz verstummt, in dem großen deutschen Orden wiederherstellen und ihr wieder Sitz und Stimme verschaffen im Rat der Brüder.“12
Der „Rheinische Merkur“ und sein Herausgeber wurden zum nationalen Sprachrohr der Deutschen gegen die Napoleonische Herrschaft. Von der nationalen Erregung ließ sich auch die deutsche Elite anstecken. Nicht nur die romantischen Schriftsteller und Freunde von Joseph Görres wie Clemens von Brentano, Achim von Arnim und die Gebrüder Grimm, auch Ernst Moritz Arndt, Gneisenau, Blücher und Scharnhorst unterhielten enge Beziehungen zum Herausgeber des „Rheinischen Merkur“. Auch der Weimarer Geheimrat Goethe besuchte zusammen mit Freiherr vom Stein Görres im August 1815 in Koblenz und frühstückte mit der Familie Görres auf der Kartause.13
Nach der Niederlage Napoleons konzentrierte sich Görres auf den Kampf gegen die Ergebnisse des Wiener Kongresses. Auf ihm hatten die Fürsten beschlossen, den Deutschen Bund wiederherzustellen, nicht aber das deutsche Kaisertum unter österreichischer Führung. Vor allem attackierte Görres den Bruch der Verfassungsversprechen und die Rückkehr des absolutistischen Geistes und bürokratischer Schikane (Rudolf Morsey) in den jetzt von den Preußen verwalteten Rheinlanden. Die Kompromisslosigkeit seines Engagements machte ihn zum Hoffnungsträger der freiheitlichen Patrioten und gleichzeitig zur Gefahr für die Politik der Restauration, zu der sich die preußische Regierung entschlossen hatte. Zu Beginn des Jahres 1816 verloren die preußischen Behörden die Geduld mit dem zornigen Publizisten aus Koblenz und verboten den „Rheinischen Merkur“.
Um den unbequemen Geist aus dem Rheinland abzuziehen, bot ihm die preußische Regierung einen Lehrstuhl in Berlin an. Er lehnte ihn ab mit dem Hinweis, wenn er in Berlin zu einem Lehramt tauge, dann tauge er auch für seine Professur in seiner Heimat, nämlich an der neu errichteten Universität Bonn. Zuvor hatte er einen Ruf nach Lüttich ebenso abgelehnt wie die Berufung auf die Leitung der Stuttgarter Kunstschule. Görres befürchtete eine Verminderung seiner publizistischen Wirksamkeit, wenn er seinen heimischen Humus verlöre.
Nach der Ermordung des Dramatikers und russischen Staatsrates August von Kotzebue durch den Studenten Karl Ludwig Sand reagierten die preußischen Behörden mit verschärfter Repression. Kotzebue hatte in seinem 1818 gegründeten „Literarischen Wochenblatt“ die freiheitlichen Ideen des Wartburg-Festes verspottet. Die harte Reaktion des Staates auf das Attentat ließ Görres erneut zur Feder greifen. Unter dem Titel „Teutschland und die Revolution“ (1819) verfasste er eine in glühender Sprache gehaltene Kampfschrift gegen den Polizeistaat. Erneut sagte er sich von seiner jakobinischen und radikaldemokratischen Vergangenheit los und plädierte für die bewahrenden Kräfte von Monarchie und Kirche. Er hob die wichtige Rolle der Religion für die Sicherung geistiger und politischer Freiheit hervor. Nach Abschluss des Manuskriptes sagte Görres: „In Berlin wird’s diesmal sehr donnern.“14 Es war mehr als Donner: Friedrich Wilhelm III. erließ per Kabinettsorder einen Haftbefehl gegen Görres und wollte ihn in die Festung Spandau bringen lassen. Görres erfuhr rechtzeitig von der drohenden Verhaftung und setzte sich nach Frankfurt ab. Als er auch dort verfolgt wurde, floh er nach Straßburg ins Exil. Dort sollte er bis 1827 bleiben, einschließlich eines einjährigen Aufenthaltes in der Schweiz.
IV.
Die Trennung vom Rheinland für den Rest seines Lebens markiert eine wichtige Zäsur in Görres’ äußerem Lebensweg. „Sein Vaterland hat ihn ausgespien“, kommentiert sein Freund Clemens von Brentano den neuen Wohnort.15 Es ist nicht ohne Ironie, dass Görres, der Frankreich so lange bekämpfte, in Straßburg Zuflucht finden sollte und die Stadt ihn mit offenen Armen empfing. Benjamin Constant begrüßte ihn als den von den Königen Europas Verfolgten. Die Pariser Zeitung „Moniteur“ stellte ihn pathetisch unter Frankreichs Schutz. In Straßburg könne er, wie ihn Achim von Arnim tröstet, „die Periode der Dummheit bequem abwarten.“16 Dort kam Görres tatsächlich zur Ruhe und setzte seine schriftstellerische Tätigkeit fort.
Im Exil weitete sich das Blickfeld von Joseph Görres auf Europa aus. In nur 27 Tagen verfasste er seine Schrift „Europa und die Revolution“ (1821). Es ist die wahrscheinlich bedeutendste und tiefsinnigste seiner politischen Schriften. In ihr hielt er Europa das politische Elend seines gegenwärtigen Zustands in einer an das Alte Testament erinnernden Sprache vor Augen. Erneuerung und Wiedergeburt vermögen die Staaten nur durch innere Festigung erreichen. Ein lebensfähiger und zukunftsfester Staat gelinge nur auf der Grundlage der Religion, die – verkörpert in der Kirche – allein den Völkern Europas geistige und politische Freiheit sichern könne.17 Auch dieser Schrift wurde die Ehre zuteil, von der preußischen Regierung verboten zu werden mit dem Argument, sie gefährde die Monarchie. Aber Görres ließ sich nicht entmutigen. Schon im nächsten Jahr erschienen neue Veröffentlichungen, in denen er die erdrückenden Folgen der Restauration für die Freiheitsrechte nach dem Wiener Kongress darlegte.
Schon während seiner Arbeit am „Rheinischen Merkur“ hatte Görres seinen Frieden mit der katholischen Kirche gemacht, vorbereitet auch durch seine historischen und mythologischen Studien. 1824 kehrte er mit seiner Familie auch formell in die Kirche zurück, ließ sich kirchlich trauen und entwickelte ein lebhaftes Interesse an theologischen und kirchenpolitischen Fragestellungen.
V.
Im Herbst 1827 erhielt Joseph Görres einen Ruf an die Münchner Universität. Er nahm ihn an und konnte so ehrenvoll nach Deutschland zurückkehren. König Ludwig I. von Bayern hatte sich mit dieser Berufung allen preußischen Einwänden widersetzt. Zu Beginn seiner Regierung war Ludwig I. ein äußerst reformfreudiger Monarch und hatte eine Verlegung der altbayerischen Universität Landshut in die bayerische Hauptstadt verfügt. Er wollte so eine Chance für einen organisatorischen, ideellen und personellen Neuaufbau eröffnen. Der Ruf an Görres zum Wintersemester 1827/28 war trotz der Sparpolitik des Königs zustande gekommen, um mit dem „genialen Görres“ der Münchner Universität Anziehungskraft auf die akademische Jugend zu verschaffen. Sein universalistischer Wissenschaftsgeist, sein hohes Bildungsethos und seine ausstrahlende geistige Potenz sollten möglichst viele Hörer anlocken. Nicht zuletzt wurde die Universität mit der Hoffnung konfrontiert, dass Görres „der christlichen katholischen Richtung ein entschiedenes Übergewicht“ verschaffen sollte.18
Görres wurde der Lehrauftrag erteilt für „Allgemeine und Litteratärgeschichte“. Heimisch wurde Görres in München nicht, zu tief war seine rheinische Verwurzelung. Aber er avancierte bald zur Zentralfigur eines Kreises. Hatte er zuvor in Heidelberg die Romantiker um sich versammelt, so wurde er in München zum Mittelpunkt eines kirchenpolitischen Engagements für eine Erneuerung des katholischen Deutschlands. Dieser Kreis von katholischen Gelehrten hatte schon den Ruf von Görres nach München begrüßt und versuchte, das Übergewicht der aufklärerischen protestantischen Wissenschaft und des weltanschaulichen Liberalismus auszutarieren. Zu diesem Kreis gehörten der Philosoph Franz Baader, der Theologe Ignaz Döllinger, der spätere Bischof von Eichstätt Georg von Öttl und der spätere Bischof von Regensburg, Franz Xaver von Schwäbl.
Diese Persönlichkeiten fanden sich zu regelmäßigen Treffen in einem Lokal und bildeten den Kern einer Mannschaft, die sich – verstärkt durch Görres – entschloss, eine Zeitschrift herauszubringen, welcher der programmatische Name „Eos“ gegeben wurde. Von ihren Gegnern wurde der Eos-Kreis rasch mit dem Etikett „Congregation“ belegt, um „Jesuitismus, Ultrakonservatismus und Geheimbündelei“ zu insinuieren. Dabei war der Kreis weit von einer homogenen Geschlossenheit entfernt. Bei den Treffen wurde über alle aktuellen Themen in Wissenschaft, Politik und Kunst debattiert. Zu jedem Thema gab es mindestens so viele Ansichten wie Teilnehmer. Dieser Kreis war auch offen für Protestanten.
Görres’ Start als Hochschullehrer geriet fulminant. Nicht nur Studierende, auch Freunde, Männer des öffentlichen Lebens, Künstler und Durchreisende wollten den berühmten Mann hören und sehen. Kein Hörsaal reichte aus, um die Zahl seiner Zuhörer zu fassen. Die neue Hochschulpolitik Ludwigs I. hatte völlige Studienfreiheit durchgesetzt. Die auf sechs Semester berechneten Berufsfächer ließen in einem langen fünfjährigen Studium ausreichend Zeit, die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten der Universität zu nutzen. So wurde der Besuch von juristischen, theologischen und philosophischen Vorlesungen für alle Studierenden möglich. Von diesem Studium Generale profitierte Görres. Die Studenten richteten hochgespannte Erwartungen an ihn als eine nationale und weltanschauliche Symbolfigur. Das galt für seine Anhänger wie auch für seine Gegner.19 „Lebte er nicht hier, so wäre München ein gewöhnlicher Ort“, rühmte Clemens von Brentano 1833 die Bedeutung seines Freundes Görres für die Bedeutung der Hauptstadt.20 Görres war als Exponent einer universalistischen Wissenschaftskonzeption nach München gerufen worden, und er hat die Chance ergriffen, die sich ihm an der neustrukturierten Universität bot. Seine Lehrtätigkeit war fachübergreifend. Er wollte das Wissen seiner Zeit anbieten in einer weltanschaulich orientierenden Gesamtschau.
Die Freistudienverordnung von 1827 verschaffte Görres eine geistige Breitenwirkung. Er konnte bei seinen Kollegien regelmäßig mit 500 bis 600 Zuhörern rechnen. Neue Statuten des Ministeriums Oettingen-Wallerstein versetzten aber 1832 dem Studium Generale einen herben Schlag. Von ihm war auch Görres betroffen. Sein Wissenschaftsverständnis kollidierte mit den neuen Vorschriften, die den Studierenden weniger Freiraum ließen als zuvor. Dadurch schmolz der Besuch seiner Veranstaltungen deutlich ab. Sie waren Luxusveranstaltungen geworden, weil die Studierenden die Mindestanforderungen der Prüfungsordnung zur Norm machten und nichts belegten, was nicht notwendig war.21 Die neue Studienordnung galt nur für bayerische Studenten. Nichtbayerische Hörer und Theologiestudenten, die bei Görres ihre Theologiestudien zu vertiefen suchten, bildeten jetzt die Stammmannschaft seiner Kollegien. Über sie spottet Heinrich Heine, sie seien eine „Ecole Polytechnique d’Obscurantisme“.22
Mit den Professoren seiner Fakultät pflegte Görres nur wenig Umgang. Von seinen Pflichten als Fakultätsmitglied dispensierte er sich weitgehend. Vor allem mit seinen Historikerkollegen lebte er in Anspannung, weil sein intuitives Wissenschaftsverständnis und seine titanische Geschichtsauffassung mit der damals sich etablierenden historischen Methode kollidierten. Das ist auch der Grund dafür, dass er nicht zum Haupt einer Schule wurde. Die meisten, die sich als seine Schüler bezeichneten, waren Theologen, darunter die beiden großen Wegbereiter der katholischen Sozialbewegung in Deutschland, Adolf Kolping und Freiherr von Ketteler. Der spätere „Gesellenvater“ Kolping hatte zu Beginn der 1840er Jahre drei Semester lang die Görresschen Vorlesungen besucht und sich vom Geist des Kreises um Görres inspirieren lassen. Auch Freiherr Wilhelm Emanuel von Ketteler, der spätere Bischof von Mainz und bedeutendster Wegbereiter der modernen Katholischen Soziallehre in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, verkehrte im Kreis von Görres und Döllinger.
Den Rückgang seiner Studentenzahlen nach der Hochschulreform des Jahres 1832 hatte Görres genutzt, um an seinem Werk „Christliche Mystik“ zu arbeiten, dessen erster Band 1836 erschien. Dabei griff er auf frühere Ansätze seiner universalistischen Geschichtsbetrachtung zurück. Er unterbrach diese Arbeiten, als die preußische Regierung im November 1837 den Kölner Erzbischof Clemens August Freiherr von Droste zu Vischering gefangen nahm und ihn auf der Festung Minden internierte. Abweichend von seinem Vorgänger hatte der Kölner Erzbischof in der Frage der Mischehe eine bestimmtere Haltung eingenommen, die die preußische Regierung durch seine Inhaftnahme brechen wollte. Es ging um die Konfessionszugehörigkeit von Kindern aus konfessionell gemischten Ehen, für die 1834 eine Kompromisslösung zwischen Rom und Berlin gefunden war, die dann nach Meinung der preußischen Regierung durch den Kölner Erzbischof 1837 sabotiert wurde. Dieses „Kölner Ereignis“ musste Görres auf den Plan rufen. In nur vier Wochen schrieb er seinen „Athanasius“, dem noch in seinem Erscheinungsjahr 1838 vier weitere Auflagen folgten.23
Diese Kampfschrift sollte Görres’ berühmteste Veröffentlichung werden. Sie wurde mit einer riesigen Auflage die wahrscheinlich einflussreichste Schrift des Vormärz und sicherte ihrem Autor den Ruf als Sprachrohr des deutschen Katholizismus. Der „Athanasius“ war mehr als ein flammendes Plädoyer gegen die Allmacht des preußischen Staates, der das begangene Unrecht wiedergutzumachen und den Streitfall beizulegen hatte. Zentraler Punkt der Streitschrift war vielmehr die Forderung, die Kirche als eine dem Staat frei und unabhängig gegenüberstehende Einrichtung grundsätzlich anzuerkennen. Görres sagte jedem fürstlichen Absolutismus den Kampf an und verlangte eine neue Realverfassung für die preußische Monarchie. Deshalb gehört der „Athanasius“ zu der „Geschichte der deutschen Freiheit“. Görres ging es in seiner Streitschrift nicht um juristische Argumentationen, sondern um einen politischen Appell, der trotz oder vielleicht sogar wegen seines gemäßigten Gesamtduktus langfristig erfolgreich wurde. „Es ging ihm um Rechtsgleichheit ohne die Rechte anderer Konfessionen zu verletzen und das Band zwischen Kirche und Staat zu zerschneiden“ (Heinz Hürten). Görres hat der katholischen Bewegung Deutschlands, die sich nach seinem Tode zu formieren begann, mit seinem „Athanasius“ ein Programm geschrieben, das bis zum Ende des Bismarckschen Kulturkampfes Geltung beanspruchen konnte. Görres war nun auf dem Höhepunkt seines Einflusses und seiner Popularität. Ein Brief aus den USA mit der Adresse „An Herrn Professor Görres in Europa“ fand seinen Weg in das Görressche Haus in der Schönfeldstraße in München, das Görres 1836 gekauft hatte.24
1839 erhielt er von König Ludwig I. den Verdienstorden der Bayerischen Krone und wurde damit in den persönlichen Adelsstand erhoben. Im katholischen Deutschland und bei den Katholiken in aller Welt galt er nun als der wirkungsmächtigste Streiter für die Freiheit der Kirche.
Seine unermüdlich erscheinende Schaffenskraft ließ ihn die im „Rheinischen Merkur“ immer wieder ventilierte Idee aufgreifen und ausführlich darstellen, das seit hunderten Jahren zum Stillstand gekommene Bauwerk des Kölner Doms als nationales Denkmal endlich zu vollenden. Sein Freund Sulpiz Boisserée hatte Ansichten, Risse und Detailzeichnungen des Domes angefertigt und „Ergänzungen nach dem Entwurf des Meisters“ vorgeschlagen. Boisserée gelang es in der zweiten Dekade des 19. Jahrhunderts, die politischen und intellektuellen Eliten Deutschlands für die Ausbaupläne zu begeistern. Als dann im Herbst 1814 in Amorbach das verschollene Pergament mit den Fassaden „Riss F“ gefunden wurde, rückte die Idee der Vollendung des Torsos aus dem Bereich des Wünschenswerten in den des Möglichen. Inzwischen hatten sich der preußische wie der bayerische Kronprinz sowie Johann Wolfgang von Goethe und Ernst Moritz Arndt für die Boisseréesche Idee stark gemacht, zu deren wortmächtigstem Kommunikator Görres wurde. 1842 legte er die Schrift „Der Dom von Cöln und das Münster zu Straßburg“ vor, dessen Ertrag dem Dombau zugute kam.
Anlass für die letzte Veröffentlichung von Görres vor seinem Tod war die Wallfahrt zum Heiligen Rock nach Trier (1844), an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen. Diese machtvolle Demonstration des rheinischen Katholizismus löste eine heftige Pressefehde aus, in die sich Görres mit seiner Schrift „Die Wallfahrt nach Trier“ (1845) einschaltete. Der Streit zeigt, welche Bedeutung die öffentliche Meinung mittlerweile in Deutschland errungen hatte. Er legte aber auch offen, wie gereizt die beiden Konfessionen um Öffentlichkeit rangen und wie viel Gewicht religiösen Fragen dabei zukam. Die protestantische Seite verstand die Wallfahrt als Manifestation eines undeutschen, von Rom gelenkten Katholizismus. Wie dramatisch sich die konfessionellen Verhältnisse in den letzten 170 Jahren zum Positiven verändert haben, zeigt die Resonanz auf den Aufruf des heutigen Trierer Bischofs, Stephan Ackermann, zur Wallfahrt zum Heiligen Rock 2012. Ihm hat sich der Präses der Rheinischen Kirche und Vorsitzender der EKD, Nikolaus Schneider, angeschlossen und forderte die protestantischen Mitchristen auf, sich im Geiste der Ökumene an dieser Manifestation des Glaubens zu beteiligen.
Am 29. Januar 1848 starb Joseph Görres in München. Der große Publizist und Kämpfer für die Freiheit der Kirche wurde auf dem südlichen Friedhof beigesetzt. Es hat eine hohe Symbolkraft, dass heute gegenüber dem Friedhof das „Medienkloster“ liegt, Sitz des Instituts zur Förderung des publizistischen Nachwuchses der katholischen Kirche, das in den letzten Jahrzehnten mehr als 1.000 Journalisten ausbildete.
Auch dort wird der Geist jenes Mannes wachgehalten, dessen Warnung vor Gewaltherrschaft und staatlicher Willkür und dessen Kampf für die christliche Grundierung des öffentlichen Lebens heute ebenso aktuell ist wie zu seinen Lebzeiten. Diese Probleme trieben und treiben auch unseren Jubilar um, den mit Joseph Görres nicht nur der gemeinsame Vorname verbindet, sondern auch seine Leidenschaft für die Freiheit der Kirche in der pluralistischen Gesellschaft.
1 R. Morsey, Joseph Görres (1776-1848), in: Aretz, J. / Morsey, R. / Rauscher, A. (Hg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern – Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Band 3, Mainz 1979, 26. Vgl. auch H. Raab (Hg.), Joseph Görres (1776-1848). Leben und Werk im Urteil seiner Zeit. J. Görres, Gesammelte Schriften, herausgegeben im Auftrag der Görres-Gesellschaft, Ergänzungsband 1, Paderborn 1995; ders. (Hg.), Joseph Görres, Gesammelte Schriften, Band 14, Schriften der Straßburger Exilszeit 1824-1827, Aufsätze und Beiträge im Katholik, Paderborn 1987; sowie H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Band 5, Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung, Freiburg / Basel / Wien 1985, 477-570.
2 Vgl. W. Bergsdorf, Der Merkur war sein Leben, in: Rheinischer Merkur, Nr. 47, 25. November 2010 (letzte Ausgabe).
3 W. Schellberg, Joseph von Görres, Köln 1926, 77.
4 Vgl. hierzu Art. Görres, in: Staatslexikon der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaften im katholischen Deutschland. Band 2, Freiburg 31909, 810 ff.
5 A. Zingerle, Ein kulturelles Biotop im Wandel. Die Görres-Gesellschaft und die Krisen der Zeit, in: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft, Bonn 2010, 75. Vgl. hierzu auch R. Koselleck, Art. Krise, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Band 3, hg. v. Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck, R., Stuttgart 1982, 617 ff.
6 R. Morsey, Joseph Görres.
7 Staatslexikon, 810.
8 Ebd.
9 Ebd.
10 W. Schellberg, Joseph von Görres, 48.
11 R. Morsey, Joseph Görres, 31.
12 Staatslexikon, 802.
13 W. Schellberg, Joseph von Görres, 75.
14 W. Schellberg, Joseph von Görres, 101.
15 Ebd. 107.
16 Ebd. 111.
17 Europa und die Revolution von Görres, Stuttgart 1821.
18 H. Dickerhof, Görres an der Münchner Universität, in: Philosophisches Jahrbuch 96/ 1 (1976) 150 f.
19 H. Dickerhof, Görres, 152.
20 Ebd. 148.
21 Ebd. 164.
22 Ebd. 165.
23 J. Görres, Gesammelte Schriften, Band XVII. Schriften zum Kölner Ereignis, erster Teil, Athanasius, bearbeitet von H. Hürten, Paderborn 1998.
24 Staatslexikon, 817.